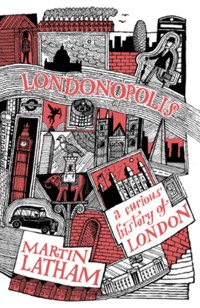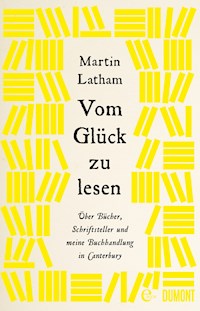
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ob Trost oder Erkenntnis, ob Reisen in andere Welten oder Analysen unserer Realität – Bücher bieten all das und noch viel mehr. Wir tragen sie überall mit uns herum und behalten die wichtigen Lektüren unseres Lebens für immer in unseren Herzen. Wir atmen den Geruch ihrer Seiten ein, kritzeln etwas hinein und schützen sie vor Bücherdieben und Badewasser. Dieser lebenslangen Liebe widmet sich der Buchhändler Martin Latham in diesem inspirierenden Buch. Er erzählt von Schmugglern, Bibliothekaren, pantagruelischen Mönchen, besessenen Sammlern und den Rolling Stones. Wir erfahren, welches Buch Marilyn Monroe verehrte, dass Napoleon bei jeder Schlacht Goethes Werther mit sich trug und natürlich auch von Martin Lathams Erlebnissen in seiner Buchhandlung in Canterbury.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
»Inspirierend und originell, gespickt mit liebenswerten Anekdoten«
David Mitchell
Ob Trost oder Erkenntnis, ob Reisen in andere Welten oder Analysen unserer Realität – Bücher bieten all das und noch viel mehr. Wir tragen sie überall mit uns herum und behalten die wichtigen Lektüren unseres Lebens für immer in unseren Herzen. Wir atmen den Geruch ihrer Seiten ein, kritzeln etwas hinein und schützen sie vor Bücherdieben und Badewasser. Dieser lebenslangen Liebe widmet sich der Buchhändler Martin Latham in diesem inspirierenden Buch. Er erzählt von Schmugglern, Bibliothekaren, pantagruelischen Mönchen, besessenen Sammlern und den Rolling Stones. Wir erfahren, welches Buch Marilyn Monroe verehrte, dass Napoleon bei jeder Schlacht Goethes Werther mit sich trug und natürlich auch von Martin Lathams Erlebnissen in seiner Buchhandlung in Canterbury.
© James Tucker
Martin Latham ist seit fünfunddreißig Jahren Buchhändler. Er ist promovierter Indologe und lehrte an der Universität von Hertfordshire, bevor er sich entschied, Buchhändler zu werden.
Silvia Morawetz übersetzte gemeinsam mit Theresia Übelhör für DuMont Das Mädchen mit dem Poesiealbum von Bart van Es (2019) sowie Die Kunst des Ausruhens von Claudia Hammond (2021).
Theresia Übelhör übersetzt aus dem Englischen und Französischen. Für DuMont hat sie u.a. die Übersetzung des Atlas unserer Zeit (2017) vorgelegt.
Martin Latham
Vom Glück zu lesen
Über Bücher, Schriftsteller und meine Buchhandlung in Canterbury
Aus dem Englischen vonSilvia Morawetz und Theresia Übelhör
Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel ›The Bookseller’s Tale‹ bei Particular Books, ein Imprint von Penguin Random House UK.
© Martin Latham 2020
eBook 2021
© 2021 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Silvia Morawetz, Theresia Übelhör
Lektorat: Kerstin Thorwarth
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7122-3
www.dumont-buchverlag.de
Vorwort
Es gibt ein Buch, das sich achthundert Jahre lang nicht einen Zentimeter von seinem Platz wegbewegt hat. Es ist Teil des Grabmals von Eleonore von Aquitanien in der Abtei Fontevraud, gut achtzig Kilometer von Poitiers entfernt. Die in Stein Gemeißelte, die ein wechselvolles Leben hinter sich hat, hält eine aufgeschlagene Bibel in den Händen. Sie sieht aus, als hätte sie sich hingelegt, wie wir alle es tun, wenn wir, das Gespräch beendet oder den Tee ausgetrunken, eins werden mit einem Buch und uns in einer privaten Welt verlieren. Das jahrtausendealte Liebesverhältnis zwischen Mensch und Buch wäre für einen Besucher aus einer anderen Galaxie sicherlich eine unserer eigentümlichsten Konstanten.
Diese Darstellung der Geschichte des Buchs geht unserer Beziehung zum Buch als physischem Objekt nach und untersucht seinen Anteil an der Vertiefung unseres Selbstverständnisses. Der Buchdruck trug zu einem weltumspannenden Erblühen des Bewusstseins bei. Zurückgezogen mit einem Buch entdecken wir noch heute verborgene Ichs.
Weiter verbreiten konnte sich private Lektüre allerdings erst im Zeitalter des Buchdrucks. In den meisten Sprachen bedeutete das Wort »lesen« zunächst »laut vortragen«. Die Diener Alexanders des Großen schauten verdutzt, als er still las, und bis zur Erfindung der Druckerpresse war das Vorgelesen-Bekommen geläufiger als stille Lektüre. Mit der neuen Privatheit ging eine stärkere emotionale Beteiligung einher, eine tiefere Gemütsbewegung. Harriet Martineau, die Pionierin der Soziologie, hatte bereits in viktorianischer Zeit häufig das Empfinden, zur Autorin des Buchs zu werden, das sie gerade las; Romane wie Clarissa von Samuel Richardson lösten sogar regelrechte Weinkrämpfe und ekstatische Erregung aus. Nach Gutenberg war unsere Fantasie süchtig nach Geschichten, berauschte sich an neuen Gefilden.
Die private Lektüre erschloss uns neue Dimensionen der Innerlichkeit. Wie wahr das ist, merken wir in den Magazinen einer großen Bibliothek oder in den Winkeln einer Buchhandlung – an Orten, die uns ein Gefühl von Immanenz vermitteln, an denen wir an der Schwelle zu unendlichen inneren Räumen zu stehen meinen. Die Bibliothek des antiken Alexandria hat womöglich nicht einmal existiert, doch laut der Altphilologin Edith Hall ist allein die Vorstellung von einer solchen Bibliothek für unsere kollektive Psyche fast ebenso wichtig wie ihre reale Existenz. Wir wissen instinktiv, dass wir unendlich und zugleich nur zufällig sind, und mögen es daher sehr, wenn wir durch Buchhandlungen und Bibliotheken streifen und auf Literatur stoßen, die uns Zugang zu verschiedenen bisher verborgenen Ichs verschafft.
Unsere leidenschaftliche Beziehung zu richtigen Büchern (nicht zum »Text« der Literaturtheoretiker) drückt sich auf vielerlei, nur selten dokumentierte physische Weise aus. Sie kann, wie Virginia Woolf festhielt, Züge eines fast sexuellen Wechselspiels annehmen. In den dreißig Jahren meiner Tätigkeit als Buchhändler habe ich Kundinnen und Kunden gesehen, die den Umschlag eines Buchs streichelten, unter den Schutzumschlag spähten, mehrfach die Augen schlossen und am hohlen Rücken schnupperten – manchmal begleitet von einem leisen, wohligen Seufzer –, die ihr Buch nach dem Kauf an die Brust drückten und sogar einen Kuss auf den Umschlag hauchten.
Buchnutzer können nicht begründen, warum sie Bücher so gern in der Hand halten, und nachdem ich sie – über die Jahre wohl einige Hundert Mal – ausführlich über diese Unmöglichkeit reden hörte, glaube ich allmählich, dass sie einem so intimen Erleben gar nicht auf den Grund gehen wollen.
Das Buch, aus Papier, also aus Bäumen hergestellt, ist schon der halbe Wald, die große Mythen-Quelle. Technische Geräte bestehen nicht nur aus kälteren Stoffen, sie stellen auch unerbittlich Forderungen. 1913 beschrieb Kafka in einem Brief an seine künftige Verlobte Felice, Angestellte einer Firma, die eine frühe Form von Diktiergeräten verkaufte, mit erstaunlicher Vorahnung ein Bild der Zukunft. Er verabscheute solche Geräte und stellte sich vor, während eines Diktats aus dem Bürofenster zu sehen und dann das Feilen der Fingernägel zu hören, mit dem seine Sekretärin insgeheim die Zeit vertrödelte. »Der Diktierende ist der Herr, aber vor dem Parlographen«, schrieb er Felice, »ist er entwürdigt und ein Fabrikarbeiter …« Heutzutage haben wir alle manchmal das Gefühl, Knechte unserer Maschinen zu sein; einem Buch gegenüber stellt sich dieses Gefühl aber nicht ein. Es werde damit enden, sagte Kafka voraus, dass die Apparate mit uns sprechen, uns Vorschläge für Restaurants unterbreiten, sogar unsere Aussprache korrigieren würden. Noch vor zehn Jahren, als ich mit diesem Buch begann, wären solche technischen Möglichkeiten uns grotesk vorgekommen – heute sind sie alltäglich. Die arme Felice antwortete nicht auf Franz’ verrückt klingenden Brief.
Die »kalte Technik« digitaler Geräte dient uns »Interaktivität« an, freilich eine, die nach vorgegebenen Regeln verläuft, angefangen vom »Liken« bis hin zum »Bloggen«, weit entfernt vom Interagieren vieler mit Büchern – »warmer Technik« –, etwa indem sie darin Notizen machen. Montaignes Marginalien in seiner Lukrez-Ausgabe bilden einen eigenen Gedankenstrang, nicht anders als Blakes hitzige Kritzeleien in Joshua Reynolds’ Discourses. Coleridges Randbemerkungen füllen einen ganzen Band seiner gesammelten Werke. Marginalien wurden von akademischen Bibliothekaren allerdings schon immer im Wortsinne marginalisiert, vor allem in der viktorianischen Epoche, als sie beim neuerlichen Binden von Büchern weggeschnitten und weggeworfen, teilweise sogar – dies widerfuhr Miltons Marginalien – ausgebleicht wurden. Das Erbe dieser Bentham’schen Hygiene ist die übermäßige Ablehnung, mit der wir heute auf handschriftliche Anmerkungen in Büchern reagieren. Ein auf Marginalien spezialisierter Historiker klagte kürzlich, wir verfügten, würden wir in dem Punkt nicht duldsamer, in Zukunft wohl nicht mehr über Zeugnisse unserer frischen, unvermittelten Reaktion auf Gelesenes.
Mit ähnlicher Pietätlosigkeit schnitten Buchnutzer zwischen 1600 und etwa 1870 einfach Lieblingspassagen aus ihren Büchern aus und klebten sie in Kollektaneenbücher, ergänzt durch niedergeschriebene eigene Gedanken. Dass diese Mode großteils undokumentiert blieb, liegt an der Auffassung von Bibliothekaren wie M.R.James, für den Kollektaneen nur eine Art »Rückstand oder Bodensatz« waren. Zudem sorgten solche Bücher bei den empiristisch gesinnten Bibliothekaren für Verwirrung, da sie sich als schwer einzuordnen erwiesen: Handelte es sich um Bücher oder um Manuskripte? Noch bis in die 1980er wurden sie waschkörbeweise aus den Beständen entfernt.
Mitreißende kurze Bücher, in Großbritannien als chapbooks, »Groschenromane«, bezeichnet, sind ein weiterer vergessener Teil der Buchgeschichte. Solche Schilderungen von Verbrechen, Mythen, paranormalen Ereignissen, Liebeleien, philosophischen und religiösen Anschauungen wurden weltweit millionenfach gedruckt, von Bibliothekaren jedoch als minderwertig betrachtet und bis vor Kurzem von der Wissenschaft ignoriert. Das ist seltsam, boten diese sich schnell verbreitenden Erzählungen doch vielen Titanen der Weltliteratur Nahrung. Pepys sammelte sie in rauen Mengen, Blake schrieb großartige Gedichte in dem Format, Dickens wurde damit entwöhnt, auch Stevenson schätzte sie so sehr, dass er selbst ein solches Werk verfasste (»Moralische Embleme«), und Shakespeares Sympathie für den nomadisierenden Schwadroneuer und Chapbook-Verkäufer Autolycus ist mit Händen zu greifen. Doch die Büchlein, häufig ohne festen Einband, führten eine Straßenexistenz, und die meisten sind verschollen.
Jacques Derrida hat den unheilvollen Einfluss beklagt, den ein im Wesentlichen männlicher Stab von Bibliothekaren auf die Aufbereitung unserer Kultur ausübt, und dafür den Begriff des »Patri-Archivs« geprägt. Mit dem Interesse dieses Autors an der Archäologie von Büchern, den Odysseen nomadisierender Bände, den in Tinte und Papier, in Wasserzeichen und Buchschnittmalerei verborgenen Geheimnissen, den Geschichten gepresster Blumen und handschriftlicher Widmungen können jene Bibliothekare nichts anfangen. Liebende reagieren empfindlich auf konkurrierende Reize, und Diktatoren wollen schlicht geliebt werden. Der ostdeutsche Staatschef Erich Honecker setzte vielfache Verfolgung ins Werk, klagte im Alter aber: »Haben die nicht gemerkt, wie sehr ich sie liebte?« Aus Eifersucht verbrennen Diktatoren eine Vielzahl von Büchern. Das Überleben der Untergrundliteratur ist eine Geschichte, die umfassend erst noch dargestellt werden muss, von den in Kreml-Büros heimlich angefertigten Fotokopien der Werke Solschenizyns bis zu den in Ostberlin versteckten Exemplaren von Farm der Tiere.
Dies ist die ungeschönte Darstellung unserer Liebesbeziehung zu Büchern, einer Beziehung, in deren Verlauf sich ein persönlicheres und reflektierteres Ich herausgebildet hat. Es ist die Geschichte einer Liebe zum physischen Buch, die sogar noch – vielleicht gerade – in der digitalen Epoche gedeiht.
Ich weiß nicht, wie ich lesen lernte. Ich entsinne mich nur meiner ersten Lectüre und wie sie auf mich wirkte; von dieser Zeit an beginnt mein ununterbrochenes Selbstbewußtsein.
(Rousseau, Bekenntnisse)
1.
Trostbücher
Die französische Schauspielerin Barbara Laage, lesend in ihrer Wohnung, 1946. Nina Leen/The LIFE Picture Collection via Getty Images.
Kindheitserinnerungen tauchen auf wie eine vom Wind plötzlich zugeschlagene Tür in einem entfernten Flügel eines alten Hauses.
(Richard Church – in irgendeinem Essay, den ich nicht mehr ermitteln kann)
[1] So könnte ein jeder von seinen Wegen, seinen Wegkreuzungen, seinen Bänken sprechen. Thoreau hat, wie er sagt, den Plan der Felder in seiner Seele eingezeichnet.
(Gaston Bachelard, Poetik des Raumes)
Erst in letzter Zeit habe ich meine Erziehung abgestreift und zu der frühen intuitiven Spontaneität zurückgefunden.
(Robert Graves, Strich drunter!)
Das Pförtchen in der Mauer
Um 2500 v.Chr. verglich ein Ägypter einmal das Finden der richtigen Lektüre mit dem Besteigen eines kleinen Bootes. Einige Trostbücher vermögen uns an einen besseren Ort zu tragen. Diese totemistischen Romane sind ein seltsamer Mischmasch aus »Kitsch« und »Klassik«.
Die Verlegerin und Biografin Jenny Uglow sprach bei einer Podiumsdiskussion in der New York Public Library einmal zu der Frage, welche Klassiker noch weithin gelesen werden. Während der Vorbereitung auf die Veranstaltung war sie in meinen Laden gekommen und hatte vom Computer einige überraschende Auskünfte erhalten. Von Pflichtlektüren und Literaturverfilmungen abgesehen, zeigte sich, dass Elizabeth Gaskell sich nach wie vor verkauft, auch Hemingway natürlich, von ihm aber nur wenige Werke. Middlemarch ist noch immer ein Bestseller, nicht jedoch Fielding. Anthony Powells Ein Tanz zur Musik der Zeit ist kulturell zwar enorm einflussreich, wird aber nur selten nachgefragt. Mit Olivia Mannings langatmiger Balkan-Trilogie und Lawrence Durells Alexandria-Quartett aus den späten 1950ern schreibt man hingegen auch heute noch keine roten Zahlen. Man würde meinen, nur die neueren Romane trieben den Buchhandel an und sorgten für schwarze Zahlen, aber sowohl Robinson Crusoe (1719) als auch Voltaires Candide (1759) werden regelmäßig eher aus Liebhaberei denn als Pflichtlektüre gekauft. Smollet wiederum wird, ebenso wie Boswells Dr.Samuel Johnson, aus liebevollem Respekt und weniger aus kommerzieller Notwendigkeit auf Lager gehalten und Jahr für Jahr in kleiner Stückzahl abgesetzt. Im Verlauf von dreißig Jahren wurde ich kein einziges Mal nach John Bunyans Die Pilgerreise gefragt. Chestertons Der Mann, der Donnerstag war ist dagegen einer von mehreren Dauerbrennern, die ein Mund-zu-Mund-Phänomen sind. Die den meisten Buchhändlern bekannte Liste der geschätzten und finanziell einträglichen Bücher (auf der sich viel Science-Fiction- und Kinderliteratur befindet) deckt sich nur teilweise mit dem »klassischen Kanon« der akademischen Welt – und warum sollte sie auch? Um nur einige der aufgeführten Werke zu nennen: Der Wolkenatlas, Gegen den Strich, Watchman, Spiel im Sommer, Der Fänger im Roggen, Tristram Shandy, Die Weite Sargassosee, Wer die Nachtigall stört, der Erdsee-Zyklus, Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter, Der Herr der Ringe, Pratchetts Scheibenwelt-Romane, Träumen Androiden von elektrischen Schafen?, Anne auf Green Gables, die Harry-Potter-Bücher, Milos ganz und gar unmögliche Reise, Der kleine Prinz, Der Alchimist, die Reihe um die fiktive Figur Reginald Jeeves, Cold Comfort Farm.
Wer solche Bücher mag, fragt sich ab und zu, ob er oder sie vielleicht lieber etwas Substanzielleres lesen sollte. Die Romanautorin A.S.Byatt war ein früher Fan von Terry Pratchett, schon zu einer Zeit, als Science-Fiction- und Fantasy-Literatur kaum in den Feuilletons großer Zeitungen Erwähnung fand. Als sie 1990 in meiner Buchhandlung in Canterbury aufgeregt den neuen Scheibenwelt-Roman kaufte, sagte sie scherzhaft: »Ich mag die Scheibenwelt sehr, darf mich aber nicht dabei erwischen lassen, sie in London zu kaufen.« Dieser Zustand ist ein Nebenprodukt des modernen Bildungsbetriebs: Chaucer, Shakespeare und Dickens erfreuten sich eines unbefangenen Eklektizismus. Die viktorianische Oberschicht liebte die Geschichte des heldenhaften Dr.Brydon, der als Einziger den Rückzug aus Kabul im Jahre 1842 überlebte und auf seinem Pferd in sichere Gefilde ritt, nachdem die Bibel unter seinem Hut den schweren Hieb eines afghanischen Schwerts gedämpft hatte. Als Greis auf seinem Landsitz in den Highlands entzauberte er den Mythos (den nicht er in die Welt gesetzt hatte): Es sei keine Bibel gewesen, die ihm das Leben gerettet habe, sondern eine Ausgabe des Blackwood’s Magazine, einer populären Fundgrube für Abenteuer- und Gruselgeschichten.
Trost ist ein so wichtiger Antrieb fürs Lesen, dass wir ihn uns bewahren müssen, wenn wir nicht wie Professor Deidre Lynchs Studenten in Harvard enden wollen. Sie bemerkt
den häufigen Unterton von Wehmut in den Klagen der … Anglistikstudenten darüber …, dass die Lehrinhalte zu Kritik und Theorie, die sie durchackern müssen, die Liebe zu bestimmten Autoren und zum Lesen ersticken, um derentwillen sie das Studium eigentlich aufgenommen haben.
Die Entdeckung eines Trostbuchs ist oft ein unvergessliches Erlebnis, vergleichbar dem Sichverlieben. Mit Anfang zwanzig radelte ich einige Jahre lang zur Tite Street in Chelsea und schloss mein Studentenfahrrad ohne Gangschaltung am Geländer eines zu Beginn des 20.Jahrhunderts gebauten Mietshauses an. Bücher und Literatur lagen hier in der Luft: Radclyffe Hall und Oscar Wilde hatten ein paar Türen weiter gewohnt. Ich fuhr mit dem historischen Fahrstuhl in den obersten Stock und sah, als ich langsam schwebend oben ankam, durch das Türgitter auf dem Flur als Erstes zwei Füße in abgetragenen handgefertigten Lederschuhen von Tricker’s in der Jermyn Street. Meine Besuche bei dem Schriftsteller und Reisenden Wilfred Thesiger waren ausgedehnte Unterhaltungen, die oft erst in den frühen Morgenstunden endeten, wenn draußen auf der Themse die Lichter der Albert Bridge glitzerten.
Thesiger galt als der letzte viktorianische Forschungsreisende; wegen seiner Abneigung gegen Verbrennungsmotoren und seines Respekts für indigene Weltbilder haben jüngere Autoren wie Levison Wood und Rory Stewart ihm jedoch ein neues Etikett angeheftet: erster Hippie. Der Name Thesiger wird zwar immer mit seiner Freundschaft zu den Beduinen und seiner Durchquerung des »leeren Viertels« von Arabien, der Wüste Rub al-Chali, verbunden sein, er war jedoch auch ein begeisterter Bücherliebhaber, und wir sprachen oft über Literatur. Ich hatte hier einen Mann vor mir, der die Subskribenten-Ausgabe der Sieben Säulen der Weisheit besaß, mit Buchdeckeln, gefertigt aus Stücken der Holzpropeller eines 1915 über dem Hedschas abgestürzten türkischen Flugzeugs – eine Rarität, von der anscheinend keiner der von mir befragten Buchhändler jemals gehört hat.
In seiner winzigen, ebenmäßigen Handschrift schrieb Thesiger seine sechs Allzeit-Trostbücher auf eine Karteikarte. Wiedersehen mit Brideshead stand darauf – von dem Buch hörte ich zum ersten Mal –, ergänzt allerdings um eine ihm wichtige Zusatzbemerkung: Evelyn Waugh, den er in Abessinien gut gekannt hatte, sei ein »absolut scheußlicher Mensch«, den er nie mit einem so großartigen Buch in Verbindung habe bringen können. Auf Thesiger, der für seine Tapferkeit im Kampf gegen die Einheiten Mussolinis in Abessinien ausgezeichnet wurde und später im Special Air Service diente, machte es erst recht keinen Eindruck, dass Waugh, während er als Korrespondent über die italienische Invasion in Ostafrika berichtete, stets mit einem großen Schlapphut auf dem Kopf durch die Gegend lief. »Dieser dämliche Huuut«, sagte er kopfschüttelnd, aber mit dem Anflug eines Lächelns bei der Erinnerung daran.
Heute, als Buchhändler – der ich damals noch nicht war, bloß ein eifriger Doktorand in Geschichtswissenschaft –, weiß ich, dass Brideshead ein Trostbuch für Menschen jeden Alters und Geschlechts ist. Dass Waughs Schilderung des aristokratischen Lebens allwöchentlich über den Ladentisch geht, verdankt sie der berauschenden Prosa und, so sehe ich es jedenfalls, der Art, wie sie uns etwas unbegreiflich Schönes nahebringt, das unerreichbar bleibt.
Vor Kurzem kam eine junge Frau in meinen Laden und sagte: »Ich habe gerade Wiedersehen mit Brideshead noch mal gelesen. Es war so … anders, es hat mich umgehauen, und ich brauche jetzt etwas, das da mithalten kann, wissen Sie, etwas, das einen wirklich packt.«
Keine leichte Aufgabe, bei der man jedoch zum Kern des Lesevergnügens vorstößt: Es gibt Bücher, deren Lektüre man mit einem gewissen Pflichtgefühl in Angriff nimmt, und es gibt andere, für die man morgens zeitiger aufsteht und die man gegen Ende langsamer liest, um so den Abschied hinauszuzögern. Dieser Kundin wäre weder mit Dostojewski noch mit Dickens gedient gewesen. Nabokovs eigentümliches Ziel beim Schreiben hätte sie aber verstanden. In einem körnigen Fernsehinterview aus den Fünfzigern sagte er – so schnell sprechend, dass ich den Ausschnitt mehrere Male abspielen musste, um jedes Wort zu verstehen –, er schreibe nicht, um Herzen zu bewegen oder Denkweisen zu ändern, sondern um »dem Rückgrat des versierten Lesers einen Schluchzer zu entlocken«. Hier war also eine unmittelbar wirkende, unverdünnte Dosis gefordert. Ich ließ im Geiste einige meiner eigenen Totem-Bücher Revue passieren: Crash von J.G.Ballard zum Beispiel. Ungeeignet – mein Plädoyer dafür löste in Fulham einmal eine Kneipenschlägerei aus (ich war nicht beteiligt). Wir legten ihr Exemplare von Spiel im Sommer, Wer die Nachtigall stört, Ein Drama auf der Jagd und Frankenstein vor. Zu einem späteren Zeitpunkt hörte ich, dass ihr, wie so oft, das erste Buch, das von Dodie Smith, sehr viel Freude bereitet habe und dass sie sich gefragt habe, warum es nicht besser bekannt sei.
Ein anderes Werk auf Thesigers Liste war Upon That Mountain (1943) von Eric Shipton. Jahrelang sprach Thesiger davon, dass ihm dieses Buch vor längerer Zeit abhandengekommen sei und er kein neues Exemplar finde. Im Nachhinein dämmert mir, dass er das Buch gar nicht wieder auftreiben wollte. Es war für ihn ein obskures Objekt der Begierde und repräsentierte – um das Meisterwerk seines Freundes mit dem bizarren Hut zu zitieren –
das niedrige Pförtchen in der Mauer …, das, wie ich wußte, andere vor mir gefunden hatten – es führte zu einem geschlossenen verzauberten Garten, der von keinem Fenster sichtbar … lag.
Nicht »sichtbar« zu sein, ist das A und O der starken Wirkung eines Trostbuchs. Es ist etwas ganz Persönliches, selten ein Gewinner von Literaturpreisen oder ein aktueller Bestseller, eine private Entdeckung, epiphanisch, etwas, das in einer bis dato noch nicht durchmessenen inneren Wüste eine in Zeitlupe stattfindende Explosion auslöst.
Manche finden in ihrem Trostbuch die Schönheit des Verlorenen: In Upon That Mountain geht es einzig um Erfüllung, die einem auf herrliche Weise versagt bleibt. Thesiger sprach häufig über den Nanda Devi im Himalaya, den »Witwenmacher«, der alle Versuche, sich ihm zu nähern, zurückweise; Shiptons Buch handelt vom fehlgeschlagenen Versuch, diesen Berg zu besteigen, was vielleicht erklärt, warum das Werk kein größeres Publikum erreichte: Es ist keine Chronik eines »Gipfelstürmers«.
In diesem Jahr, siebzehn Jahre nach Thesigers Tod, entdeckte ich eine Taschenbuchausgabe von Upon That Mountain, 1956 bei Pan erschienen, in einem Secondhandladen; sie steht nun neben meinem signierten Exemplar von Thesigers Brunnen der Wüste.
Bis jetzt ist mir noch jeder ausgewichen, bei dem ich mich nach dem besonderen Reiz seines Trostbuchs erkundigte, sodass ich mir direkte Fragen danach inzwischen verkneife. Wie gefangen genommene Spione in Kriegszeiten, die nur Namen, Rang und Dienstnummer angeben, nennen die Angesprochenen einen Titel, einen Autor und eventuell das Buchformat, Taschenbuch oder gebundene Ausgabe. Dann wechseln sie das Thema, wollen nichts preisgeben von ihrem zauberischen Hinterland. Sie schützen ihr Refugium in den Bergen, denn ein Trostbuch, so viel ist sicher, ist privates Terrain. Sich darüber auszulassen, wäre so abwegig wie ein Hubschrauberflug zum Gipfel des Nanda Devi.
Wenn wir heranwachsen, verbirgt sich ein Teil unserer Vorstellungskraft unter unserem steuernden Ich und kommt gewissermaßen erst in Zeiten der Liebe und des Todes wieder zum Vorschein, wenn wir in der Natur sind oder uns zum Lesen zurückziehen. Shiptons Buch beginnt so:
Jedes Kind wird vermutlich einen Großteil seiner Zeit von Bäumen oder Motoren träumen oder vom Meer … Manchmal sind diese Sehnsüchte verschüttet, manchmal aber ist noch so viel davon vorhanden, dass sie unseren Lebensweg entscheidend beeinflussen.
»Unseren Lebensweg entscheidend beeinflussen«: Das Trostbuch sorgt dafür, diesen Einfluss lebendig zu halten. Kein Wunder, dass Menschen bei dem Thema dichtmachen: Mit meinen Fragen mische ich mich schließlich in den Gedankenstrom ihrer Kindheit ein – eine heikle Angelegenheit. Als Kinder wissen wir noch nichts von der Selbstkontrolle, die diesen Gedankenstrom eines Tages eintrüben wird. Wir wachsen mit einer Fantasiewelt auf, die so reich ist wie Tausendundeine Nacht, und nehmen sie als gegeben hin.
Ich bin eines von acht Kindern, und Sarah, mein jüngstes Geschwister, hatte als Kind ein Trostbuch, über das sie nie ein Wort verlor, bevor ich sie danach fragte. The Children of the Old House handelt von einer großen Familie, die sich in ihrem heruntergekommenen Haus mit wenig zu behelfen weiß und alle Schwierigkeiten meistert. In genau so einem Haus ist Sarah aufgewachsen, und ihre berufliche Laufbahn als Kinderkrankenschwester begann im Great Ormond Street Hospital. Ich habe immer wieder erlebt, dass die Trostbücher der Kindheit in einem fast komischen, von den betreffenden Personen selbst oft gar nicht wahrgenommenen Ausmaß auf den Lebensweg hindeuteten, den sie später als Erwachsene einschlagen sollten.
Während ich diese Passage heute Vormittag in einem Café in Canterbury schrieb, kam ein junges Pärchen mit Rucksäcken und Wanderstöcken herein. Wir kamen ins Gespräch, und ich erkundigte mich nach den Trostbüchern ihrer Kindheit. Beide waren einundzwanzig, sie wanderten ohne festgelegte Reiseroute von Bordeaux nach Irland und zelteten im Freien. Der gut aussehende junge Mann, Zakaria Fassi, hatte sich mit der Lektüre von Un homme, ça ne pleure pas seiner Landsmännin, der Franko-Algerierin Faïza Guène, erfolgreich gegen seinen dominanten Vater zur Wehr gesetzt. Seiner Freundin Lelia Galin, Tochter eines Lastkraftfahrers, die sich den Kopf kahl geschoren hatte, verhalf die Lektüre eines wenig bekannten Märchens, in dem ein Ungeheuer durch Liebe gezähmt wird, zu einem besseren Verständnis des »Wahnsinns«, den sie als Kind in ihrer Familie erlebt hatte. Beide sprachen nur leise von ihren Büchern, wie Gläubige, und sagten, sie hätten noch nie jemandem davon erzählt. Die Bücher vermittelten einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt und erklärten die große Bedeutung ihres Ausbruchs besser als alles unverbindliche Geplauder.
Im Zug von London nach Canterbury unterhielt ich mich kürzlich mit Sam, einer Anwältin auf der Rückfahrt von einem Mordprozess im Old Bailey, dem Zentralen Strafgerichtshof.
Ich: »Was war Ihr Trostbuch in der Kindheit?«
Sam: »Oh, ich mochte die Peter-and-Jane-Lesebücher und Dickens’ Eine Geschichte aus zwei Städten, Victor Hugos Die Elenden und …«
Ich (ihr ins Wort fallend, weil mir ihre Worte doch arg altklug vorkamen): »Moment mal – ich meine, welches Buch hat Ihnen als Kind wirklich etwas bedeutet?«
Sam: »Oh, eins habe ich richtig geliebt, eine kleine gebundene Ausgabe von ›Aschenputtel‹.«
Aschenputtel, dachte ich, unterdrückt von zwei Stiefschwestern und einer bösen Stiefmutter, drei bedrohlichen Kräften – das passende Märchen für ein Leben wie das von Sam, die blitzschnell die oberen Ränge des britischen Justizwesens erstürmt hatte, und das als in Trinidad geborenes Arbeiterkind und Frau. Und obwohl Aschenputtel eine Weiße ist und der Prinz ein Schwachkopf, hatte Sam das Märchen als Befreiungsgeschichte gelesen.
Dieselbe Wirkung hatte auch das Exemplar von The Little Engine That Could, das, voller Bleistiftgekritzel aus Kinderhand und stark abgegriffen, vor einigen Jahren in New York auf einer Auktion zur Versteigerung kam: Das Buch hatte Marilyn Monroe gehört.
Im Alter von elf Jahren war mein Trostbuch The Time Garden, und es bedeutet mir so viel, dass ich nie jemandem davon erzählt oder darüber nachgedacht habe, warum es mir so lieb ist. Wie Thesiger mit seinem Upon That Mountain wollte auch ich nie, nicht einmal für eine Sekunde, ein neues Exemplar zum Wiederlesen haben. Das Buch handelt von einem Jungen, der auf dem sonnenbeschienenen Weg im Garten hinter dem Haus einer Kreuzkröte begegnet, die ihm die Fähigkeit verleiht, durch die Zeit zu reisen. Das ist auch die Kurzfassung all meiner jugendlichen Sehnsüchte: Geheimnisse, Natur, versteckte Gärten, Tiere, die mehr wissen, als sie preisgeben, und Reisen durch die Geschichte.
Ein paar Jahre später, in den Stürmen der Pubertät, tauchte mit The Silver Sword – ein bis heute weithin gelesenes Buch – ein neues Schutzamulett auf. Es erzählt eine im Zweiten Weltkrieg angesiedelte Geschichte über einen Lehrer, dessen Haus im Warschauer Ghetto bei einem Bombenangriff zerstört wird. Er begegnet einem obdachlosen Jungen, der seine persönlichen Schätze – darunter aus irgendeinem Grund ein kleines silbernes Schwert – in einem Schuhkarton aufbewahrt. Als ich nach dem Buch suchte, dachte ich fälschlicherweise, der Titel lautete The Sword in the Stone. Heute weiß ich, dass die Schrecken der Oberschule das symbolische Haus meiner Zauberwelt zum Einsturz brachten, ich mir jedoch mit ein paar totemistischen Objekten in einem metaphorischen Schuhkarton etwas davon bewahren konnte. Das kleine Schwert besaß noch immer Artus-Potenzial, auch wenn in der Schuhschachtel in Wahrheit bloß der Brieföffner der Ehefrau des Lehrers liegt, die bei dem Bombenangriff ums Leben kam. Die magische Kraft des Buchs ist nach wie vor wirksam – bei meinen erwachsenen Kindern (»Dieses Schwert-Buch hab ich geliebt«, sagte Oliver; »Ich wollte dieses Schwert unbedingt!«, sagte India) und bei der Kundschaft.
Irgendwo habe ich von einer jungen Engländerin gelesen, deren psychische Eigenheiten sich unter keinem derzeitigen Etikett für »Störungen« wie etwa ADHS rubrizieren ließen: intelligent, aber ständig von irgendetwas abgelenkt, von irgendeinem Bedürfnis. Kein Arzt konnte das Problem lösen, bis sie einem Spezialisten in London vorgestellt wurde. Er kam verspätet in die Praxis und sah sie im Wartezimmer sitzen, wo sie unablässig mit den Füßen auf den Boden tippte. Als sie ins Sprechzimmer kam, sagte er: »Sie ist Tänzerin, das ist alles« – und tatsächlich wurde sie Primaballerina im Opernhaus in Covent Garden. Was sie als Kind wohl gelesen haben mag?
Kinderträume steigen beim Lesen an die Oberfläche und überdauern die Kindheit. Wenn der französische Philosoph Gaston Bachelard sagt: »Welches Privileg der Tiefe gibt es in Kinderträumereien! Glücklich das Kind, das seine einsamen Stunden besessen hat, wirklich besessen! Es ist gut, … daß es die Dialektik … der reinen Langeweile kennt«, rennt er bei uns zwar offene Türen ein, wir können es ihm aber nachfühlen, wenn er ausruft: »Speicher meiner Langeweile, wie oft habe ich mich nach dir zurückgesehnt, wenn das vielfältige Leben mich um den eigentlichen Keim aller Freiheit betrog.« Und wir schließen uns ihm auch an, wenn er optimistisch betont, dass man im »Reich der absoluten Imagination … sehr spät jung« werde.
Mit Trostbüchern stehen wir »das Grauen des Lebens«, wie Nietzsche es nannte, besser durch. Für Montaigne in seiner Turmbibliothek waren Lieblingsbücher »die beste Munition für die menschliche Lebensreise«. Manchmal tragen wir sie mit uns herum wie Amulette. Alexander der Große hatte seinen Homer auf den Feldzügen mit im Gepäck – ein Buch voller Nostalgie (ein Wort, das seinem ursprünglichen Sinne nach »Heimweh« bedeutet).
So mancher Streiter kämpfte mit seinem Lieblingsbuch gegen die Schrecken des Krieges. Napoleon führte bei seinen Feldzügen Goethes Leiden des jungen Werther mit, eine interessante Wahl, handelt es doch bekanntermaßen von einer existenziellen Krise, die in den Selbstmord mündet. Vielleicht benötigte Napoleon den Gedanken an Selbstmord als Gegengewicht zur imperialen Hybris, ähnlich den römischen Kaisern, hinter denen bei der Siegesparade im Triumphwagen ein Knabe stand, der »Aller Ruhm ist vergänglich« flüsterte. (Schwer vorstellbar, dass dieser Junge nicht unglaublich lästig war.)
Welch enorme Bedeutung sein zerlesenes Exemplar von Thomas Grays »Elegie geschrieben auf einem Dorfkirchhofe« für General James Wolfe hatte, der in Kanada gegen die Franzosen kämpfte – abgesehen davon, dass es ihn an England erinnerte –, wird an jenem Vers deutlich, den er doppelt unterstrich: »Der Pfad der Ehre führet nur ins Grab.« Er wurde in Quebec getötet, im Alter von zweiunddreißig Jahren. Im Ersten Weltkrieg las Lawrence von Arabien auf langen Kamelritten durch die Wüste die Komödien von Aristophanes in altgriechischer Sprache, die ihn an die Absurdität des Lebens erinnern sollten. Eine ähnlich kriegsneutralisierende Funktion hatte das geliebte Goethe-Buch in der Tasche des aus Glasgow stammenden Zimmermanns James Murray, der in den Schützengräben von Flandern kämpfte. Die Liebe zu einem Buch in der Schlacht mit anderen zu teilen, ist schwer vorstellbar, doch Captain Ferguson beteuerte Walter Scott, er habe in den bittersten Tagen des Krieges gegen Napoleon in Spanien den an der Kampflinie wartenden Soldaten Scotts episches Gedicht »Die Jungfrau vom See« vorgelesen: »Am liebsten hörten die rauen Söhne der Dritten Division den Gesang über die Hirschjagd.«
Eine überzeugendere Reaktion von der Front berichtete der Romancier Stendhal, der als Soldat an Napoleons verheerendem Rückzug aus Russland teilnahm: Er fand Trost in einer in rotes Leder gebundenen Ausgabe der Satiren Voltaires, die er aus einem brennenden Haus in Moskau gerettet hatte. Stendhal bemühte sich zwar, beim Lesen am Lagerfeuer nicht aufzufallen, wurde aber von seinen Kameraden verhöhnt, denen diese Szenerie zu stümperhaft erschien. Stendhal ließ den Band im Schnee zurück.
Ein angenehm pazifistischer Leser war William Harvey, der Entdecker des Blutkreislaufs, der sich während der Schlacht von Edgehill mit zwei Jungen unter einer Hecke verkroch und ihnen vorlas, bis, wie John Aubrey es uns in seinen Lebensentwürfen (ca. 1680) berichtet, »unweit von ihnen die Kugel aus einer großen Kanone in den Boden schlug, was ihn zu einem Stellungswechsel veranlasste«.
Woher kommt das Trostbuch? Häufig stammt es aus unerwarteter Quelle, und gerade die Merkwürdigkeit seines Eintreffens verleiht ihm sein mana, um einen unübersetzbaren polynesischen Ausdruck für die Ausstrahlung zu verwenden, die von einem Gegenstand ausgehen kann. (Patrick Leigh Fermor verwendete das Wort für sein grün gebundenes Reisetagebuch.) Wir sind nicht alle in der glücklichen Lage eines Alexanders des Großen, dem als Tutor Aristoteles zur Seite stand, der Homer empfahl. Schon eher sind wir in einer Bibliothek oder Buchhandlung über unser liebstes Kinderbuch gestolpert. Anne Mozley, Herausgeberin einer Zeitschrift für Kinder, notierte 1870, das Buch, das »zum Ereignis in der inneren Geschichte [des Kindes] wird, kann nicht von Lehrern an es herangetragen werden: Ein Buch, das so eine Wirkung auslöst, kommt per Zufall« – wie etwa das alte Exemplar des Verlorenen Paradieses, das der titelgebende Protagonist in Mary Wards Buch The History of David Grieve von 1892 in einer Mehltruhe findet: »Er verschlang es den ganzen Vormittag über, in einem versteckten Winkel des Schafstalls liegend, und die dahinströmenden Verse prägten sich ihm ein wie durch Zauberei.«
Empfehlungen können nützlich sein, aber eigentlich sehnen wir uns nach zufälliger Entdeckung, nach dem Buch, dessen Fund an sich bereits großartig ist. Der Autor von Moby-Dick sinnierte, die besten Bücher seien »diejenigen, die uns offenbar von der Vorsehung in die Hand gespielt werden, die wenig ansprechenden, die eine Fülle enthalten«. Dorothy Wordsworth hätte dem zugestimmt, als sie eines Tages, an dem es draußen stürmte, in die Stube eines Gasthauses im Lake District hinunterkam, in der ein behagliches Feuer brannte. Ihr Bruder William
strebte bald der kleinen Bibliothek zu, die in einer Fensterecke aufgebaut war. Er zog Enfields Speaker & einen alten Band von Congreve heraus. Wir tranken Rumpunsch – es war vergnüglich.
Steht man unter feindlicher Beobachtung, kann ein Buch noch elektrisierender sein. Der populäre königstreue Dichter Abraham Cowley fand als Kind unter den Büchern seiner Mutter eine Ausgabe von Edmund Spensers Faerie Queene und fasste den »unwiderruflichen« Beschluss, Dichter zu werden. Die Kindheit des viktorianischen Schriftstellers Augustus Hare kreiste eine Weile um die frisch gelieferten Teile des Fortsetzungsromans Die Pickwickier von Charles Dickens, die er aus dem Papierkorb seiner Großmutter zog. Edmund Gosse hingegen, der ebenfalls im viktorianischen Zeitalter aufwuchs, entwickelte eine fetischistische Neugier in Bezug auf eine Hutschachtel in der teppichlosen Abstellkammer. Eines Tages öffnete er die Schachtel, ohne um Erlaubnis gebeten zu haben, und sie war: leer! – bis auf das Futter, das aus Seiten eines sensationellen Romans bestand. Den las er, »auf dem blanken Boden kniend, mit unbeschreiblicher Wonne und der köstlichen Furcht, meine Mutter könnte mitten in einem der aufregendsten Sätze zurückkommen«.
Warum bereitet es Kindern so viel Freude, im Dunkeln mit der Taschenlampe unter der Bettdecke zu lesen? Vor Kurzem erfuhr ich, dass jedes meiner fünf Kinder das nächstjüngere in die Methode eingeweiht hat wie in eine Überlebenshilfe. Bereits in früheren Zeiten, vor der Erfindung der Taschenlampe, war das Lesen in der Dunkelheit romantisch: Conan Doyle las Scotts historische Romane »bei Kerzenlicht bis in die tiefste Nacht hinein« und erinnerte sich später sehr genau daran, dass »das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, der Geschichte zusätzlich Würze verlieh«.
Die Kunst der unaufdringlichen Empfehlung
In bestimmten innigen Freundschaften ist es möglich, sich über Trostbücher auszutauschen, doch es ist so heikel wie das Kitzeln von Forellen oder das Veredeln von Orchideen. Will man jemandem etwas ans Herz legen, was einem selbst am Herzen liegt, ist eine gewisse Beiläufigkeit à la »Kannst du dir anschauen, musst du aber nicht« gefragt. Eine zu enthusiastische Empfehlung bürdet dem Freund eine Last auf: Er muss in dem Buch unbedingt etwas Lebensveränderndes oder zutiefst Beeindruckendes finden, sonst wären die Freunde wohl nicht so tief verbunden oder hätten nicht genug Interesse an der Freundschaft selbst. Dann läge das verliehene Trostbuch bloß irgendwo herum – das haben wir alle schon erlebt – und sendete stumme Signale schlechten Gewissens aus.
Henry Miller, der Autor des Sex und der Bohème, schrieb über dieses Thema. Er erinnerte sich an einen guten Freund, der ihn mit exakt dosierter Unaufdringlichkeit zu Hermann Hesses Siddhartha lockte.
Jemand gab mir das Buch in die Hand und wandte dabei jenen Kniff an …: er sagte fast nichts über das Buch, außer daß es ein Buch für mich sei. In diesem Falle war das völlig genug … Es trat genau zum richtigen Augenblick in mein Leben ein und hatte genau die gewünschte Wirkung.
Dieses Buch hat das Leben vieler verändert. In den Siebzigerjahren hat es zahlreichen jungen Leuten geholfen, sich dem erbarmungslosen Konkurrenzkampf zu entziehen und mehr Zeit auf Reisen zu verbringen. Auch ich gehörte zu diesen Leuten: Ich bekam einen Job in einer Buchhandlung und bin oft mit kleinem Budget umhergereist. 1975, daran erinnere ich mich noch gut, saß ich in einer Comet der Sudan Airways über dem oberen Nil neben einem stocksteifen Berliner, einem Vertreter der Art Mann, die eine Unterhaltung zu führen überflüssig findet. Ich wiederum bin ein Mann mit schwacher Persönlichkeit und fühle mich gedrängt, das Schweigen mit solchen Leuten auszufüllen, wie ein Vogel, der sich vergeblich gegen eine Fensterscheibe wirft. Ich probierte gedanklich durch, wie ich an das Deutsche anknüpfen könnte; ich kannte das Land allerdings nur aus Luftaufnahmen, weil ich den Film Mai 1943 – Die Zerstörung der Talsperren gesehen hatte, kaum geeignet für den unverbindlichen Einstieg in ein Gespräch. In dem Moment fiel mir Siddhartha ein, und schon legte ich los: »Ja, in Großbritannien wird das gerade massenhaft von jungen Leuten gelesen; es verändert tatsächlich unsere Perspektive«, sprudelte ich heraus. Langsam hob er den Blick von der Gebrauchsanweisung für den Brechbeutel zur Sicherheitsgurt-Warnleuchte, sagte bloß: »Kann ich mir vorstellen«, und griff nach seiner einen Monat alten Welt.
Hätte der Mann vierzig Jahre später neben Paulo Coelho – Nummer drei auf der Weltbestsellerliste und Autor des Romans Der Alchimist – gesessen, hätte der ihm den anhaltenden Hype um Siddhartha viel besser erklären können als ich. In seinem Vorwort zu einer kürzlich erschienenen Neuausgabe schreibt er: »Hesse spürte … schon Jahrzehnte vor meiner Generation … die Notwendigkeit, das einzufordern, was uns wahrhaft und rechtmäßig gehört: unser eigenes Leben.« Der Alchimist ist das Nachfolge-Trostbuch von Siddhartha; kürzlich traf ich eine Kundin, die es sechs Mal gelesen hat. Sie wusste, dass sie es auch noch weitere Male lesen würde, sobald in ihrem Leben etwas schiefgehen sollte.
Die Kundschaft, die in meinem Laden Siddhartha kauft, strahlt meist etwas Besonnen-Zielstrebiges aus: Diese Menschen haben gehört, dass auf bestimmte Weise darüber gesprochen wurde, vielleicht so, wie man einem Außerirdischen frühe Bob-Dylan-Songs beschreiben würde; manchmal kaufen sie es auch mit einem Schimmer von Hoffnung für einen Liebespartner.
Miller selbst war weniger erfolgreich bei der Nachahmung der Strategie, die ihn zu Siddhartha geführt hatte, als er Freunden sein eigenes Trostbuch nahebringen wollte, das obskure Seraphita von Balzac. Keiner biss an, nicht einmal, als er ihnen von dem Studenten erzählte, der Balzac auf der Straße ansprach und um die Erlaubnis bat, ihm die Hand küssen zu dürfen – ein Vorfall, der den Anstoß für diese wegweisende Feier der Androgynität lieferte. Miller war bei der Empfehlung seines Trostbuchs schlicht zu enthusiastisch. In seiner Gesprächs-Autobiografie geht er dann nicht so weit, seinen Lesern Siddhartha ans Herz zu legen, denn er ist sich »bewußt, daß weniger mehr sagt«.
Bei Büchern, die eine große Bedeutung für die »innere Geschichte« eines Menschen haben, sind Empfehlungen tatsächlich eine hohe Kunst. Nicht die Wortwahl gebe den Ausschlag, betont Miller, es sei vielmehr »die Aura, die die Worte umgibt«, die den Zuhörer auf ein echtes Trostbuch aufmerksam werden lasse. Man solle, sagt er, auf die »untergründigen Schwingungen« achten. Er selbst löst diese Schwingungen wohl ebenfalls aus, wenn er ein Kapitel mit dem Hinweis auf The Round von Eduardo Santiago beendet – womit nicht der Surfer auf der Welle des Insta-Ruhms gemeint ist und auch nicht der berüchtigte Mörder, der auf den elektrischen Stuhl kam, sondern ein unbekannter kubanischer Okkultist, zu dem nicht einmal das Internet Auskünfte liefert. Wenn Miller schreibt: »Ich bezweifle, dass sich hundert Menschen auf der Welt für dieses Buch interessieren würden«, ist das ein ganz deutlicher Fingerzeig. Wenn ein Trostbuch extravagant und nur schwer aufzutreiben ist, wirkt es umso verführerischer.
In meiner unabhängigen Buchhandlung hatte ich einmal einen Angestellten, einen sehr introvertierten Kollegen, den ich im Stillen um seinen literarischen Geschmack beneidete. Damit konnte ich nicht mithalten. Einmal hob er kurz die Augen vom Katalog eines unbedeutenden amerikanischen Universitätsverlags – zu meinem Ärger und Neid vertiefte er sich über Stunden darin – und brummelte in seinem starken kumbrischen Dialekt begeistert vor sich hin: »Aaaah, Der Schacht – endlich wieder neu aufgelegt.«
Ich musste fragen: »Könnten Sie gewöhnliche Sterbliche bitte mal aufklären, George?«
»Klar, Martin, ich verrat es Ihnen, wenn Sie diesen blöden Mist ausstellen.« In den Achtzigern ließ ich im Laden oft Weltmusik laufen. »Was ist das überhaupt für eine CD? Sagen Sie’s mir nicht – noch ein Mozart auf der Nasenflöte?«
Beleidigt verteidigte ich die burundische Kalebassen-und-Zither-Combo als Subsahara-Sensation, er hörte mir aber nicht zu. Ich stellte die Musik aus.
»Onetti?«, sagte er mit erhobener rechter Braue, spock-artig.
Den Namen Onetti hatte ich noch nie gehört. George vertiefte sich empört wieder in seine Katalog-Anstreichungen und murmelte: »Als Nächstes sagen Sie noch, vom Premio Cervantes hätten Sie ja noch nie gehört.«
Hatte ich auch nicht, klar, und mit dieser Unwissenheit war ich als unzulänglicher Ladenbesitzer und Mensch bis auf die Knochen blamiert. Ich fragte: »Okay, was zum Teufel ist das?«
George: »Ach, bloß der wichtigste Literaturpreis für die am zweithäufigsten gesprochene Sprache der Welt, aber wie sollten Sie davon gehört haben, wenn Sie Ihre Zeit mit einem Vollidioten wie Kipling verplempern? Onetti bekam ihn 1980.«
Ich: »Also bitte, bloß weil ich mal zugegeben habe, dass ich Der Mann, der König sein wollte – das Ihr angebeteter T.S.Eliot bewunderte – gelesen habe, müssen Sie mich nicht ständig als jemanden hinstellen, der beim Massaker von Amritsar mitgeschossen hat.«
Schweigen.
Ich, nun in begütigendem Geschäftsführer-Ton: »Okay, wer ist dieser Onetti? Tut mir leid, dass ich noch nie von ihm gehört habe. Entschuldigen Sie, dass ich auf der Welt bin. Ich muss meine Zeit eben damit verplempern, eine anständige Reinigungskraft zu finden, damit wir nicht ewig Beschwerdebriefe wegen der Toiletten bekommen, die Sie ja nicht zu beantworten brauchen – weswegen ich das große Geld verdiene und mir die Haare ausfallen.«
Kopfschüttelnd schlug George die Seite im Katalog der Arizona State University Press um: »Juan Carlos Onetti, Sie umnachteter Imperialist aus dem Süden, ist … [er blickte von der Ladentheke zur Belletristik-Abteilung hinüber] … ist der uruguayische Dostojewski.«
Seit diesem denkwürdigen Literaturgespräch betrachte ich Onetti mit derselben Verehrung, die Miller Eduardo Santiago entgegenbrachte.
Ob Entdeckerglück oder Unerreichbarkeit, beides kann einem Buch Zauber verleihen und es zum Trostbuch werden lassen. Auf vollkommen unlogische Weise gilt das aber auch für den Kauf in einer bestimmten Buchhandlung. Erwerben wir beispielsweise ein Buch, das einen Bezug zu dem Ort hat, an dem wir gerade sind, wird es zum tröstenden Souvenir.
Ich glaube, das gilt generell. Fahre ich zum Beispiel in den Urlaub, irgendwohin, wo es ganz anders ist als im heimatlichen Kent, merke ich, dass ich Bücher auf eine neue Weise kaufe, um etwas nach Hause mitzunehmen, worin die Essenz meiner Reise ihren Ausdruck findet. Lasse ich den Blick über meine Bücherregale schweifen, sehe ich diese Erwerbungen, Mittelschichts-Pendants zu Felsstücken oder Sombreros und vielleicht weniger nützlich: The Geology of Mull, Wild Plants of Northern Cyprus und Ghosts of North Wales. Die ausgeprägt regionale Eigenart dieser Arkana ist auf den ersten Blick erkennbar, und sie fühlen sich auch anders an, ausgeworfen von klappernden Druckerpressen in Oban, Kyrenia und Pwllheli. Die materielle Beschaffenheit eines Buchs gibt oft den Ausschlag für seinen Trostcharakter. Im empfindlichen Regenwald der persönlichen Gefühle sind die Sinne so lebendig, dass ein Buch zum Talisman werden kann.
Mit Händen zu greifen
Das Trostbuch ist ein materielles Objekt. Einem Außerirdischen zu vermitteln, dass ein Buch, das Medium bloßer Worte, um seines Geruchs willen geliebt wird, um des Gefühls willen, wie es in der Hand liegt, dürfte nicht leicht sein. In den dreißig Jahren, die ich jetzt an der Kasse von Buchhandlungen stehe, habe ich viel Gerede darüber gehört, dass die Zeiten heute doch ganz anders seien – die Literatur tot, entsetzlich verflacht, zu viele Publikationen, bla, bla, bla –, die körperliche Reaktion der Kundschaft auf Bücher hat sich jedoch nicht verändert. Oft wird eine Neuerwerbung nach dem Kauf geherzt. Verblüffend häufig küssen Frauen ein Buch, wenn sie es gekauft haben.
Das tun sie, erfahre ich von den Frauen, bei denen ich mich erkundigt habe, nach dem scheinbar doch viel sinnlicheren Kauf von Kleidern nicht. Vielleicht ist es das Buch als Pforte zu einer unendlichen Vergangenheit, das den Kuss provoziert, ist es die natürliche Verehrung für etwas, das im Stillen so vieles in sich birgt. Die Reaktionen auf eine Installation, die 2019 in der Tate Modern zu sehen war, gaben ansatzweise Aufschluss über dieses wunderbar rätselhafte Verhalten. Der isländische Künstler Ólafur Elíasson hatte Blöcke aus 15000Jahre altem Eis vom Grönländischen Eisschild vor dem Museum aufgebaut. Zu seiner Verblüffung küssten viele Frauen dieses geschichtsträchtige Eis.
Die verborgene Geschichte weiblicher Bücherliebe ist ohne Frage lang. Michelangelos geistige Mentorin Vittoria Colonna küsste ihre Dante-Ausgabe, wovon sich die in viktorianischer Zeit lebende und heute vergessene Caroline Fellows zu ihrem Gedicht »Book Song« anregen ließ:
Vittoria küsste die Seite mit zarten Lippen
Und murmelte seufzend den geliebten Namen.
Im 17.Jahrhundert verstieg sich der aufgeblasene Langweiler Philipp Salmuth in seiner sechsbändigen medizinischen Enzyklopädie dazu, ein völlig harmloses junges Mädchen zu pathologisieren, dem es eine »große Lust war, an alten Büchern zu riechen«. Wie Salmuth beäugte auch der Sexualforscher Havelock Ellis lüstern das, was er bei Frauen als »erhebliches Maß sexueller Erregung in der Nähe von Objekten aus Leder, ledergebundenen Büchern etc.« diagnostizierte. (Ellis, der bis zum Alter von sechzig kein sexuelles Erlebnis gehabt hatte und sich daran ergötzte, Frauen beim Urinieren zuzusehen, ist vielleicht nicht die maßgebliche Autorität auf dem Gebiet weiblicher Sexualität.)
Sinnlichkeit muss nicht orgiastisch sein: Heute gerät die Literaturwissenschaftlerin Marina Warner auf sympathische Art aus dem Häuschen über eine alte Ausgabe von Tausendundeine Nacht, die sie in der Arcadian Library in London findet. Das Buch, schreibt sie
vermittelt einen starken Eindruck vom Leben der Bücher … Unter den Berührungen weich gewordene Buchdeckel, zerfledderte und eingerissene Seiten, stellenweise geflickt und eingefasst, damit sie nicht ganz auseinanderfallen – diese Bände sind im Wortsinne zerlesen … Ein muffig-kreatürlicher Geruch nach Händen und menschlichem Atem steigt von ihnen auf.
Wie Warner schätzten bereits die Romantiker des 19.Jahrhunderts alte Bücher, die Patina angesetzt, viel mitgemacht hatten, sich gut anfühlten und gut rochen. Besucher im Dove Cottage stellten verblüfft fest, dass Wordsworths wenige Bücher, in einer Nische neben dem Kamin lagernd, »schlecht oder gar nicht gebunden, manchmal völlig zerfleddert« waren. Coleridge wurde dabei beobachtet, als er seine alte Spinoza-Ausgabe küsste, und Charles Lamb schockierte den rechtschaffenen Anwalt Henry Robinson im Jahre 1824 mit seiner Vielzahl äußerlich schäbiger Trostbücher:
Zu Besuch bei [Charles]. Er hat die schönste Sammlung schäbiger Bücher, die ich je gesehen habe …, beschmutzte Ausgaben, die ein Zartbesaiteter anzufassen sich eigentlich scheuen würde … Er liebt seine »zerlumpten Veteranen« [und] wirft alle modernen Bücher weg, behält bloß den Plunder, den er als Kind so gern hatte.
Ein solcher »Veteran« war eine Ausgabe von Chapmans Homer-Übersetzungen, die Lamb einmal vor Augenzeugen herzte. Ungeniert schrieb er in einem Essay, dass er seine »Mitternachtsschätze« in den Arm genommen habe, Bücher, die »umhergeworfen und befingert« worden seien.
Der männliche Umgang mit dem physischen Objekt Buch wurde im viktorianischen Zeitalter zurückhaltender, in dem Männer sich generell weniger demonstrativ gebärden durften. Thackeray wurde dabei beobachtet, wie er Lambs Schriften an die Stirn drückte und »Heiliger Charles!« ausstieß – ein verbaler Erguss, aber kein Kuss. Mit der Veränderung des Buchdrucks im Zeitalter der Dampfmaschine wurde das Aroma neuer Bücher zum Ereignis: Dickens mochte den Dufthauch von frischem Papier, der aus einer Buchhandlung nach außen drang, ebenso George Gissing wenig später. Im 20.Jahrhundert bin ich beim Recherchieren nur auf einen einzigen noch Lebenden gestoßen, der Zuneigung zum physischen Buch erkennen ließ, und dieser Mann war 1927 bereits alt:
Als Harry Smith bei einer Auktion das Exemplar von Königin Mab mit Shelleys Widmung an Mary Wollstonecraft ersteigerte, kam ein bibliophiler alter Herr zu ihm und fragte, sich die Tränen aus den Augen wischend, ob er das Buch nur kurz mal in der Hand halten dürfe.
Neurowissenschaftlich gesehen ist olfaktorische Bücherliebe gesund. Der Geruchssinn gilt gemeinhin als der Sinn, der am unmittelbarsten mit der Erinnerung verknüpft ist, doch seine Bedeutung geht wesentlich darüber hinaus. Bei Patientinnen und Patienten mit einer Schädigung der fürs Erzählen zuständigen Hirnregion überwiegt ein buchstäbliches Sprachverständnis. Sie tun sich schwer »mit dem Verstehen von Zusammenhängen, mit intuitiver Sinnerfassung und mit Metaphern«, sie »intellektualisieren im Übermaß und verlieren die Fähigkeit zum Erkennen von Geschichten«. Über den Geruch, folgert Iain McGilchrist in The Master and His Emissary: The Divided Brain and the Making of the Western World (Yale University Press, 2009), »wird unsere Welt in der Intuition und im Körper verankert«. Im International Journal of Neuroscience unterstrich Marcello Spinella in seinem Artikel »A Relationship between Smell Identification and Empathy« (2002) den Zusammenhang von Geruchswahrnehmung und geistiger Gesundheit. Frauen werden üblicherweise dazu erzogen, sich mehr auf »Intuition und den Körper« zu verlassen, sie mögen aber auch das Erzählen, daher überrascht es nicht, dass Sylvia Plaths erste Reaktion auf die Nachricht von der bevorstehenden Publikation der Gedichte ihres Mannes Ted Hughes eine intuitive war. »Ich kann es kaum erwarten«, schrieb sie, »die Druckerschwärze auf den Seiten zu riechen!« Der Geruchssinn – das französische Wort sentir bedeutet sowohl »riechen« als auch »fühlen« – gibt uns Aufschluss über Freuds Klage, der erklärtermaßen eines nicht verstehen konnte, nämlich: Was will das Weib? Das Fehlen der Nase in Freuds Schriften sei auffällig, merkte David Howes in Sensual Relations: Engaging the Senses in Culture and Social Theory (University of Michigan Press, 2003) an.
Es scheint, als hätten all die Frauen und romantischen Dichter, die gern an Büchern schnupperten, weder Entrümpler noch die Sexualwissenschaft gebraucht; sie besaßen eine gesunde Zuneigung zum narrativen Lebenszusammenhang, den sie im Aroma von Büchern erspürten. Bücher sinnlich wahrzunehmen, ist animalisch, und das trifft auch dafür zu, wie wir uns zum Lesen einrichten.
Sich einigeln
Ich stieg auf den Sitz in der Fenstervertiefung, zog die Füße nach und kreuzte die Beine wie ein Türke; dann zog ich die dunkelroten Moiree-Vorhänge fest zusammen und saß so in einem doppelten Versteck.
(Charlotte Brontë, Jane Eyre)
Wohin gehen wir, wenn wir uns mit einem Buch zurückziehen? Die Fähigkeit, uns in einem Buch zu verlieren, ist erstaunlich, und das gilt im Allgemeinen auch für die Frage, welchen Ort wir zum Lesen wählen. Am richtigen Platz vergessen wir die Zeit, wir vergessen den Raum, dann den Sessel, schließlich sogar uns selbst. Der linksliberale Politiker und Schriftsteller William Cobbett, ein Autodidakt, erinnerte sich sehr anschaulich. Er sah Swifts Märchen von einer Tonne in der Auslage einer Buchhandlung in Richmond, kaufte sich statt einer Mahlzeit für drei Pence das Buch, stieg über eine Mauer und betrat ein Feld im oberen Teil von Kew Gardens:
Ich saß auf der schattigen Seite eines Heuhaufens und las ohne einen Gedanken ans Abendessen oder ans Bett. Als ich nichts mehr sah, … schlief ich neben dem Heu ein; und dann fing ich wieder an: Ich las weiter, und mich lockte sonst nichts.
Es gibt ungewöhnliche Berichte über diese Form des Vertieftseins. G.K.Chesterton las in der Hansom-Droschke, in der er fuhr, noch weiter, ohne eine Unregelmäßigkeit wahrzunehmen, als sie schon von der Straße abkam, bis er überrascht auf die Erde katapultiert wurde; sein Bruder Cecil las regelmäßig im Stehen in einem überfüllten Londoner Pub, das Pint in der einen, das Buch in der anderen Hand, »ab und zu glucksend«. Nicht einmal der Blitz konnte Mrs.Dyble bremsen, die als Haushälterin in dem Haus abseits der Fleet Street arbeitete, das einmal Dr.Johnson gehört hatte. Während alle anderen beim Ertönen der Sirene in den Keller hinabstiegen, zog sie sich in ihre Lieblings-Leseecke in dem Dachzimmer zurück, in dem Samuel Johnson das Dictionary of the English Language geschrieben hatte.
Das »Sich-Verlieren« ist ein Phänomen unseres wie ein Fluss dahinströmenden Bewusstseins. Die Wissenschaft äußert sich zu dieser Dissoziation nur vage. Der um 1890 von William James geprägte Begriff des »Bewusstseinsstroms« überzeugt noch heute. Das kartesianische Theater des Geistes ist seit Langem widerlegt, und die neueren, von Antonio Damasio, Daniel Dennett und Quantenphysikern vorgetragenen Auffassungen deuten alle auf ein Bewusstsein hin, das sich nicht mechanistisch in voneinander geschiedene Ebenen einteilen lässt. Die Vorstellung von zwei Ebenen, einer bewussten und einer unbewussten, hat ausgedient. Das Bewusstsein gleicht eher einem fließenden Gewässer oder einem tiefen Fluss als einer Maschine oder einem Netzdiagramm.
Es leuchtet ein, dass wir in unseren Fluss eintauchen und darin schwimmen wie ein Amazonas-Delfin, wenn wir beispielsweise regelmäßig eine gewohnte Strecke fahren und dabei »abschalten« oder träumen, wenn wir auf einmal mitten in einem Gespräch die im Hintergrund laufende Musik wahrnehmen oder Flugzeuglärm ausblenden. Virginia Woolfs fiktive Lebensbeschreibungen sind dauerhafter als große Teile der Neurowissenschaft mit ihrer ständig wechselnden Semantik. Sich in einem Buch zu verlieren, ähnelt dem, was für die heute trockene Alkoholikerin Leslie Jamison einst das Trinken bedeutete: ein »Wälzen in den Laken meiner selbst«.
Wie immer man den bis dato noch unbenannten Zustand der Selbstvergessenheit beim Lesen auch bezeichnen will, taucht man daraus wieder auf, ist es, als würde man zurück auf die Erde versetzt; so schilderte der Parapsychologe und Altphilologe Frederic Myers (1843–1901) anschaulich seine Erinnerung an sich selbst als Sechsjährigen, der seine Umgebung neu wahrnahm, nachdem er Vergil gelesen hatte: »Er steht mir noch lebhaft vor Augen, der Vorraum des Pfarrhauses mit dem hellen Bodenbelag und der Glastür zum Garten, durch die das Sonnenlicht hereinflutete.«
Ähnlich erging es auch Marjory Todd, Tochter eines Kesselschmieds aus dem Londoner Stadtteil Limehouse, im Jahre 1920 in einem Park beim Lesen von Sturmhöhe:
Ich erlebte ein plötzliches Bewusstwerden meiner Identität und Bestimmung, wie es wohl die meisten Heranwachsenden kennen. Bei manchen stellt es sich vielleicht nach und nach ein. Bei mir geschah es in einem einzigen Augenblick, deshalb erinnere ich mich noch heute genau an den Winkel der schräg stehenden Sonne, an die Gruppe der Kiefern, an das dürre Gras und an ein paar Kieferzapfen zu meinen Füßen.
(Marjory Todd, Snakes and Ladders, 1960)
Mein Sohn, der fast fünfzehn ist, erzählte mir, er habe in seinem Zimmer in Canterbury das Ende der His-Dark-Materials-Trilogie gelesen. Die Glocke der Kathedrale habe schon eine Weile geläutet, bewusst wahrgenommen habe er das aber erst, als er bei der letzten Zeile angelangt sei. Die Erinnerung an das Zimmer, das Sonnenlicht und die Glocke hat sich ihm unauslöschlich eingeprägt.
Dass uns ab und zu unser Ich bewusst wird, erleben wir alle, am häufigsten in der Kindheit. In seiner Poetik des Raumes nennt Bachelard es ein »Cogito des Ausgangs«. Daraus ergibt sich eine Konsequenz. Wenn wir plötzlich unserer Existenz innewerden können, was ist diese Existenz dann, wenn nicht ein Bewusstseinsinhalt? Hier nähern wir uns schon dem Existenzialismus Sartres, der tief beeindruckt war von einem Kindheits-Cogito in Richard Hughes’ Orkan über Jamaika. Emily hatte »in einem Winkel, ganz vorn am Bug des Schiffes«, gespielt, »als plötzlich der blitzhafte Gedanke kam, daß sie sie war«. Sie las in dem Augenblick zwar nicht, doch Leserinnen und Leser berichten oft, dass sie, in ein stilles Eckchen zurückgezogen, dasselbe entdeckt haben.
In einem Schlupfwinkel sich selbst zu begegnen, ist eine schwierig-schöne und fragile Angelegenheit. Romanciers und Dichter sind kongeniale Erforscher dieser magischen Abschnitte im Fluss des Lebens. Hier befindet sich Andrew Marvell 1681 in seinem Garten:
Den Geist zieht es, von minderen Freuden,
Indes zu eigenen Seligkeiten:
Den Geist – dies Meer, wo jeder Art
Sogleich ihre Entsprechung harrt;
Doch er schweift weiter, bildet selbst
Ganz neue Meere, neue Welt,
Und nichtet alles, was geschaffen,
Zu grüner Schau in grünen Schatten.
Marvells Transzendentalismus ist nicht jedermanns Sache, in unserer häuslichen Umgebung aber werden wir alle zu anderen mit einem anderen Empfinden. Klingelt der Polizist oder der Postbote an der Haustür, nehmen wir schlagartig die Pose des vorbildlichen Bürgers oder des zum Empfang von Mysterien Bereiten ein. Auf der Treppe sind wir in einem Zwischenreich, werden beim Hinuntergehen zu dem, der wir für andere sind, und erneuern beim Hinaufgehen unsere Individualität. Manchmal schleudert ein niederschmetterndes Ereignis uns an einen neuen Wohnort oder zwingt uns, Emotionen zu verarbeiten, die die Gewohnheit noch nicht abgetötet hat. Als ich vom frühen Tod eines befreundeten Buchhändlers in Schottland erfuhr, wurde mir erst auf dem Gartenweg bei der Mülltonne wieder klar, wo ich mich befand. Anne Lister, wohnhaft in Yorkshire, trieb es 1824 auf die Spitze. Sie ließ sich zum Lesen auf der Fensterbank nieder, die Vorhänge nur so weit offen, dass sie genügend Licht bekam, vom Rest des Hauses durch einen hohen Paravent abgeschirmt, in zwei dicke Mäntel gehüllt und einen Morgenrock über den Knien.
Abgeschiedenheit
Van Gogh malte häufig Nester und schrieb in einem Brief, er hoffe, sein Häuschen ähnele dem Nest eines Zaunkönigs. Bezeichnenderweise ist der Eingang zu diesen kugelförmigen Nestern oft nur schwer auszumachen. Der extreme Außenseiter Quasimodo fand seinen Schlupfwinkel im Glockenturm, der für ihn laut Hugo erst Ei, dann Nest war. Pasternak hatte ein Faible dafür, die menschengemachte Welt mit einem Schwalbennest zu vergleichen. Der häufige Vergleich des Leseplatzes mit den Nestern von Schwalben rührt wohl daher, dass sie aus dem Schlamm eines nahe gelegenen Flusses gebaut werden, nicht anders als das mythische Zuhause, das wir aus dem Strom des Bewusstseins errichten.
Es gibt eine verborgene Heldengeschichte von Menschen, denen es gelingt, selbst unter außergewöhnlichen Umständen und nachteiligen Bedingungen zu lesen, und zwar mit – so lautet vielleicht die beste Bezeichnung dafür – beflügeltem Pragmatismus. So viele können nur im Bett lesen, weil überall sonst im Haushalt zu viel Arbeit auf sie wartet oder es schlicht nicht gemütlich ist. Das englische Wort für »gemütlich«, cosy, eigentlich unübersetzbar und von unbekannter Herkunft, ist von den Wikingern über die Schotten in die Sprache eingegangen, wurde also geprägt von zwei Völkern, die sehr genau wussten, was ein warmes Plätzchen und Schutz vor der Witterung bedeuten. Auch Schutz vor dem Wind, für den wahre Kenner der Elemente, die Bewohner der Orkneys, acht verschiedene Wörter haben.
In Richard Mabeys Heilkraft der Natur, den Erinnerungen an eine lähmende Depression, schildert der Naturschriftsteller, wie er auf der Suche nach dem richtigen Leseplatz durchs Haus streifte und ihn schließlich an einem Ecktisch neben einer Wandlampe fand. Er ahmte dabei tierisches Verhalten nach: Hasen suchen nach einer Kuhle, einer Stelle am Boden einer Wiese, die sich gut dafür eignet, die Jungen zur Welt zu bringen. (Francis Bacon malte nur in den beengten Wohnverhältnissen von South Kensington gut: Er brauche es wohl, »eingeschränkt zu sein«, mutmaßte ein Kritiker.) Wir sind vom animalischen Instinkt für den richtigen Schlupfwinkel nicht so weit entfernt, wie wir vielleicht meinen, vor allem wenn wir uns in ein Buch vertiefen wollen. Studien an Kraken haben erbracht, dass das Bewusstsein auch in den Gliedmaßen verteilt sein kann, was uns einen Hinweis darauf liefert, warum wir unsere Beine und Arme so anordnen, wie wir es tun, wenn wir uns zum Lesen niederlassen.
(Es gibt den amüsanten Fall eines simulierten Rückzugs, den Fall von jemandem, der aus politischen Gründen den in seine Lektüre Vertieften spielte. Ein Diener beobachtete Thomas Cromwell einmal dabei, wie er nach dem Sturz seines Förderers Kardinal Wolsey laut schluchzend über ein Gebetbuch gebeugt auf einer Fensterbank im Esher Palace, Wolseys Landsitz, saß. Es sei, merkt der Kirchenhistoriker Eamon Duffy an, »eine öffentliche Zurschaustellung herkömmlicher Pietät« gewesen.) Zurück zum Ungekünstelten: Erasmus hatte dasselbe Problem wie Mabey; er besaß zwar »ein schönes Haus«, brauchte aber ewig, »bis er ein Eckchen gefunden hatte, in dem er seinen schmächtigen Leib unterbringen konnte«, wie sein erster Biograf schrieb. Den richtigen Leseplatz zu finden, wird auch dadurch erschwert, dass bei der Lektüre so vieles geschehen kann. Oft ist es eine an Verpuppung gemahnende Erfahrung, und wir kommen als andere Wesen wieder hervor. Wir igeln uns zum Lesen ein, werden körperlos und erscheinen womöglich in neuer, gewandelter Gestalt wieder. Einmal machte Kafka bei dieser Verwandlung offenbar eine körperlich gegenläufige Erfahrung. 1913 schrieb er an seine zukünftige Verlobte Felice Bauer über die Lektüre eines Gedichts: Wie es »sich erhebt, mit einer ununterbrochenen, innern, strömenden Entwicklung – wie reißt man da, auf dem Kanapee zusammengekrümmt, die Augen auf!«
Treppenabsätze und Flure, in denen keine häuslichen Pflichten warten und man sich fühlt wie in einer Abflughalle, können verlockende Leseplätze sein. Walter Scotts Haus war geräumig bis zur Unpersönlichkeit, sodass er oft auf halber Treppe zu seiner Bibliothek las.
Fernab der Sorgen, die Erasmus und Scott in ihren schönen Häusern beim Lesen hatten, mussten sich Arbeiter, die lasen, freilich mit weit schwierigeren Problemen als dem Finden eines geeigneten Platzes herumschlagen.
2.
Lesen unter widrigen Umständen
Die Bibliothek des Holland House in Kensington, London, nach einem Molotow-»Brotkorb«, einer Brandbombe. Central Press/Hulton Archive/Getty Images.
Tränen auf der Maschine: Lesende Arbeiter
In der gesamten Menschheitsgeschichte waren Bücher für den körperlich arbeitenden Teil des Volkes so schwer zugänglich, und Muße war so selten, dass seine Möglichkeiten zu lesen stark eingeschränkt waren. Für den kornischen Zimmermann George Smith (geb. um 1800) besaßen Mathematikbücher den Vorzug der Langlebigkeit. Er erinnerte sich in seiner Autobiografie: »Eine Abhandlung über Mathematik oder Geometrie kostete nur wenige Shilling und bot mir ein ganzes Jahr lang Stoff für eine gründliche Lektüre.« Andere litten eher unter Zeit- als unter Büchermangel, so etwa der Londoner Schuster und spätere Buchhändler James Lackington (1746–1815). Er ersann ein wirklich verblüffendes Reglement, nach dem er und seine Kollegen sich nur drei Stunden Schlaf pro Nacht zugestanden:
Einer von uns blieb bei der Arbeit, bis die anderen zur verabredeten Zeit aufstanden, und wenn wir alle auf waren, wechselten mein Freund John und Ihr ergebener Diener sich ab und lasen den anderen, die unterdessen an der Arbeit saßen, laut vor.
Vergleichbar bescheiden ging es bei James Miller zu, einem Gurtmacher aus dem schottischen Hochland, der gewöhnlich jemanden auftrieb, der ihm vorlas, während er arbeitete, und der jeden Abend Lesungen abhielt, häufig »mit zwei oder drei intelligenten Nachbarn« als Zuhörer. Da überrascht es vielleicht wenig, dass sein Sohn Hugh (1802–