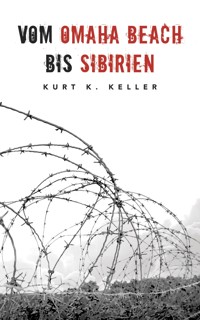
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Publishing
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Von einer Hölle in die nächste … Spüren Sie dem schier unvorstellbaren Martyrium des Soldaten Kurt K. Keller nach. Kurt K. Keller, Jahrgang 1925, trat im April 1943 seinen Dienst bei der Wehrmacht an – ihm sollte ein bewegtes Soldatenleben bevorstehen: Am 6. Juni 1944, dem D-Day, gehörte Keller zu den Verteidigern am blutigen Strandabschnitt Omaha Beach, wo Tausende US-Soldaten direkt in den deutschen Kugelhagel hineinrannten. Im Anschluss machte er die Rückzugskämpfe der Wehrmacht bis zum Rhein mit. Des Kämpfens überdrüssig, ließ sich Keller zu einer leichtfertigen Äußerung hinreißen, weshalb ihm ein Kriegsgerichtsprozess drohte. Er entschied sich kurzerhand zu desertieren, wurde jedoch verraten und festgenommen. So gelangte er zum Bewährungsbataillon 500 – ein Himmelfahrtskommando an der Ostfront! Im April 1945 wurde das Bataillon eingekesselt und im Feuer von "Stalinorgeln" und sowjetischen Panzern aufgerieben. Kurt Keller geriet in Kriegsgefangenschaft und verlegte in einem Gewaltmarsch zum KZ Ausschwitz, wo er die zahlreichen Leichen beerdigen sollte – ein furchtbarer Auftrag! Dort erlebte der junge Soldat auch das Kriegsende. Doch damit war Kellers Martyrium noch lange nicht zu Ende … Die Sowjets pferchten ihn mit zig Kameraden in einen Güterwaggon. Es folgte eine unmenschliche Odyssee ins Schachtlager Leninsk im Kusnetzbecken – 8.000 Kilometer von der Heimat entfernt! Kurt Keller gelang schließlich eine dramatische Flucht über 3.500 Kilometer nach Westen, doch im Gewirr der Schienenstränge entschied er sich schließlich für den falschen Zug … D-Day-Experte Helmut Konrad von Keusgen hat Kellers Geschichte nach zahllosen Gesprächen und akribischen Recherchen zu Papier gebracht. Seine Hingabe zu den Details und seine präzisen Beschreibungen zeichnen diese Biografie aus. Zahlreiche Fotografien liefern Ihnen zudem spannende Einblicke in das Soldatenleben Kellers. Sichern Sie sich jetzt diese überarbeitete Neuauflage des lange vergriffenen Buches, das erstmals im Jahr 2004 erschienen ist. Die erschütternde Biografie Kurt K. Kellers wird Sie fesseln und nicht mehr loslassen. Erleben Sie die schier unvorstellbare Geschichte eines deutschen Soldaten, der beständig von einer Hölle in die nächste geriet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Vom Omaha Beach bis Sibirien
Horror-Odyssee eines deutschen Soldaten
Kurt Karl Keller
Kurt Karl Keller 1943 als 18-jähriger Soldat
und 2004 im Alter von 79 Jahren.
Kurt K. Keller wurde als jüngstes von elf Kindern seiner Eltern Andreas und Katharina am 14. Dezember 1925 in Oberbexbach im Saarland geboren.Von 1932 bis 1940 besuchte er die Volksschule und absolvierte anschließend das Landpflichtjahr. Im Alter von 10 Jahren trat Keller dem Jungvolk bei. Ab Januar 1941 besuchte er die kaufmännische Berufsschule, im April 1941 begann er seine Lehre als Bauzeichner im Gemeindebauamt. Ende 1942 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger – was den Beginn einer grausamen Horror-Odyssee zur Folge hatte …
Bei diesem Buch handelt es sich um eine überarbeitete Neuauflage des gleichnamigen Titels aus dem Jahr 2014.
Auf Wunsch des Autors obliegt diese Neuauflage mit ihrem Originaltext den Regeln der alten deutschen Rechtschreibung.
Dieses Buch widme ich
meinem ehemaligen Oberwachtmeister (dem ich fest versprochen habe, seinen Namen niemals preiszugeben, da er einer sehr bekannten deutschen Offiziersfamilie angehörte), meinem tapferen Kameraden Theo (dessen Familienname mir unbekannt geblieben ist), einem mir namentlich unbekannten, höchst liebenswürdigen russischen Ehepaar in einer mir ebenso unbekannten kleinen Ortschaft Sibiriens, einem gutmütigen alten Russen, den ich auf einem Kartoffelacker traf,der sympathischen russischen Lager-Ärztin Marita,dem humanen russischen Einsatzleiter eines unserer Arbeitskommandos in Magnitogorsk, Nikolaj Berljakow, und seiner warmherzigen Ehefrau Tamara Berljakowa, der couragierten russischen Militär-Ärztin Ana Stepanowa,meinem einfühlsamen Freund Helmut Konrad Freiherr von Keusgen und meiner verständnisvollen Ehefrau Gertrud.Inhaltsverzeichnis
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Vorwort
Mit der Fahne der Jugend
Reichsarbeitsdienst
Auf dem Weg in den Krieg
Die Invasion – Macht und Ohnmacht
Sonderstab II OKH
Bewährungsbataillon 500
Kriegsgefangenschaft
Auschwitz
Gefangenentransport
Endstation Sibirien
Flucht aus der Hölle
Karte der Route des Fluchwegs von Leninsk nach Magnitogorsk
Magnitogorsk, Lager 7617
Krankenlager Platina – Sterben ohne Ende
Tscheljabinsk – Lager und Heimkehr
Anhang
Nachwort
Bildnachweis
Impressum
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!
Mit unserem Label EK-2 Militär möchten wir militärische und militärgeschichtliche Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.
Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!
Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.
Schreiben Sie uns: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Jill & Heiko von EK-2 Publishing
Mit der Fahne der Jugend
Ich gehörte als Jahrgang 1925 zur Generation jener, die ihre Jugend in einer Zeit verlebten, in der man besonders, und gerade ihnen, mit allen Mitteln der Propaganda die „auserwählte Zeit“ ihres Lebens regelrecht einimpfte. Wir waren „der Stolz des Führers“ und demnach die Zukunft des Dritten Reiches …
„Seid flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl“, sagte unser Idol, und das glaubten wir auch sein zu müssen. Für uns Pimpfe (Vorstufe der Hitlerjugend) war Adolf Hitler einem Gott gleich, wurde verherrlicht und angebetet. Ein Zustand, der allmählich zur Selbstverständlichkeit heranwuchs und Fragen an die Erwachsenen ausschloß. Der „Führer“, so wurde laut gedacht, wird den richtigen Weg für uns und das Reich gehen, das seit März 1938 Großdeutschland hieß. Nun glaubten wir, eine glückliche Zukunft zu haben und dankten voller Ehrfurcht mit den Worten: „Führer befiehl, wir folgen Dir! Ein Volk, ein Reich, ein Führer!“
Stolz marschierte ich hinter dem Wimpel her, Schuhe und Koppel auf Hochglanz poliert, die Uniform auf Sitz gebracht, und sang aus voller Brust das Lied der Hitlerjugend, getextet vom Reichsjugendführer Baldur von Schirach:
„Uns’re Fahne flattert uns voran, in die Zukunft ziehen wir, Mann für Mann.Wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Not,mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot.Uns’re Fahne flattert uns voran, uns’re Fahne ist die neue Zeit.Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit;ja, die Fahne ist mehr als der Tod.“
Auch der Lehrplan in der Schule war dem neuen Zeitgeist angepaßt. So fügte ich einmal in einem Aufsatz den Teil eines Gedichtes mit ein:
„Mein Führer, nun hab ich Dich gesehen; was immer mag geschehen,ich halte die Treue Dir.“
Mit eigenen Augen habe ich „meinen Gott“ nie gesehen, erhielt aber für den Aufsatz eine dem „Zeitgeist“ würdige Note.
Im Jahr 1938 nahm ich noch als 13-jähriger und begeisterter ”Pimpf” am Sportfest teil.
Mit 14 Jahren war meine Zeit als Pimpf abgelaufen. Ich bekam eine Hakenkreuz-Armbinde zum Zeichen dafür, nunmehr der Hitlerjugend anzugehören. Die Schulungsabende hatten ab sofort einen ganz anderen, gezielten Inhalt zum Thema. Jetzt lernte ich den „ewigen Juden“ kennen und verachten, „erfuhr“, daß alle Menschen außerhalb Großdeutschlands unsere Feinde seien. Mit dem Beginn des Polen-Feldzugs, am 1. September 1939, vernahm mein bereits höriger Geist, warum wir kämpfen mußten: „Weil uns dieser Kampf durch England und seinen polnischen Verwandten aufgezwungen wurde …“
Natürlich erfuhr ich auch, wofür wir kämpften: „Für das Letzte und Höchste des Deutschen; für unsere Freiheit, um nicht Sklaven fremder Herrscher zu werden …“
Das war für mich ein Lehrstoff, den ich mit Begeisterung aufnahm. Dadurch blähte sich meine Kinderbrust derart, daß fast mein braunes Hemd gesprengt wurde.
Der Blitzkrieg in Polen hatte viele Opfer gefordert. Schon bald kam der Aufruf: „Deutsche Jugend, meldet Euch freiwillig zur Unteroffiziersvorschule!“
Ich bekam kaum die Kurve, um mich zu melden, wollte so schnell wie möglich Soldat werden. Ich erklärte zum Zweck meiner Bewerbung beim Wehrbereichskommando, als die Musterung meines „Heldenkörpers“ anstand, mein Wissen betreffs allgemeiner Fragen über den Lebenslauf Adolf Hitlers und der deutschen Geschichte. (Es war wichtig, daß man bei derartigen Ausführungen immer wieder den Begriff „Führer“ und seinen Namen nannte und der eigenen Begeisterung besonderen Nachdruck verlieh.)
Zu meiner Bestürzung mußte ich dann jedoch hören, daß ein einziger Zentimeter zur erforderlichen Mindestgröße von 1,60 Metern fehlte. Der Andrang beim Wehrbezirkskommando für die Unteroffiziers-Vorschule war so gewaltig, daß sich die Herren eine spezielle Selektion leisten konnten. Ich war tief enttäuscht, daß mein Wunsch, bald die graue Uniform tragen zu dürfen, vorerst nicht in Erfüllung ging.
Es war inzwischen an der Zeit, meine Lehre zu beginnen. Ich bekam eine Lehrstelle beim Gemeindebauamt, um Bauzeichner zu werden. Doch die Bedingung, eine staatliche Lehrstelle zu erhalten, bestand in der Ableistung eines Landpflichtjahres zum Wohle Großdeutschlands. Durch das Arbeitsamt erhielt ich meine Landpflichtjahrsstelle sogar bei einem Ortsbauernführer und gleichzeitigem Ortsgruppenleiter der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), was mir als gut erzogenem Hitlerjungen direkt privilegiert erschien. Für mich fing damit eine harte Arbeitszeit an, die morgens um 3 Uhr begann und selten vor 20 Uhr endete. Die Ursache für diesen langen Arbeitstag lag darin, daß mein Lehrherr noch eine Bäckerei betrieb. Die eigentliche Landwirtschaft, der Sinn der Sache, bestand lediglich aus einer einzigen Kuh, etwas Kleinvieh und nur wenig Ackerland oder Wiesen. Neben der Arbeit in der Bäckerei oblag mir daher, die Kuh Bless und das Kleinvieh zu versorgen. Am Wochenende traf oftmals eine Ladung Kohle oder Koks ein, die ich einsatzfreudig in den Heizungskeller schaufelte. Ich lernte dabei die Schaufel kennen – und Schwielen an meinen Händen. Keinesfalls hätte ich deswegen gemurrt, da ich der Meinung war, die Zähigkeit von Leder beweisen zu müssen, um den Worten meines „Führers“Folge zu leisten. So habe ich es in der Hitlerjugend gelernt und danach lebte ich – bedingungslos.
Mein Herr war in der Vergabe von gutem Essen nicht kleinlich, verabreichte mir aber auch großzügig Schläge mit einem abgebrochenen Brotschieber. Schon bei nichtigen Anlässen schwang er dieses zweckentfremdete Werkzeug, um meinen Körper so hart wie Kruppstahl zu schmieden. Auch diese “Miterziehung“ im Landpflichtjahr nahm ich als selbstverständlich hin, da sie ja durch einen Vertreter der Partei erfolgte.
Nachdem das Jahr vergangen war, durfte ich endlich meine Lehre als Bauzeichner beginnen. Wieder hatte ich die Ehre, einen überzeugten Parteianhänger als Lehrherren zu bekommen. In Anbetracht seiner politischen Position lernte ich mit großem Eifer und grüßte ihn jeden Morgen ehrfürchtig mit „Heil Hitler, Herr Baumeister!“
Mit 17 Jahren erhielt ich ein Schreiben, das mein Leben dann total verändern sollte: Sie werden hiermit aufgefordert, sich zur Musterung einzufinden.
Endlich war das ersehnte Soldatenleben in greifbare Nähe gerückt. Die Musterung meines Körpers vollzog sich erstaunlich rasch, denn bevor ich mich umsah, stand ich vor einem Tisch, hinter dem einige Offiziere mit wichtiger Miene saßen. Mein Blick fiel noch auf einen hinter Glas gerahmten Spruch an der Wand, der da lautete: Fasse Dich kurz!
Dann vernahm ich die Frage: „Zu welchem Wehrmachtteil wollen Sie?“
In gelernter strammer Haltung sagte ich in Ermahnung des Schildes an der Wand: „Zur Luftwaffe.“
Kaum hatte ich meinen Wunsch geäußert, rief ein Unteroffizier, der an der Tür stand: „Raus! Der Nächste!“
Meine Eltern waren mit meinem pro-nationalsozialistischen Enthusiasmus überhaupt nicht einverstanden. (Das Abzeichen am Jackenrevers meines Vaters ist kein Parteiabzeichen, sondern eines seines Gesangsvereins.)
In einem Laden in der Nähe kaufte ich mir dann Papierblumen und eine Pappspange mit der Aufschrift Luftwaffe. Dann zog ich mit den anderen Gemusterten singend durch die Straßen. Mein „Führer“ wäre zufrieden gewesen, mich in dieser Begeisterung zu sehen …
Schon nach wenigen Tagen erhielt ich vom Wehrbezirkskommando meinen Wehrpaß. Über die Freude, ihn zu besitzen, war ich in meinem naiven Eifer nicht mehr zu bremsen. Mitten in meinen Freudentaumel rief Reichsjugendführer Baldur von Schirach seine Hitlerjugend auf, sich freiwillig zur Großdeutschen Wehrmacht zu melden. Spontan folgte ich diesem Aufruf. Mein Vater, ein ehemaliger Frontsoldat des Ersten Weltkrieges, versuchte mich vergebens von meinem Vorhaben abzubringen, da er sehr wohl wußte, was mich erwarten könnte. Auch die Tränen meiner Mutter konnten nichts an meinem Wunsch ändern, „Führer“, Volk und Reich als Soldat dienen zu wollen. Der Hinweis meiner Eltern auf die vielen Kreuze gefallener Soldaten in der NSZ (Nationalsozialistische Zeitung) waren für mich kein Argument, einzusehen, daß die Zeit der Siege bereits der Vergangenheit angehörte. Ich war der überzeugten Meinung, als (fanatischer) Hitlerjunge angesichts der Entstehung des Tausendjährigen Reichs nicht länger zurückstehen zu können, gerade jetzt, da eine Welle der Eroberung durch Europa rollte, da der Wehrmachtbericht ständig meldete, daß man aus den „Untermenschen“ im Osten Sklaven gemacht habe, unsere Helden über sich hinauswüchsen und auf dem Feld der Ehre die Ziele unseres „Führers“ erkämpften …
An meine berufliche Zukunft durfte ich nun nicht mehr denken. Also schnell in den Krieg ziehen, bevor er zu Ende ging. Ich könnte an der Seite meiner Kameraden am Schlachtenruhm teilhaben und würde nicht ohne Orden und Ehrenzeichen beim Endsieg ausgehen müssen …
Reichsarbeitsdienst
Schneller als gedacht erhielt ich meine Einberufung zum Reichsarbeitsdienst nach Remagen am Rhein. Am 2. Januar 1943 betrat ich das dortige Lager, um bereits am Eingang den Leitspruch meiner Ausbildung lesen zu können: Wir rüsten Leib und Seele!
Die Mannschaft des Reichsarbeitsdienstes, der ich zugeteilt wurde, bestand ausschließlich aus Kriegsfreiwilligen, die sich gegenseitig in ihrem Fanatismus und Eifer überboten. Neben der Arbeit, die vorwiegend daraus bestand, den Wald zu roden, wurde mit dem blank glänzenden Spaten exerziert, Wache gestanden, Nachtmärsche und Geländeübungen durchgeführt. Rauchen war uns Minderjährigen verboten, wir wurden aber mit 25 Pfennig pro Tag für geleistete Arbeit belohnt. Unbefangen sang ich mit:
„Fünfundzwanzig Pfennig ist der Reinverdienst,ein jeder muß zum Arbeitsdienstund dann zum Militär!“
Zu einem Reichsarbeitsdienst-Lager gehörte natürlich kein Wimpel mehr, sondern eine Hakenkreuzfahne, die jeden Morgen gehißt wurde. Anläßlich dieses Zeremoniells hatte stets einer der Mitglieder des RADs einen „markigen“ Fahnenspruch aufzusagen, damit die Fahne in Würde die Mastspitze erreichte. Da ich ein „markiger“ RAD-Mann war, wollte ich nicht zurückstehen und meldete mich zum Aufsagen des Fahnenspruchs. Zackig wie immer stand ich in Habachtstellung neben dem Fahnenmast, um den Alten Fritz zu zitieren:
„Wer bewirkt, daß dort, wo bisher ein Halm wuchs, nunmehr zwei wachsen, der hat mehr geleistet, als ein Feldherr, der eine Schlacht gewann.“
Dieses Zitat fand ich eines Fahnenspruches würdig – doch unser Feldmeister überhaupt nicht. Unbeherrscht schrie er mich an: „Sie Mündungsschoner von einem RAD-Mann! Was Sie eben von sich gegeben haben, ist eine Beleidigung unserer Generalität!“
Erstaunt nahm ich in strammer Haltung sein Gebrüll zur Kenntnis, vermutete jedoch, daß er Friedrich den Großen nicht aus dem Geschichtsunterricht kannte. Der Feldmeister bestrafte mich dann damit, daß er mich mit meiner Zahnbürste die Latrine schrubben ließ. Er vergaß auch nicht, zu betonen, daß ich damit noch „gut bedient“ sei. Umgehend führte ich den Befehl mit meiner Zahnbürste aus. Das Übelste an dieser Strafe war nicht nur der Gestank, sondern der Zustand meiner Zahnbürste nach dieser entwürdigenden Tortur. Ich aber blieb hart wie Kruppstahl und meldete dem Feldmeister nach Beendigung meiner Strafarbeit: „Befehl ausgeführt, Herr Feldmeister!“
Da ich beim Exerzieren mit dem glänzenden Spaten besondere Fähigkeiten entwickelte (einfach „zack-zack“ und hörbar auf den Spatenstiel geklopft), wurde ich auserwählt, mit nach Koblenz zu fahren, um dort beim Gaustab Wache zu stehen. In diesen Stunden der Wache beim Arbeitsgau hatte ich viel Zeit, um über Gegenwart und Zukunft nachzudenken. Doch wie konnte es anders sein, ich gelangte nur zu einem positiven Ergebnis … In meinem Inneren war jedoch etwas spürbar, das mir gar nicht behagte, nämlich großes Heimweh. Beschämend mußte ich zu der Erkenntnis kommen, daß eine solche Sentimentalität nicht zu einem Frontkämpfer paßte. Ich erinnerte mich an die Worte Adolf Hitlers, die besagten, zäh wie Leder zu sein.
Am 1. April 1943 waren die drei Monate des Reichsarbeitsdienstes vorbei. Ich holte meinen Persil-Karton aus dem Magazin, zog die Sepplhosen an und fuhr heim. Nun war ich der großen Stunde nahe gekommen, das „Ehrenkleid der Nation“ anzuziehen, Front und Heldentum zu bestehen. Auf der Heimfahrt grölte ich:
„Auf, auf Kameraden! Es zittern die morschen Knochen.Wir werden weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt,denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt!“
Stolz drückte ich meine Brust hervor und war glücklich, in dieser glorreichen Zeit leben zu können …
Endlich wieder daheim, lag mein Einberufungsbescheid zur Wehrmacht auf dem Tisch. Am 8. April 1943 mußte ich mich bei der Aufklärungsabteilung 6, Stammschwadron, in Darmstadt melden. Der Begriff Schwadron besagte, daß die Luftwaffe wohl nicht an mir interessiert war.
Im März 1943 wurde ich „auserwählt“ zur Gaustabswache nach Koblenz zu fahren.
Auf dem Weg in den Krieg
Meine Einberufung erfolgte zu jener Zeit, in der mein großes Idol die tapferen Landser der 6. Armee in Stalingrad gerade einem erbarmungslosen Schicksal überließ. Diese Tatsache bedrückte mich sehr, trotzdem war ich nicht fähig, meine eigene Haltung ernsthaft zu überprüfen. Wieder war der erzieherische Einfluß des Nationalsozialismus stärker als alle Einsicht und Vernunft. Im Gegenteil, ich war so vermessen, zu sagen: „Jetzt kommen wir von der Hitlerjugend, bestens gedrillt und erzogen, Befehle auszuführen. Kameraden, wir werden an Eurer Seite den Endsieg erkämpfen.“
Die 1. Gruppe des 3. Schwadrons der Aufklärungsabteilung, der ich (vordere Reihe, in der Mitte) angehörte, im Juli 1943 in Breda.
Die Einkleidung in Darmstadt war problematisch, da die Uniformen zu groß waren – oder wir zu klein. Für mich war der erste Tag im „Ehrenrock“ ein Erlebnis besonderer Art, da ich endlich die graue Uniform tragen durfte. Nach der Vereidigung auf „Führer“, Volk und Reich erhielten wir statt echter Pferde „Stahlrösser“, um somit einer Schwadron entsprechend ausgerüstet zu sein.
Ostern 1943 wurden wir mit unseren „Pferden“ nach Holland und in die Stadt Breda verlegt, um als Aufklärer ausgebildet zu werden. Erfahrene Rußlandkämpfer sorgten für eine gründliche Ausbildung, wobei unsere Fahrräder für bewegliche Einsätze zum würdigen Ruf einer schnellen Vorausabteilung beitrugen. Die Grundausbildung fand nach drei Monaten durch eine größere Übung ihren Abschluß.
Lobend sagte ein General am Ende: „Soldaten! Eure Leistungen haben mich überzeugt, daß Ihr mit Mut und vollem Einsatz Euren Platz an der Front gebührend ausfüllen werdet. Ich bin stolz auf Euch!“
Mit einem dreifachen „Sieg Heil!“ auf den „Führer“, das wir in den holländischen Himmel brüllten, ging dieser Tag zu Ende.
Über Nacht kam dann die Verlegung per Eisenbahn nach Nordfrankreich, in die schöne Normandie, diesem gesegneten Land, in dem, wie es hieß, Milch und Honig fließen. In kleinen verträumten Dörfern bezogen wir Privatquartiere, um „ein Leben wie Gott in Frankreich“ zu führen. Erstmals fühlte ich mich als Herr unter Herrenmenschen, vergaß darüber fast den Sinn meiner Anwesenheit im sogenannten Feindesland und mitten im Krieg. Nur die ständigen Übungsalarme bei Tag oder Nacht erinnerten mich daran, daß man auf eine Invasion der WestAlliierten vorbereitet sein mußte. Vom General bis hinunter zum Landser hoffte man, daß diese an einer anderen Stelle des Kanals stattfinden würde. Die berühmte Ruhe vor dem Sturm sowie das geruhsame Besatzungsleben ermöglichten sogar, einen Heimaturlaub zu bekommen. Am 12. Dezember 1943 hatte ich den schönsten aller Scheine, den Urlaubsschein, in der Tasche und fuhr für zwei Wochen in die Heimat. Als ich dann am Heiligen Abend die Rückreise antreten mußte, konnte ich meine weinende Mutter und den zu Recht besorgten Vater damit beruhigen, daß in der Normandie alles friedlich sei …
Nach meiner Rückkehr zur Aufklärungsabteilung erfuhr ich am 25. Dezember, daß ich inzwischen zum Gefreiten befördert worden war. Dann wurden wir durch unseren erfahrenen Oberwachtmeister im Angreifen eines Panzers mit einer Tellermine ausgebildet. Ebenso übten wir unter lautem Geschrei den Nahkampf, oder wir jagten im Zuge einer Übung einen gelandeten imaginären Feind zurück ins Meer. Doch allmählich nahmen diese Übungen ab und machten einem geruhsamen Besatzungsleben Platz. Das wurde von unserem „Spieß“ (Kompaniegeschäftsführer) für seine allgemein bekannten Saufgelage genutzt, zu denen er nicht selten aus Caen „leichte“ Mädchen holen ließ. Dieses Leben war vielen angenehm, aber nicht meine Sache. Ich war infolge meiner ideologischen Erziehung freiwillig Soldat geworden, um heldenhaft zu kämpfen, so wie es mein oberster Befehlshaber erwartete.
Seit meiner Verlegung in die Normandie gehörte ich (vorn links, im März 1944, bei Lingèvres) zur „zusammengewürfelten“ 352. Division.
Mitten in diese Ruhe befahl Anfang Mai 1944 Generalfeldmarschall Erwin Rommel, sofort alle noch verfügbaren Truppen zum Ausbau der Küstenbefestigungen einzusetzen. Bei diesen Arbeiten mußten von uns am Strand Minen und andere Sprengkörper gelegt werden (die dann von den Pionieren scharf gemacht wurden), und wir „pflanzten“ 1,80 Meter lange Baumstämme in den Sand, auf deren Spitzen man später Minen befestigte. Auch mußten wir Pfähle (den sogenannten Rommelspargel) gegen Luftlandeunternehmen ins küstennahe Hinterland rammen.
Im Mai nahm ich erstaunt zur Kenntnis, daß die mächtigen Geschützbunker des großen Stützpunktes auf der Pointe du Hoc leerstanden und die vielen MG-Nester nur einfache Tarnnetze gegen Fliegereinsicht trugen. So war es auch mit den Verbindungsgräben zwischen den Bunkern entlang der Küste, die nur mit Stacheldraht zur Seeseite abgesichert waren. Alles das entsprach nicht meinen Vorstellungen eines uneinnehmbaren Atlantikwalls. Wieder gedachte ich der Worte meines „Führers“: „Wo der deutsche Soldat steht, kommt kein anderer hin!“
In der Normandie glaubte ich fest an die Aussage Hitlers, daß hier die deutsche Jugend bereit steht, jedem Landungsversuch einer feindlichen Armee eine vernichtende Niederlage zu bereiten. Was an Material fehlte, würden wir durch unseren Kampfgeist ersetzen. Meine Zuversicht und mein Glauben an diesen Sieg waren grenzenlos.
Eine kurze Pause während der Schanzarbeiten. Bei mir befindet sich einer von Tausenden sogenannter Hiwis (kriegsgefangene Hilfswillige, die mehr oder weniger zum Dienst mit der Waffe im deutschen Heer gezwungen worden waren). Nicht selten verstanden sich diese Ost-Soldaten mit den Wehrmachtangehörigen sehr gut – so wie es zwischen mir und Juriy (im Hintergrund) aus dem Donez-Becken auch der Fall war.
Die Invasion – Macht und Ohnmacht
Anfang Juni 1944 verließen wir unsere Quartiere in dem verträumten Dorf Lingèvres und biwakierten in Zelten, gut versteckt unter Hecken, die sich endlos durch die Normandie ziehen. Die Nacht vom 5. auf den 6. Juni war durchdröhnt vom pausenlosen Einflug feindlicher Flugzeuge. In den frühen Morgenstunden, gegen 6 Uhr, ließ ein unbeschreiblich heftiges Bombardement auf die deutschen Küstenstellungen die Erde der Normandie erbeben. Obwohl wir etwa 12 Kilometer hinter der Küste lagen, wurden wir, auf dem Boden liegend, geschüttelt. Erst jetzt kam für unsere Schwadron der Befehl, sofort zur Küste abzurücken, da die Landung der West-Alliierten begonnen hatte.
Obwohl mit einer Invasion seit Wochen täglich zu rechnen war, hatten wir immer noch Übungsmunition in den Patronentaschen und sämtlichen Munitionskästen. Die Folge war, daß im Moment einer Landung der Alliierten, in dem jede Minute zur Verteidigung zählte, nun jedoch erst damit begonnen wurde, scharfe Munition auszugeben und für die Maschinengewehre umzugurten. Der Waffen-Unteroffizier ließ trotz der gebotenen Eile sämtliche ausgegebene Munition gewissenhaft in seine Bücher eintragen. Als wir dann endlich kampfmäßig ausgerüstet waren, radelten wir mit unseren „Stahlrössern“ in Richtung Küste. Ab Formigny ging es dann aber nur noch zu Fuß weiter, da die Jabos (Jagdbomber) mit ihrem gezielten MG-Feuer und den Raketen deutsche Truppenbewegungen fast gänzlich unmöglich machten. (Daß die Hälfte meiner Schwadron deswegen mit unserem Oberleutnant im Wald von Cerisy Deckung nehmen mußte, erfuhr ich erst am Abend in St. Gabriel.)
Die deutschen Küstenbefestigungen im Stahlgewitter des bereits zweiten Trommelfeuers der amerikanischen Schiffsartillerie und Raketenwerfer.
Noch bevor wir um kurz vor halb zehn die Küstenstraße zwischen den Dörfern Vierville-sur-Mer und Colleville-sur-Mer erreicht hatten, begann der Granatbeschuß der feindlichen Schiffsartillerie (das zweite Trommelfeuer der Amerikaner auf die deutschen Küstenstellungen).
Endlich bei St.Laurent-sur-Mer angekommen, gab es keinen klaren Einsatzbefehl unseres Zugführers, da er selbst nicht wußte, wo er uns einsetzen sollte. Als wir dann zur Küste rennen wollten, wurden wir durch das schwere Trommelfeuer regelrecht an den Boden genagelt. Wir warfen uns in die eben erst in den Erdboden gerissenen Granattrichter, um so etwas Schutz vor der grausamen, tosenden Feuerwalze zu finden. Furchtbar waren die Schreie der verwundeten Kameraden. Dazwischen immer neue Explosionen mit schwersten Druckwellen, die alles erbeben ließen. Zuerst wollte ich aufspringen und einfach davonrennen, aber mein Körper war vor Angst wie gelähmt. Ich preßte meine Hände auf die Ohren und wünschte mir, in diesem Moment eine Maus zu sein, die sich tief im Erdboden verstecken könnte. Aber ich war weder eine Maus, noch war ich tapfer. Ich war nur ein Mensch – ein Mensch, der Angst hatte, furchtbare Angst. Ein Kamerad, der im selben Granattrichter lag, legte vor fieberhafter Nervosität mit zitternden Händen ununterbrochen den Sicherungsflügel an seinem Karabiner hin und her … Das also war die heldenhafte Feuertaufe, von der man in der Ausbildung so gern gesprochen hatte. Aber in ihrer gräßlichen Realität erweckte sie nun bei keinem von uns auch nur im Entferntesten einen Gedanken an Heldentum.
Nach grausam langen zwanzig Minuten hörte dann endlich das schreckliche Trommelfeuer wieder auf. Raus aus dem Granattrichter – aber die zittrigen Beine waren schwer wie Blei, der ganze Körper bebte. Doch wir rannten zur Küste. Aber nun jagten uns die Jabos wie die Hasen von Granattrichter zu Granattrichter. Dabei wurde die ohnehin schon stark dezimierte Schwadron noch mehr reduziert. „Flink wie die Windhunde“ rannten wir vorwärts und sprangen in die vom Granatbeschuß eingedrückten und teilweise halb verschütteten Schützengräben (des mir bis dahin unbekannten Widerstandsnestes 66) auf der etwa vierzig Meter hohen Küstenanhöhe über dem Strand. Überall lagen die reglosen Körper gefallener deutscher Soldaten. Die hellblauen, beißenden Rauchschwaden brennender Ginstersträucher trieben einem die Tränen in die Augen. Dann sahen wir auf dem Meer eine unvorstellbare Schiffsansammlung. Es war eine einzige durchgehende schwarze Mauer aus Schiffen. Sie wirkte auf mich furchterregend, aber großartig – schaurig großartig. Es war fast 10 Uhr.
Wir lagen nahe des Strandes, völlig auf uns allein gestellt. Ich hatte, was einen deutschen Endsieg betraf, zum erstenmal Bedenken und kam mir angesichts dieser enormen Überlegenheit geradezu nackt vor. Wie sollten wir uns gegen diese Masse dort draußen wehren? Was sollte ich da mit meinem Karabiner ausrichten? Ich hatte noch nicht einmal eine Handgranate dabei. Die Flut war bereits beim Auflaufen und schob in ganzer Breite blutigen Schaum vor sich her – so als reinige sie eine riesige Schlachtbank (der Angriff hatte bereits um 6:30 Uhr begonnen). Mit der steigenden Flut trieben auch die vielen Toten immer näher, und zwischen ihnen konnte ich die Köpfe mit den Stahlhelmen noch lebender Soldaten erkennen – es waren Amerikaner.
Einer von Tausenden amerikanischer Gefallener am US-Landeabschnitt „Omaha Beach“, den die GIs schon bald „Bloody Omaha“ nannten …
Dann näherten sich Massen vollbesetzter Landungsboote dem bereits mit Menschenkörpern übersäten Strand. Etwa acht bis zehn Boote fuhren direkt auf meinen Strandabschnitt zu, und ich richtete meinen Karabiner auf eine ihrer großen Frontklappen. Meine Hände zitterten, als sie den automatischen K44 (Karabiner, Modell 1944, mit 10 Schuß Ladevermögen) hielten. Als das Boot auf den Strand auflief und seine Klappe herabfallen ließ, begann ich zu schießen, drückte zehnmal ab – und sah, wie die Soldaten, von meinen Kugeln getroffen, zusammenbrachen. Sobald die Rampen der Landungsboote herunterfielen, eröffneten auch die Maschinengewehrschützen wieder ihr grauenhaftes Feuer und verschlimmerten noch das furchtbare Blutbad am Strand. Erschüttert sah ich die mit ihren Ausrüstungen schwer bepackten Amerikaner von den Rampen der Boote ins Meer fallen und versinken. Für einen Moment wallte ein schreckliches Schuldgefühl in mir auf, aber ich mußte es bezwingen, mußte mir sagen, daß ja Krieg war, daß auch jene, die da unten am Strand ankamen, ebenfalls in uns ihre Gegner sahen und uns töten würden …
Viele GIs suchten in ihrer Angst und Panik hinter den Strandhindernissen Schutz, doch war dieses Verhalten das falscheste, das sie tun konnten, denn sie boten somit den Gewehrschützen die Möglichkeit für gezieltes Schießen. Was nun begann, kam mir vor, wie das Zielschießen auf dem Übungsplatz …
Es dauerte nicht lange, bis der mehrere hundert Meter breite Strand vor meinem Abschnitt von Verwundeten und Toten übersät war. Näher zum Land lag am Strand ein Toter auf dem anderen, und wenn die nächsten GIs kamen und versuchten, darüber zu springen, wurden sie ebenfalls niedergeschossen. Unentwegt krepierten die Granaten des deutschen Artillerie-Sperrfeuers aus den rückwärtigen Batterien und den Kasematten der Widerstandsnester auf dem Strand, schleuderten die Toten und die Lebenden umher und rissen sie in Stücke.
Amerikanische Opfer des Massakers am Strand – zusammengeschossen, ertrunken und zerrissen …
Ich hatte Angst, und es war mir ganz egal, wo unsere deutschen Geschütze standen, nur weiterfeuern sollten sie. Dort, wo der Vorstrand zum Strand abfiel, gab es einen nur wenig mehr als einen Meter hohen Kieswall, und dieser war das erste wichtige Ziel der Amerikaner, denn nur dahinter konnten sie etwas Deckung vor unseren Geschossen finden.
Im Laufe des Vormittags ließ die Feuerkraft der deutschen Geschütze deutlich nach, und die Angreifer überwanden ihren anfänglichen Schock und stürmten in Gruppen die schrägen Hänge der Küste empor. Hoffnungsvoll blickte ich immer wieder zum Himmel auf, erwartete sehnlichst das Eingreifen unserer Luftwaffe. (Aber weder die deutsche Luftwaffe noch die Kriegsmarine griff am 6. Juni 1944 effektiv in dieses Inferno ein.)
Irgendwann stellte ich erschreckt fest, daß mir die Munition ausgegangen war. Ich griff dem neben mir liegenden Kameraden an die Schulter, um ihn um Munition zu bitten – doch ich faßte in eine klaffende Wunde voller dickem Blut. Ein größerer Granatsplitter war durch seine Schulter in den Körper eingedrungen. Erschüttert drehte ich ihn etwas zur Seite, um an seine Patronentasche zu gelangen. Er benötigte ja keine Munition mehr … Dennoch hatte ich das Gefühl, ihm durch das Herumdrehen weh zu tun. Dann lud ich mit blutigen Händen zehn Patronen nach und schoß wieder auf die näherkommenden Amerikaner.
Plötzlich lief ein GI direkt auf mich zu. Mit zittrigen Händen zielte ich auf seine Brust und schoß. Der Amerikaner blieb abrupt stehen und ließ sein Gewehr fallen, sackte auf die Knie, nahm ganz langsam den Helm ab und legte ihn zu seinem Gewehr. Dann schaute er zum Himmel auf, bekreuzigte sich – und fiel vornüber aufs Gesicht. Ich dachte, wie kann ein Mensch nur so fromm sein und an Gott im Himmel glauben; für mich war Hitler mein Gott – bis zu diesem Augenblick …
Gegen 14 Uhr übertönte eine gewaltige Explosion den Schlachtenlärm in der sechs Kilometer breiten Bucht. (Später erfuhr ich, daß die Amerikaner eine sich über die gesamte Breite des Taleingangs vor St. Laurent hinziehende dicke und jedes Eindringen des Gegners ins Hinterland vereitelnde Panzermauer gesprengt hatten.)
Bereits kurz nach der Sprengung änderte sich die Situation. Unaufhaltsam drangen die Amerikaner nun in das flache Tal und kamen die Straße zum Hinterland herauf. Noch immer vernahm ich deutsches MG- und Gewehrfeuer – aber es wurde schon bald schwächer. Dann begannen kleine Gruppen der GIs die schrägen Küstenabhänge zu ersteigen.
Wir paar noch lebende Soldaten pflanzten die Seitengewehre (Bajonette) auf und liefen den Amerikanern mit lautem Geschrei entgegen. Während unserer Ausbildung hatte man uns gesagt, daß Schreien dem Gegner Furcht einflöße – so habe ich geschrien wie ein wildes Tier.
Mitten in das schreckliche Gemetzel rief dann irgendwann jemand: „Absetzen zur Küstenstraße!“
Wie gelernt gaben wir uns gegenseitig Feuerschutz bis zurück zur nahen Küstenstraße. Mit von Angst und Schmerz verzerrten Gesichtern sammelte sich nun der klägliche Rest unserer Einheit in einem Straßengraben. Es waren noch nicht einmal mehr als vier Dutzend Kameraden, völlig erschöpft vom ersten langen Kampftag der Invasion.
Von nun an begann der Krieg in den Hohlwegen der Bocage (Dickicht der Normandie) – und von nun an begann auch ich zu Gott im Himmel zu beten. Die Erdwälle mit ihren dichten Hecken, der von Efeu umrankten Bäume und hohen Natursteinmauern boten zwar etwas Schutz gegen die Jabos, verhinderten aber jede weite Sicht. In diesem Gelände wußte man nie, ob irgendeine Gefahr hinter dem nächsten Busch lauerte; ein Umstand, der uns ständig in Anspannung versetzte. Am Tag war ein Überleben nur möglich, wenn man sich durch geschickte Tarnung im Gelände versteckte. Jeder Versuch, bei Tageslicht einen Angriff durchzuführen, wurde bereits in den Anfängen durch die massenhaft umherfliegenden Jabos zerschlagen. Ich war froh, wenn uns Regen oder Dunkelheit diese heulenden und rasenden Teufel fern hielten. Nachts konnten wir einen Spähtrupp ausschicken, oder einen Stoßtrupp durchführen, ohne dabei in den Himmel sehen zu müssen, ob wieder Tiefflieger im Anflug waren. Die Nacht war unsere Stärke, das wußten auch die Amerikaner. Da wurde manches Himmelfahrtskommando erfolgreich unternommen. Doch schon im Morgengrauen verloren wir diesen herrlichen Mantel der Sicherheit wieder und wurden unbarmherzig einer geballten und weit überlegenen Macht an Kriegsmaterial ausgeliefert. Wie armselig fühlte ich mich dagegen mit meinem Karabiner in der Hand, für den ich mir auch noch andauernd die nötige Munition von gefallenen Kameraden holen mußte. In unserem verlorenen Haufen schleppten wir noch drei leichte 5-cm-Granatwerfer mit, mußten aber nach jedem Abschuß der zweiten Granate schnellstens einen Stellungswechsel vornehmen, um vom Gegner nicht gezielt beschossen zu werden. Wir konnten noch nicht einmal einen Vorgeschobenen Beobachter einsetzen, da er spätestens hinter dem nächsten Erdwall in Gefangenschaft geraten wäre.
Bei den Kämpfen in der Bocage gefallene deutsche Soldaten in einem der vielen Hohlwege.
Unstimmigkeit herrschte auch in der Befehlsgebung von höchster Stelle, da man dort ohne die nötige Luftaufklärung nur unzureichende Anweisungen an die Truppen erteilen konnte. So kam es, daß unser armseliger Rest unter der Führung eines jungen Leutnants ständig hin und her kommandiert wurde. In diesem Wirrwarr von zum Teil widersprüchlichen Befehlen bezogen wir am 7. Juni nahe Caen, beim alten Kloster Ardenne, Stellung und erlebten dort die Panzerschlacht mit den Kanadiern. Kurt Meyer, Kommandeur des SS-Panzergrenadier-Regiments 25, leitete den Angriff der deutschen Panzer vom Turm des Klosters aus. Doch was anfangs so hoffnungsvoll begann, endete in einer verlustreichen Niederlage.





























