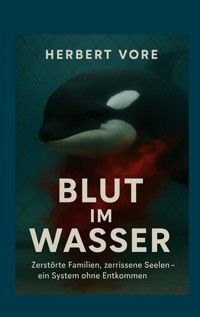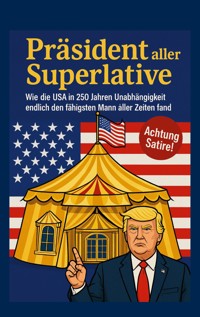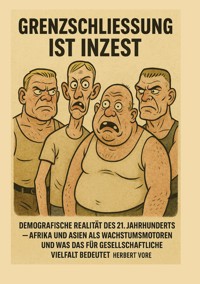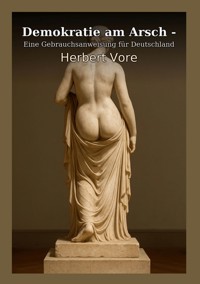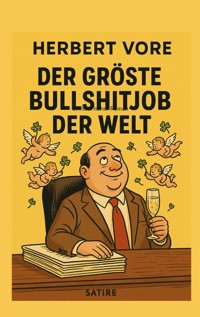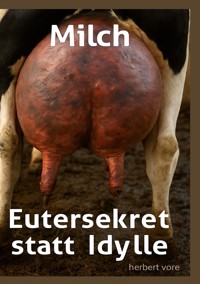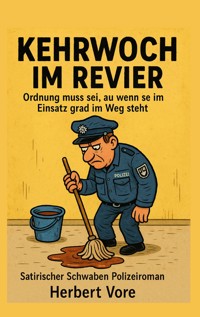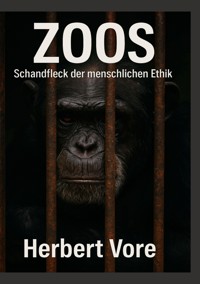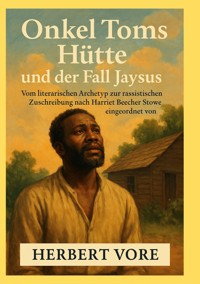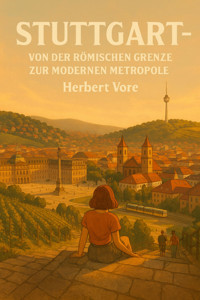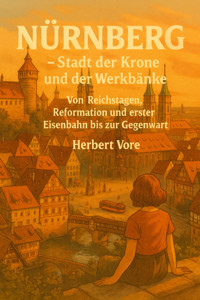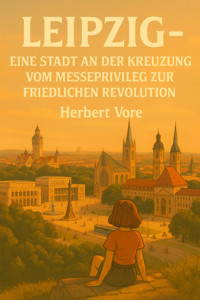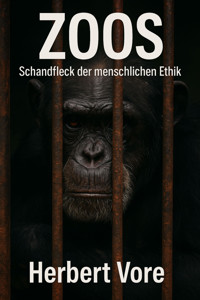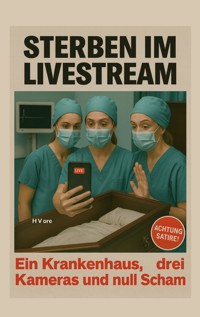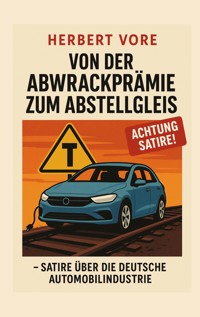
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Abwrackprämie zum Abstellgleis; Satire über die deutsche Automobilindustrie Einst galt die deutsche Automobilindustrie als Synonym für Präzision, Ingenieurskunst und Weltruhm. Heute ist sie ein Paradebeispiel für Selbstüberschätzung, Lobbyismus und verschlafene Innovation. Abgasskandal, Abwrackprämie, CSU-Verkehrsminister im Dauerabo, milliardenschwere Maut-Debakel und das ewige Mantra vom Clean Diesel: Die Liste der Skandale ist länger als jede Autobahnbaustelle. Dieses Buch erzählt satirisch, bissig und mit bitterem Humor vom Niedergang einer Branche, die ihre Zukunft an China und Tesla verschenkt hat und dabei glaubt, mit PowerPoint-Präsentationen und Umweltprämien weiter an der Spitze zu stehen. Herbert Vore seziert mit spitzer Feder die absurdesten Momente der jüngeren Automobilgeschichte: von der Dieselsoftware, die sauberer atmet als ein Hochgebirgsbach, bis hin zur Elektro Offensive, die mehr Ladehemmung als Ladeleistung hat. Ein Buch für alle, die schon immer ahnten, dass in Deutschland zwar das Auto erfunden wurde; aber auch sein Untergang. Satire, Sarkasmus und Ironie machen dieses Werk zu einem unterhaltsamen Spiegel unserer Gegenwart. Es ist nicht nur eine Abrechnung mit einer Industrie, sondern auch mit einer Politik, die Stillstand als Verkehrspolitik verkauft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 77
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 – Abgas, Ablass, Abwrack
Kapitel 2 – Dieselgate – Als Betrug zur Softwarefunktion wurde
Kapitel 3 – Thermofenster – Wenn Motorschutz zur Ausrede wird
Kapitel 4 – Fahrverbote & Feinstaub – Von Stuttgart lernen heißt schwitzen
Kapitel 5 – Kartellchen gefällig?
Kapitel 6 – Dieselgipfel: Wenn die Einladungsliste die Lösung ist
Kapitel 7 – Die CSU-Maut: Pay-per-Use ohne Use
Kapitel 8 – Aufsicht mit Parkschein: KBA & Co
Kapitel 9 – BYD, das Akkukraftwerk auf Rädern
Kapitel 10 – Vom Export zum Standort: Wenn die Werft gleich dem Werk gehört
Kapitel 11 – Europa antwortet mit Zöllen
Kapitel 12 – Cariad und Co: Wenn Bits die Karosserie schrammen
Kapitel 13 – Trinity, das Projekt der immernächsten Generation
Kapitel 14 – China-Comebackpläne: Jetzt mit Assistenzhirn
Kapitel 15 – Rechtliche Nachbeben
Kapitel 16 – Monkeygate und Ethik
Kapitel 17 – Daimler-Komplex: Rückrufe, Bußgelder, Verfahren
Kapitel 18 – Batterien sind die neuen Motoren
Kapitel 19 – Software-First oder der letzte Premiumrabatt
Kapitel 20 – Preispunkt-Revolution
Kapitel 21 – Industriepolitik mit Zielkorridor
Kapitel 22 – Lieferketten, die reißen wie Zahnriemen
Kapitel 23 – Zukunft aus der Hochglanzbroschüre
Kapitel 24 – Verbraucher im Dauerstau der Entscheidungen
Kapitel 25 – Internationale Konkurrenz auf der Überholspur
Kapitel 26 – Batterien, Rohstoffe und die unbequeme Wahrheit
Kapitel 27 – Autonomes Fahren: Die ewige Probefahrt
Kapitel 28 – Gewerkschaften im Rückwärtsgang
Kapitel 29 – Marketingmärchen auf vier Rädern
Kapitel 30 – Ende Gelände: Der letzte deutsche Traum auf Rädern
Nachwort – Rückspiegel einer Nation
Vorwort
Deutschland, das Land der Dichter, Denker und Diesel – so erzählte man es sich einst am Stammtisch und in den Vorstandsetagen. Unsere automobile Erfolgsgeschichte war ein Mythos von Weltrang: Volkswagen war Volksgut, Mercedes der rollende Beweis deutscher Ingenieurskunst, BMW die Verkörperung von Fahrfreude. Jahrzehntelang galt: Solange irgendwo ein Zylinder brummt, ist der Wirtschaftsstandort sicher.
Doch die Welt drehte sich weiter – und wir hielten an der roten Ampel der Geschichte. Während China den Stecker zog und die Zukunft an die Ladesäule hängte, zelebrierte Deutschland noch die Kunst des Thermofensters und der Abgasrückführung. Der vielgepriesene „Vorsprung durch Technik“ verwandelte sich in ein Warteschleifenmantra: Bitte haben Sie Geduld, Ihr Update verzögert sich um ein Jahrzehnt.
Dieses Buch ist keine trockene Chronik, sondern ein satirisches Protokoll des wohl größten kollektiven Versagens einer Industrie, die glaubte, dass Lobbyarbeit ein Ersatz für Innovation sei. Wir blicken zurück auf Abgas-Skandale, auf Abwrackprämien, auf Maut-Debakel und auf Verkehrsminister, die ihre Amtszeit als Experimentierfeld für Geduld und Steuergelder verstanden. Wir untersuchen Kartellabsprachen, die man freundlich als „Kooperationsprojekte“ verkaufte, und Behörden, die beim Wegsehen fast einen Sehschaden riskierten.
Und wir blicken nach vorne: auf eine Welt, in der chinesische Hersteller wie BYD, Nio und Geely die Standards setzen, während deutsche Autobauer hektisch versuchen, das Passwort zur Zukunft wiederzufinden. Die Pointe: Wenn die Straße sich nach links gabelt, hilft es nicht, rechts zu blinken und trotzdem geradeaus ins Feld zu fahren.
Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf Trost – sondern auf Aufklärung mit einem Augenzwinkern. Es ist eine Mischung aus Fakten und Spott, aus juristisch belastbaren Skandalen und humoristischer Übersetzung. Denn manchmal lässt sich die Absurdität der Realität nur in Satire übersetzen.
Willkommen also auf einer Fahrt durch Schlaglöcher, Ausreden und Milliardenabschreibungen. Anschnallen ist Pflicht – Airbags für das Zwerchfell sind inklusive.
Herbert Vore
Kapitel 1 – Abgas, Ablass, Abwrack
Es gibt Momente, in denen ein Staat die eigene Bevölkerung behandelt wie ein Autohaus seine Stammkundschaft: mit einem freundlichen Lächeln, einem kleinen Rabatt und der stillen Hoffnung, dass keiner so genau nachrechnet. Das Jahr 2009 war so ein Moment. Die Finanzkrise hatte die Absatzkurven der deutschen Automobilindustrie in die Notaufnahme verfrachtet, die Produktion stockte, die Neuwagen standen wie unverkaufte Brötchen von vorgestern auf den Höfen.
Die Lösung der Bundesregierung hieß „Umweltprämie“. Ein Name so sauber poliert wie die Windschutzscheiben der Neuwagen, die damit finanziert wurden. Faktisch war es eine Einladung zum Wegwerfen: Wer seinen alten Wagen verschrotten ließ, bekam 2.500 Euro für den Kauf eines neuen. Ursprünglich waren 1,5 Milliarden Euro eingeplant, doch der Topf wuchs rasch auf fünf Milliarden an, weil die Nachfrage explodierte – am Ende wurden knapp zwei Millionen Autos verschrottet. Die Umwelt jubelte offiziell mit, auch wenn sie inoffiziell am Auspuff stand und hustete.
Satirisch betrachtet war die „Abwrackprämie“ nichts anderes als eine Art staatlich organisierter Ablasshandel: Wer seinen alten Diesel opferte, kaufte sich mit blankem Gewissen frei. Klimaschutz war plötzlich eine Frage der Zulassungspapiere. Anstatt den Umstieg auf zukunftsfähige Technologien zu fördern – etwa auf Elektroautos, die es damals zwar gab, aber in der Nische eines vergessenen Katalogs vegetierten –, belohnte der Staat vor allem den Kauf weiterer Verbrenner. Ein Meisterstück: So konnte man sich gleichzeitig als Retter der Industrie und als Umweltengel feiern lassen.
Das Schönste daran: Der Name „Umweltprämie“ war so geschickt gewählt, dass sich kaum jemand traute, laut zu lachen. Wer will schon gegen die Umwelt sein? Doch hinter den Kulissen hatte diese Maßnahme so viel mit Nachhaltigkeit zu tun wie ein Big Mac mit Ayurveda.
Natürlich war das Ganze rechtlich sauber, politisch clever und ökonomisch wirksam – kurzfristig. Die Autoindustrie konnte ihre Halden leeren, Zulieferer bekamen Luft, und die Regierung konnte stolz verkünden, dass Deutschland die Krise gemeistert habe. Doch wie bei jeder Abwrackaktion blieb ein kleiner, aber feiner Restmüll: Millionen funktionsfähiger Fahrzeuge landeten auf dem Schrott, Ressourcen wurden verschwendet, und die eigentliche Zukunftstechnologie – Elektromobilität – bekam kein einziges Milliardlein aus dem großen Topf.
Man könnte sagen, das war der erste echte Crashkurs in deutscher Auto-Politik: Wenn es ernst wird, setzen wir nicht auf Innovation, sondern auf Incentives. Statt Ladestationen baute man Luftschlösser. Und während deutsche Politiker und Manager Schulter an Schulter stolz die Erfolge der Prämie verkündeten, tüftelten chinesische Ingenieure bereits daran, wie man Batterien nicht nur im Labor, sondern auch im Massenmarkt salonfähig macht.
Rückblickend wirkt die Abwrackprämie wie eine verspätete Geburtstagsfeier für eine Industrie, die längst ins Rentenalter gekommen war: Man schenkte ihr Geld, statt ihr zu sagen, dass sie sich endlich neue Schuhe kaufen sollte, um mit der Zukunft Schritt zu halten.
Satirisch zugespitzt: Deutschland hat damals nicht den Weg ins Elektrozeitalter abgebogen – wir haben den Blinker rechts gesetzt, links geschaut und sind dann im Kreisverkehr der Verbrenner noch eine Ehrenrunde gefahren.
Kapitel 2 – Dieselgate – Als Betrug zur Softwarefunktion wurde
Manchmal schreibt sich Geschichte nicht in großen Revolutionen, sondern in unscheinbaren Codezeilen. Bei Volkswagen hieß sie: „Defeat Device“. Eine kleine Softwarefunktion, unscheinbar, aber wirkungsvoll – auf dem Prüfstand lief der Motor mit aller Abgasreinheit, im Alltag dagegen mit voller Kraftentfaltung. Ein Algorithmus, der Prüfsituationen erkannte und die Abgasreinigung nur dann einschaltete, wenn der Wagen gerade in der Rolle des Musterschülers glänzen musste. Auf der Straße dagegen war Schluss mit Saubermann, dort durfte Stickoxid wieder in Mengen ausströmen, die nicht einmal die optimistischste PR-Abteilung schönreden konnte.
Am 18. September 2015 platzte die Bombe. Die amerikanische Umweltbehörde EPA schickte eine formale „Notice of Violation“ – und plötzlich stand ein ganzer Konzern als Synonym für Industrieskandal da. Elf Millionen Fahrzeuge weltweit waren betroffen, allein in Europa über acht Millionen, davon rund zweieinhalb Millionen in Deutschland. Werkstätten verwandelten sich in Reparaturzentren für Imagepflege, Software-Updates wurden zur neuen Sakramentenspendung, und so mancher Motor bekam noch ein Strömungsgitter als technisches Feigenblatt.
In den USA war man weniger zimperlich. Dort rechnete der Rechtsstaat in Dollar. Zuerst der große Vergleich 2016 über bis zu 14,7 Milliarden – Rückkäufe, Nachrüstungen, Umweltfonds. Dann 2017 das Schuldbekenntnis von Volkswagen und weitere 4,3 Milliarden Strafzahlungen. Summa summarum ein Preis, mit dem man auch eine Handvoll Batteriefabriken hätte bauen können. In Europa lief alles nüchterner, aber nicht minder teuer. Rückrufe, Sammelklagen, Urteile. 2023 erhielt Ex-Audi-Chef Rupert Stadler eine Bewährungsstrafe, 2025 folgte das Landgericht Braunschweig mit Verurteilungen mehrerer Ex-Manager wegen Betrugs. Verantwortung hat eben keinen Off-Schalter.
Die Kosten summierten sich auf über 31 Milliarden Euro – Stand 2020, Tendenz steigend. Eine Summe, die für Forschung und Entwicklung in Elektromobilität wohl ganze Dekaden hätte finanzieren können. Stattdessen wanderte sie in Anwaltskanzleien, Vergleichstöpfe und Rückkaufprogramme.
Technisch betrachtet war Dieselgate eine Meisterleistung – allerdings in der falschen Disziplin. Prüfstandserkennung über Lenkwinkel, Geschwindigkeit, Laufzeiten: hochintelligent, aber zweckentfremdet. Satirisch gesagt: wie ein Sportler, der nur dann trainiert, wenn der Trainer hinschaut. Juristisch dagegen eindeutig: unzulässige Abschalteinrichtungen, wie der EuGH später klarstellte.
Doch Dieselgate war mehr als ein Softwaretrick. Es war ein kulturelles Symptom. Statt die Zukunft aktiv zu entwickeln, verstrickte sich die Branche in Kartellabsprachen, Lobbyarbeit und juristische Winkelzüge. 2021 verhängte die EU-Kommission gegen BMW und Volkswagen 875 Millionen Euro Strafe wegen Absprachen bei Abgasreinigungstechnologien. Daimler entkam nur, weil man als Kronzeuge schneller sang als die anderen.
Die Folgen spürten vor allem die Städte. Stickoxidgrenzwerte wurden gerissen, Verwaltungsgerichte erzwangen Fahrverbote, der Druck auf Politik und Industrie stieg. Plötzlich war die Frage nicht mehr, wie sauber ein Diesel sein konnte, sondern ob er überhaupt noch eine Zukunft hatte.
Das eigentlich Bittere aber ist der Zeitverlust. Während Deutschland in Schadensersatz und Imagekampagnen investierte, bauten China und die USA an Batteriefabriken, Softwareplattformen und Ladeinfrastruktur. Ausgerechnet jene Jahre, in denen man den Anschluss an die Elektromobilität hätte schaffen können, verbrannte man im juristischen Dauerfeuer.
Dieselgate steht damit für eine doppelte Illusion: die Illusion, dass Technik die Naturgesetze überlisten könne, und die Illusion, dass Kommunikation alles schönredet. In Wahrheit aber hat sich herausgestellt: Stickoxide lassen sich nicht wegdiskutieren, Gerichte nicht wegverhandeln und Marktanteile nicht wegklagen.
Satirisch zugespitzt war Dieselgate die teuerste Nachhilfelektion der