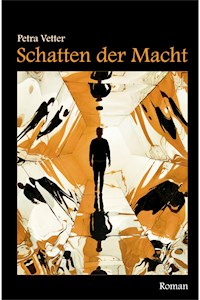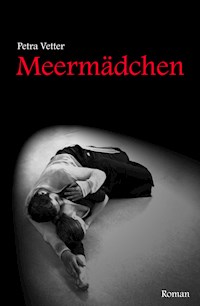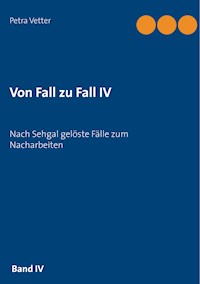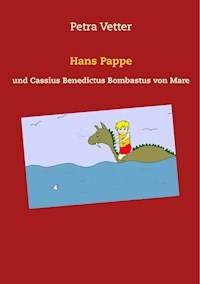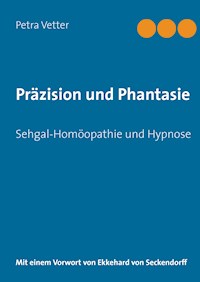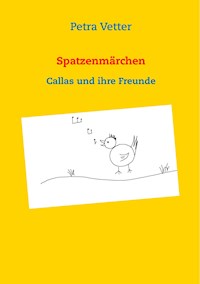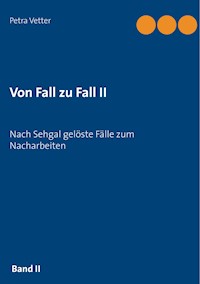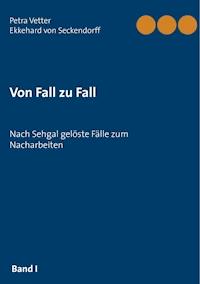
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Von Fall zu Fall
- Sprache: Deutsch
Dieses Exemplar stellt den ersten Band einer Schriftenreihe dar, deren Ziel es ist, die Einarbeitung in die homöopathische Arbeit nach SEHGAL zu erleichtern. Es beginnt mit dem theoretischen Teil zu den Grundlagen dieser Methode, deren präzise Anwendung den Homöopathen oft gradlinig zum heilenden Arzneimittel führen kann. Die darauf folgenden gelösten Fälle bieten Übungsmöglichkeiten, die den speziellen Umgang mit den Gemütsrubriken der Repertorien vertraut werden lässt. Ein kurzer Abriss der jeweils verordneten Arzneimittel - im vorliegenden Band Belladonna, Hyoscyamus, Ignatia, Lachesis, Phosphorus, Rhus toxicodendron und Triticum vulgare - gibt einen kurzen Überblick über deren wichtige Gemütsrubriken. Außerdem wird in jedem Band ein Thema in einem ausführlicheren Beitrag behandelt. Diesmal >Das Drama in und um Hyoscyamus<.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Körper
ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare
Christian Morgenstern
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Vorbemerkung
Theorie
Philosophie
Anamnese nach SEHGAL
Der vorurteilslose Beobachter
Gemütszustand versus Konstitution
King-pin-Symptome
Single-Rubriken
Potenzen
Fallmanagement
Fallbeispiele
Schneller Durch-Fall
Bearbeitung
Bingo scheut
Bearbeitung
Ulla hustet
Bearbeitung
Elsas rechter Fuß schmerzt
Bearbeitung
Ende der Fahnenstange
Bearbeitung
Schule - übel
Bearbeitung
Es geht ums Geschäft
Bearbeitung
Zum Thema: Die Tragik um und in Hyoscyamus
Arzneimittel
Belladonna
Hyoscyamus
Ignatia
Lachesis
Phosphorus
Pulsatilla
Rhus toxicodendron
Triticum vulgare
Rubrikentraining mit Witz
Schlussbemerkung
Literatur
VORWORT
Homöopathen gleich welcher Richtung sind ständig auf der Suche nach dem Simillimum, dem Arzneimittel, das deutlich und nachhaltig den Organismus des jeweiligen Patienten in Richtung Heilung dreht.
Wir sind sehr dankbar, dass wir in diesem ständigen Bemühen auf das Denkmodell gestoßen sind, das M.L. SEHGAL begründete und dass wir damit das Glück ein Simillimum zu finden, nun häufiger erleben dürfen.
Natürlich – auch andere Strategien führen oft zu einem sehr guten Ergebnis, doch die intensive Erforschung des Gemütszustandes des Patienten und die Umsetzung in die entsprechenden Repertoriums Rubriken haben unsere Erfolgsquoten kräftig erhöht.
Die homöopathische Arbeit nach SEHGAL führt sehr oft zu heilenden Arzneimitteln, die mit anderen Strategien kaum zu finden sind. So gehören z.B. Opium, Hyoscyamus oder Stramonium zu unseren meistverordneten Polychresten. Mittel, die sonst eher Extremsituationen vorbehalten sind, helfen „normalen“ Durchschnittspatienten.
Die ausschließliche Betrachtung und Auswertung des Gemütszustandes des Patienten erfordert außer einer besonderen Anamneseart, eine genaue Kenntnis und ein grundlegendes Verständnis der Gemütsrubriken.
Darüber hinaus erlauben Interpretationen der Gemütsrubriken ihren Einsatz in alltäglichen Situationen. Berühmtes Beispiel dafür ist die Rubrik >Furcht - Extravaganz, vor<. Wir können uns kaum einen Patienten vorstellen, der in die Praxis kommt und über eine schreckliche Furcht vor Extravaganz klagt.
Aber M.L. SEHGAL hat diese Rubrik nutzbar gemacht, in dem er sie als >Furcht eine innere Grenze zu überschreiten< deutete. Diese Grenze kann die Dauer der Beschwerden betreffen („Eine Woche lang Husten lasse ich mir ja gefallen. Aber zwei Monate? Da muss jetzt etwas passieren!“) oder andere, recht übliche Situationen („Es macht mir nichts aus, immer mal im Haushalt meiner Oma nach dem Rechten zu sehen. Aber jetzt soll ich auch noch den Garten übernehmen. Was zuviel ist, ist zuviel!“)
Diese Interpretationen muss man von den SEHGALS lernen oder sich selbst erarbeiten (s. Lang/ Seckendorff, 2007). Sie bringen Rubriken zum Einsatz, die sonst eher selten oder fast nie angewandt werden.
Die in diesem ersten Band dargestellten nach SEHGAL gelösten Fälle stellen Übungsmöglichkeiten dar, die meist auch schon im Internetarbeitskreis www.forum.seckendorff.org genutzt worden sind. Wir wissen daher, dass es oftmals recht schwierig ist, in einem schriftlichen Fall die zielführenden Rubriken zu finden. Bitte lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Im wirklichen Leben erhalten Sie während einer Anamnese durch Stimmlage, Gesten und Benehmen des Patienten ungleich viel mehr Informationen, als in einem solchen „Papierfall“.
Dieses Exemplar stellt den ersten Band einer Schriftenreihe dar, deren Ziel es ist, die Einarbeitung in die homöopathische Arbeit nach SEHGAL zu erleichtern.
Petra Vetter
Ekkehard von Seckendorff
VORBEMERKUNG
Empfehlungen und Ratschläge wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Garantie kann es jedoch nicht geben. Eine Haftung der Autoren und des Verlages ist ausgeschlossen.
Patientendaten wurden anonymisiert. Namen und Orte wurden verändert. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit gleichnamigen Personen auftreten, so sind sie rein zufällig.
Geschlechtsneutrale Formulierungen sind recht umständlich. Daher wurde der Einfachheit halber meist die männliche Form gewählt. Dies soll niemanden diskriminieren.
Die erwähnten Gemütsrubriken stammen aus folgenden Computer- Repertorien von Radar 10:
Synthesis 9,1 – nicht gekennzeichnet
Complete 2002 – (C)
Murphy 3 – (M).
Die Schreibweise wurde beibehalten.
Spezielle SEHGAL- Rubriken wurden mit (S) gekennzeichnet.
Zitate wurden in ihrer Schreibweise unverändert übernommen.
Abkürzungen:
EvS: Ekkehard von Seckendorff
PV: Petra Vetter
P: Patient/in
NeuRep: (Lang, Eva
:
Das Neue Repertorium Homoeopathicum, Eva Lang, Worpswede 2005)
Das Kapitel „
Theorie
“ wurde bereits 2014 veröffentlicht (S. Vetter, Petra, 2014, S.21 - 51
Der Artikel „Die Tragik um und in Hyoscyamus“ wurde im Journal des Vereins der Homöopathischen Ärzte, Januar 2007, publiziert.
THEORIE
Philosophie
Zunächst einmal – M.L. SEHGAL kam nicht auf seine neue Methode, weil er sich die Arbeit erleichtern wollte, sondern weil er in einem schwierigen, symptomenarmen Fall nicht weiter kam. In Bd. VII seines Werkes „Die Wiederentdeckung der Homöopathie“ beschreibt er, wie ein zehnjähriger Junge schwer unter Malaria litt. Das einzige feststellbare Symptom war, dass der Junge in Stupor verfiel, wenn das Fieber die 400- Grenze überschritt. Die sonst üblichen Malariasymptome wie Knochenschmerzen, Schüttelfrost oder Schweiß tauchten nicht auf.
Die Arzneimittel der Rubrik >Allg.- Schmerzlosigkeit, bei Beschwerden< Helleborus, Stramonium und Opium brachten keinerlei Erleichterung. Da die Lage des Jungen immer kritischer wurde – das Fieber stieg auf 41,50 – nahm M.L. SEHGAL ihn bei sich auf, um ihn ausgiebig und in Ruhe beobachten zu können. Dabei fiel ihm auf, dass der Junge sich nie beklagte. Auf Fragen, wie es ihm gehe, immer mit „gut“ antwortete und auch an fieberfreien Tagen im Bett blieb. Ansonsten interessierte ihn nichts – er machte keinerlei Probleme.
Diese Beobachtungen führten zu drei Rubriken:
Bett bleiben, möchte im
(bed, remain in desires to)
Gleichgültigkeit, klagt nicht
(indifference, does not complain)
Gesund zu sein, behauptet trotz schwerer Krankheit
(well, says he is, when very sick).
Hyoscyamus ist das einzige Mittel, das sich in diesen drei Rubriken findet, und es wirkte Wunder. Es gab noch drei weitere Fieberanfälle mit jeweils geringeren Temperaturen; anschließend blieb die Körpertemperatur normal.
Als kurz darauf noch ein weiterer Malariafall auf die beschriebene Art gelöst werden konnte, war M.L. SEHGAL überzeugt, einen revolutionären neuen Zugang zur homöopathischen Arzneimittelfindung entdeckt zu haben. Zunächst wandte er diese neue Methode nur bei Malariafällen an, später weitete er sie aus und beschrieb seine grundsätzlichen Überlegungen dazu.
Auch für M.L. SEHGAL blieb SAMUEL HAHNEMANN das Fundament. In § 211 Organon heißt es:“
Dieß geht so weit, daß bei homöopathischer Wahl eines Heilmittels, der Gemüthszustand des Kranken oft am meisten den Ausschlag giebt, als Zeichen von bestimmter Eigenheit, welches dem genau beobachtenden Arzte unter allen am wenigsten verborgen bleiben kann.“ Und in den „Chronischen ‚Krankheiten“ schreibt er:
„Doch oft schon etwas grobe Diätsünden, eine Verkältung, der Zutritt einer vorzüglich rauhen, naßkalten oder stürmischen Witterung, so wie der (auch noch so milde) Herbst, besonders aber der Winter und der winterliche Frühling, dann eine heftige Anstrengung der Körpers oder Geistes, besonders aber die Gesundheits-Erschütterung durch eine äußere, große Beschädigung, oder ein sehr trauriges, das Gemüth beugendes Ereigniß, öfterer Schreck, großer Gram und Kummer und anhaltende Ärgerniß (Hervorhebung durch die Autorin) brachten oft, (wenn die Anscheinend geheilte Krankheit eine schon weiter entwickelte Psora zum Grunde gehabt hatte, oder) bei einem geschwächten Körper, gar bald wieder das eine oder mehre der schon besiegt geschienenen Leiden, auch wohl mit einigen ganz neuen Zufällen verschlimmert, hervor, welche, wo nicht bedenklicher, als die vordem homöopathisch beseitigten, doch oft eben so beschwerlich und nun hartnäckiger waren.“(S. Hahnemann, 2000, S.1).
Doch die häufigste Aufregung der schlummernden Psora zu chronischer Krankheit, so wie die häufigste Verschlimmerung schon vorhandner chronischer Übel im Menschen-Leben entsteht von Gram und Verdruß.
Ununterbrochner Kummer oder Ärgerniß erhöhet ja selbst die kleinsten Spuren noch schlummernder Psora gar bald zu größern Symptomen und entwickelt sie dann unvermuthet zum Ausbruche aller erdenklichen chronischen Leiden gewisser und öfterer, als alle andere nachtheilige Einflüsse im gewöhnlichen Menschen-Leben auf den Organism, wie denn beide eben so gewiß und oft die schon vorhandnen Übel verstärken.
So wie der gute Arzt sich’s schon zum Vergnügen macht, zur Beförderung einer nicht mit solchen Hindernissen befangenen Kur zu veranstalten, daß das Gemüth des Kranken möglichst erheitert und Langweile von ihm abgehalten werde, so wird er auch hier um so mehr die Verpflichtung in sich fühlen, alles anzuwenden, was in dem Bereiche seines Einflusses auf den Kranken und seine Angehörigen und Umgebungen liegt, um Gram und Ärgerniß von seinem Kranken zu entfernen. Dieß wird, dieß muß ein Haupt-Gegenstand seiner Sorgfalt und Menschen-Liebe seyn.
Sind aber des Kranken Verhältnisse hierin nicht zu bessern, hat er nicht so viel Philosophie, Religion und Herrschaft über sich selbst, alle Leiden und Schicksale, woran er nicht Schuld ist, und die zu ändern nicht in seiner Macht steht, geduldig und gelassen zu ertragen, stürmt Gram und Verdruß unabänderlich auf ihn ein, ohne daß der Arzt im Stande ist, dauernde Entfernung dieser größten Zerstörungs-Mittel des Lebens zu bewirken, so sage er sich lieber von der Behandlung der chronischen Krankheiten los und überlasse den Kranken seinem Schicksale, weil selbst durch die meisterhafteste Führung der Kur mit den ausgesuchtesten und dem Körper-Leiden angemessensten Heilmitteln nichts, gar nichts Gutes bei irgend einem chronischen Kranken unter fortwährendem Kummer und Verdrusse auszurichten ist, wo der Lebens-Haushalt durch stete Angriffe auf das Gemüth zerstört wird. Die Fortsetzung des schönsten Baues ist thöricht, wenn der Grund des Gebäudes täglich, obwohl nur allmählig von anspülenden Wellen untergraben wird..“(S. Hahnemann, 2000 S.170-171).
Hinzu kommen für M.L. SEHGAL die Überlegungen von JAMES TYLER KENT zur „Anatomie des Gemütes“, die dieser folgendermaßen strukturiert:
Dieses stellt das Zentrum eines jeden menschlichen Organismus dar.
Nun aber geht M.L. SEHGAL weiter als SAMUEL HAHNEMANN oder JAMES TYLER KENT. Er fordert nicht mehr die Totalität der Symptome, um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten. Er sucht auch nicht mehr nach den § 153er - Symptomen, um den Fall zu individualisieren. Es ist allein das Zentrum, das Gemüt, auf das er sein Interesse richtet. Die Begründung dafür ist einleuchtend: Vom Zentrum aus wird jede einzelne Zelle gesteuert. Es ist im Krankheitsfall immer in irgendeiner Art verändert. Daher muss zunächst die natürliche Ordnung des Zentrums wiederhergestellt werden. Anschließend werden sich alle fehlgerichteten körperlichen Zustände normalisieren. Die Aufgabe des Homöopathen besteht also darin, die Veränderungen des Gemütes (des Zentrums) aufzuspüren und diese Veränderungen durch Auffinden der entsprechenden Repertoriumsrubriken nutzbar zu machen. Mit dem so gefundenen Arzneimittel kann er direkt das Zentrum treffen und die Heilung einleiten.
Ganz einfach also. Ganz einfach, wenn es dem Therapeuten gelingt, ein vorurteilsfreier Beobachter zu bleiben, „übersinnliche Ergrübelungen“ (Hahnemann, S. Organon § 6) zu unterlassen und die Gemütsrubriken genauestens zu verstehen und einzusetzen.
Glücklicherweise haben SANJAY und YOGESH SEHGAL reichlich Vorarbeit geleistet und zahlreiche Rubriken sowie auch Facetten einiger Arzneimittel durchdacht und beschrieben.
Zum geforderten „vorurteilsfreien Beobachter“ gibt es von M.L. SEHGAL einen Tipp: Man betrachte den Patienten wie einen Computer und notiere emotionslos alle Äußerungen dieses „Apparates“. Nichts ist unwichtig. Auch Äußerungen, die völlig normal erscheinen, also über keinen Wert im Sinne des § 153 verfügen, sind von Bedeutung. Nichts kann uns als Therapeuten wirklich tangieren. Selbst Wutausbrüche oder Beleidigungen sind nichts weiter als verwertbare Symptome. Ein guter Tipp, der oft – allerdings nicht immer – weiterhilft.
Häufig ist auch echtes Mitleiden (homoios pathein) erforderlich, um dem Patienten zunächst in seiner Notsituation beizustehen.
Die Repertoriumsrubriken wurden von M.L. SEHGAL in einer neuen Art durchdacht und interpretiert. Zunächst einmal versuchte er sie mittels eines Wörterbuches genauestens zu verstehen. Dann übertrug er die erkannte Bedeutung auf Alltagssituationen.
Hierzu ein paar Beispiele:
>Störungen; Abneigung gegen DISTURBED; averse to being<
ant-c. ant-t. bamb-a. BRY. cench. cham. chinin-ar.
Cocc.
gels. gink-b. hell. iod. kali-m. lil-t. naja nat-ar.
Nux-v.
plut-n. sec.
Sep.
sulph. tub. ulm-c.
„Bedeutung: Gestört(adj): Aus dem Gleichgewicht gebracht, unruhig.
Interpretation: Es gilt für beide Richtungen. Wenn man bereits gestört ist, möchte man die Störung beenden, und wenn man ausgeglichen ist, hat man es nicht gerne, wenn man aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Was kann gestört werden? Etwas, was in Frieden und Ruhe ist oder etwas, das fest steht. Man stelle sich vor, da ist ein Tank voll Wasser im Zustand der vollständigen Ruhe, in den nun ein Stein geworfen wird. Das wird man als gestört oder aus dem Gleichgewicht gebracht bezeichnen. Ebenso, wenn jemand um seinen Sitzplatz gebracht wird oder aus seiner ursprünglichen Position geholt wird. Das kann umgekehrt genauso sein.
Irgendetwas ist bereits gestört, und es versucht nun, seine ursprüngliche Position wiederzuerlangen, d. h. den Zustand des Friedens. Und bei diesem Prozess der Wiederherstellung mag er es nicht, wenn er in irgendeiner Weise gestört wird und wird das ablehnen. Der Zustand des Gemütes kann dann ebenso als „Gestört werden, will nicht“ bezeichnet werden.
Versionen:
"Wenn ich einmal eine Stellung eingenommen habe, so ändere ich sie nicht gerne. Denn es nimmt mir die Gemütlichkeit weg, die ich auf die eine oder andere Weise versuche zu erhalten.´
´Ich fühle mich innerlich aus dem Gleichgewicht gebracht, ich möchte gern meinen ursprünglichen Zustand im Gemüt und Körper wiederherstellen.´
´Wenn ich diese Schmerzen los bin, wird es mir gut gehen.´
´Ich möchte mich hinsetzen oder mich hinlegen, ich habe ein Bedürfnis danach, aber ich bin nicht in der Lage so zu handeln, wie ich gerne möchte.´“ (M. L. Sehgal 2004, S. 463 f.).
>Aufzuhetzen, anzustacheln; andere INCITING others<
cimic. coloc. hyos. plb.
Jemanden zu einer Handlung veranlassen.
Interpretation: Andere zu Handlungen veranlassen und sich selbst ruhig im Hintergrund halten
Version: ´Es kann sein, dass Sie viele Leute erfolgreich behandelt haben, aber ich werdeIhre Fähigkeit erst dann anerkenne, wenn Sie mich geheilt haben.´“ (M. L. Sehgal, 2004, S. 479).
>Furcht - Extravaganz, vor Fear, extravagance,of<
op.
„Furcht: Unbehagen bei dem Gedanken an etwas Spezifisches, z. B. Furcht vor einem Löwen, Furcht vor Versagen usw.
Extravaganz: bedeutet, dass man für eine Sache mehr ausgibt, als sie wert ist. Gewöhnlich wird dieser Ausdruck nur bei Geldangelegenheiten benutzt, aber es funktioniert auch, wenn man es in einem ausgedehnteren Sinn benutzt, indem wir andere Aspekte des Lebens ebenfalls in Betracht ziehen.“ (M. L. Sehgal, 2004, S. 1103).
„Bedeutung: Ein Übermaß, ein Zuviel in jeder Richtung löst Unbehagen aus und kann nicht toleriert werden.
Interpretation: Bis zu einer persönlichen Grenze ist vieles auszuhalten, aber ab einem bestimmten Punkt geht es zu weit.
So wie jede andere Rubrik hat sie zwei Seiten, weder hält sie Exzesse durch andere aus, noch möchte sie irgendwelche Exzesse anderen zumuten.“ (M.L. Sehgal, 2004, S. 1103).
Mögliche Patientenäußerungen: „Ab und zu mal Kopfschmerzen vertrage ich ja, aber nun habe ich sie schon jeden zweiten Tag!“
„Ich bin jetzt schon das dritte Mal bei Ihnen, ohne dass ihre Behandlung irgendetwas gebracht hat. Jetzt suche ich mir einen anderen Homöopathen.“
„Unser Säugling wird nachts alle zwei Stunden wach. Das kann man keinem Babysitter zumuten.“
>Furcht - verraten zu werden; davor FEAR - betrayed; of being<
bell. hyos. ign. lach. lyss. nat-m. petr-ra.
„Furcht: Eine Art von Unbehagen, das durch eine spezifische, drohende Gefahr hervorgerufen wird. Die Person kann den Grund ihrer Furcht angeben.
Interpretation: Furcht von Personen, Situationen und/oder Ereignissen getäuscht zu werden.“ (M.L. Sehgal, 2004, S. 468).
Mögliche Patientenäußerungen: „Haben Sie diese Art Krankheit schon behandelt?“ –
„Meine Medikamente weglassen? Und wenn ihre Homöopathie dann nicht hilft? Das ist mir zu riskant.“ –
Man sieht, dass diese Rubriken in einer viel umfassenderen Art gebraucht werden können, als es zunächst den Anschein hat. Ja, einige Rubriken können überhaupt erst verwandt werden, wenn ihr weitergehender Sinn entdeckt wurde (Furcht, Extravaganz, vor).
Diese Beispiele mögen hier genügen, um aufzuzeigen, dass man tatsächlich den momentanen Gemütszustand eines Patienten durch Rubriken erfassen kann, auch und gerade dann, wenn er nicht besonders auffallend ist.
§ 153
„Bei dieser Aufsuchung eines homöopathisch specifischen Heilmittels, das ist, bei dieser Gegeneinanderhaltung des Zeichen-Inbegriffs der natürlichen Krankheit gegen die Symptomenreihen der vorhandenen Arzneien um unter diesen eine, dem zu heilenden Übel in Ähnlichkeit entsprechende Kunstkrankheits-Potenz zu finden, sind die auffallendern, sonderlichen, ungewöhnlichen und eigenheitlichen (charakteristischen) Zeichen und Symptome des Krankheitsfalles, besonders und fast einzig fest in’s Auge zu fassen; denn vorzüglich diesen, müssen sehr ähnliche, in der Symptomenreihe der gesuchten Arznei entsprechen, wenn sie die passendste zur Heilung sein soll. Die allgemeinern und unbestimmtern: Eßlust-Mangel, Kopfweh, Mattigkeit, unruhiger Schlaf, Unbehaglichkeit u.s. w., verdienen in dieser Allgemeinheit und wenn sie nicht näher bezeichnet sind, wenig Aufmerksamkeit, da man so etwas Allgemeines fast bei jeder Krankheit und jeder Arznei sieht.“
Anamnese nach SEHGAL
In der Anamnese nach M.L. SEHGAL soll vor allem die akute Form der Krankheit festgestellt werden, so wie sie sich im Gemüt ausdrückt.
Die PPP-Regel gibt dazu eine Hilfestellung: Die Gemütssymptome, die zur Arzneimittelwahl führen, sollen PRESENT (gegenwärtig), PREDOMINATING (vorherrschend) und PERSISTING (anhaltend) sein – im Einzelnen:
PRESENT
(gegenwärtig) – das jeweilige Symptom wird mit Betonung und Emotion geäußert, die z. B. Gleichgültigkeit oder Wut oder Unruhe ist spürbar. Möglicherweise lassen sich auch nonverbale Signale beobachten, die dieses bestätigen.
PREDOMINATING
(vorherrschend) – das betreffende Symptom beherrscht das Denken des Patienten.
PERSISTING
(anhaltend) – der Patient kann die jeweiligen Gedanken/Gefühle nicht „abschalten“ und nur zeitweise „zurückdrängen“. Sie kommen immer wieder, auch, wenn er es nicht will.
Wie schafft man es nun, den aktuellen Gemütszustand mit seinen deutlichsten Merkmalen zu erfassen?
In meiner Praxis hat sich dabei das „Narrative Interview“ (von Seckendorf, 2012) bewährt. – Worum geht es dabei?
Narrativ heißt erzählend, und so ermutigt der Interviewer den Patienten, seine Geschichte zu erzählen. So wie er sie wahrnimmt und empfindet.
Dazu wird zunächst ein Stimulus gesetzt, der kürzer oder länger ausfallen kann, und der auch den Schluss der Geschichte ins Auge fasst. Z. B. so: „Bitte erzählen Sie mir die Geschichte Ihrer Beschwerden und Ihrer Krankheit. Wie sie angefangen hat und wie sie heute ist. Was Sie dagegen getan haben. Sie können ganz frei berichten, ohne dass ich Ihren Bericht durch Fragen lenke oder unterbreche. Sie haben genügend Zeit, und wenn Sie am Ende Ihres Berichtes angekommen sind, werden Sie es mir sagen. Mich interessieren alle Dinge, die für Sie von Interesse sind, und die Sie besonders belasten. Reden Sie nun ganz frei und unbeeinflusst. Ich werde Ihnen sehr aufmerksam zuhören und keine Fragen stellen. Anschließend erlaube ich mir, Ihnen Fragen zu stellen.“ (von Seckendorff, 2012, S. 3).
Mein Stimulus sieht kürzer aus: „Erzählen Sie einfach mal, und sagen Sie mir, wenn Sie fertig sind.“ – In den Folgekonsultationen reicht dann „Erzählen Sie“ oder manchmal nur „Ja?“
Zur Selbstkontrolle und um eine genaue Analyse zu ermöglichen, empfiehlt es sich, eine Audio- oder Videoaufnahme zu machen. Dies erleichtert auch die Fokussierung auf den Patienten.
Es ist hochinteressant zu erleben, wie unterschiedlich Patienten auf den Stimulus „Erzählen Sie einfach mal und sagen Sie mir, wenn Sie fertig sind“, reagieren. Manche können es kaum erwarten und lassen den Therapeuten fast nicht ausreden. Manche sind verunsichert und wissen nicht, was von ihnen erwartet wird: „Was soll ich erzählen? – Können Sie nicht lieber fragen?“ – Meist reicht dann ein: „Mich interessiert alles“ oder „Ich will erst mal nur zuhören.“ – Einige bringen bereits Notizen mit ihrer Krankengeschichte mit oder einen Stapel von Befunden und eine Tasche voller Medikamente. So kommt man schon in den ersten Minuten zu sehr wichtigen Eindrücken und Beobachtungen.
Ebenso interessant ist das Ende des Interviews. Meist wird es ganz deutlich geäußert: „Ja, das war alles“