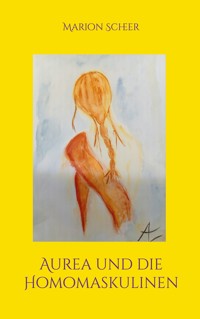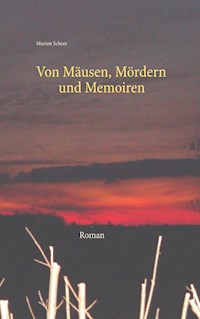Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zeit für Geschichten! Die Autorin erzählt, mit liebevollem Augenzwinkern, kleine Geschichten von Tieren und besonderen Menschen, die reichlich Anlass zum Schmunzeln oder Wundern bieten. Einigen Erzählungen liegen wahre Begebenheiten zugrunde, andere wiederum sind reine Fantasieprodukte und zeigen gekonnt, eine unbändige Freude am Fabulieren. Kurzweilige Unterhaltung wird garantiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Umschlagsfoto:
„Vogel mit Schale“
Erwin de Buhr (2017)
Zur Autorin
Marion Scheer wurde 1952 in Düsseldorf geboren. Im Anschluss an eine Banklehre und einige Jahre als Sachbearbeiterin bei einer Düsseldorfer Großbank, studierte sie Mathematik, Geografie und Geschichte auf Lehramt. Sie lebt und arbeitet seit fast vierzig Jahren an der ostfriesischen Nordseeküste und ist mehrfache Mutter und Oma. Solange sie schreiben kann, betreibt sie in ihrer Freizeit die Schriftstellerei. Dabei verarbeitet sie vorwiegend tatsächliche Begebenheiten und Erlebnisse zu Fantasiegeschichten. Leider verhinderten mehrere schwere Schicksalsschläge, dass ihre Romane und Kurzgeschichten schon früher veröffentlicht wurden.
Heute lebt die Schriftstellerin mit ihrem jetzigen Ehemann zurückgezogen in der Nähe von Emden.
Kontakt: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
Der wilde Gockel
Die Ente
Zerberus
Opas große Hilfe
Kati
Mörderische Pantoffeln
Herr und Frau Leitmüller
Die Paradiesvögel
Das Leben
Die Wahrheit
Die Meerjungfrau
Der Pirat und die Lady
Der Drache
Der Name
Schwein gehabt
Armer schwarzer Kater
Das Weiße im Auge
Der große Hut
Das tote Vöglein
Die Botschaft
Epilog
Danksagung
Der wilde Gockel
Hühner hatten wir schon, seit ich denken kann. Aber mein Vater war immer dagegen, sich einen Hahn anzuschaffen.
„Das sind ja traurige Hühner - so ganz ohne Hahn!“ „Ein Hahn würde für Ordnung sorgen in deiner Hühnerschar. Damit kannst du die Hennen sogar frei laufen lassen." „Mit einem guten Hahn legen die Hühner viel besser!"
Ständig versuchten ihn Verwandte und Freunde von den Vorzügen eines Hahnes zu überzeugen.
Doch Vater blieb stur.
„Ein Hahn frisst nur und legt dafür kein einziges Ei. Der ist völlig überflüssig!", brummte er eigensinnig.
Mutter äußerte in diesem Zusammenhang einmal die Vermutung, dass er männliche Konkurrenz in Haus und Hof grundsätzlich nicht dulde. Vielleicht war das etwas krass ausgedrückt, doch hatte sie recht damit, dass wir nur weibliche Tiere besaßen.
Da gab es die schwarze Aggi, unsere lammfromme alte Kuh, mit einer winzig kleinen weißen Ohrspitze. Sie stand seit gut zwölf Jahren als zuverlässige Milchlieferantin in unseren Diensten.
Die bunte Katze Mira war zweifelsohne ebenfalls weiblich, was sie uns zweimal jährlich nach Kräften zu beweisen suchte, indem sie mindestens fünf niedliche kleine Fellknäuel zur Welt brachte.
Die Meerschweinchen meiner jüngeren Schwester hatten wir extra aus einer guten Zoohandlung erworben, die uns garantierte, dass es sich tatsächlich um zwei Weibchen handelte.
Ich selbst nannte seit meinem zehnten Geburtstag eine Rauhaardackeldame namens Lissi mein Eigen, die eine lästige weibliche Unart besaß, die Vater ständig beklagte. Sie hatte nämlich ihren eigenen Kopf.
Und dann trällerte in unserer Küche noch ein quietsch gelber Kanarienvogel, den ich zwar geschlechtlich nicht sicher zuordnen konnte, der aber immerhin den weiblichen Namen Desdemona führte.
In diese Idylle männlicher Alleinherrschaft brach eines schwarzen Freitags Otto ein.
Eigentlich war er anfangs noch gar kein richtiger Hahn. Ein freundlicher Nachbar, der eine Brutmaschine besaß, schenkte uns das winzige Küken.
„Hinni, ich hab 'nen Hahn für deine Hühner. Das Elend kann ja kein Mensch länger mit ansehen", grinste er breit und drängte meinem Vater das hilflose Tierchen auf.
„Na, vielleicht gibt der mal 'nen guten Braten ab", brummte Vater und brachte das kleine Etwas widerwillig ins Hühnergehege.
Unsere gesamte Familie, einschließlich Oma Meta, beobachtete gespannt die erste Begegnung des vermeintlichen Hähnchens mit seinem Harem.
Die Hühner zeigten jedoch nur Interesse für meinen Vater, von dem sie sich eine zusätzliche Mahlzeit erwarteten. Sie nahmen keine Notiz von dem Neuzugang, der - kaum, dass er den Boden berührte - unter die wärmenden Flügel der nächstbesten Henne flüchtete.
Vater lachte schallend und auch irgendwie erleichtert.
„Das ist mir ein richtiger Hahn! Wird wohl eher ein Angsthase sein. Vielleicht ist es sogar ein Hühnchen."
Es verging eine lange Zeit, in der wir alle vergaßen, dass das neue Küken eigentlich einmal ein Hahn werden sollte. Es hielt sich immer ängstlich bei seiner Adoptivmutter und erweckte selbst in meinem Vater nur Mitleid.
„Wir nennen ihn Otto", sagte Oma Meta eines Nachmittags, als wir gemütlich bei Tee und Rosinenbrot saßen. „Otto hieß mein Vetter, die Bangbüx. Das passt!"
Keiner von uns hatte gegen den Namen etwas einzuwenden, selbst Vater nickte schmunzelnd. Von diesem angeblichen Vertreter des männlichen Geschlechtes befürchtete er keinerlei Konkurrenz.
Dann kam ganz unvermutet der Morgen, an dem Otto das Leben eines vollwertigen Hahnes begann.
Als meine Schwester und ich uns auf den Weg zum Schulbus machten, hörten wir ein unmelodisches Krächzen. Wir sahen uns fragend an und rannten sofort, ohne ein weiteres Wort, zurück zum Hühnerstall. Dort stand Otto, schlug mit den Flügeln, reckte den Hals und versuchte nach Leibeskräften zu krähen. Und obwohl er schmächtiger war als sie, hielten die Hennen respektvollen Abstand.
Otto wurde ein hübscher bunt schillernder Hahn mit prächtigem roten Kamm und kräftiger Stimme. Er kam fleißig seinen Pflichten nach, blieb aber klein. Die Hennen verübelten es ihm nicht. Sie legten besser. Ob sie sich glücklicher fühlten, ließ sich nicht feststellen.
Vater war der festen Überzeugung, dass unser Nachbar ihm mit dem zwergwüchsigen Vieh eins habe auswischen wollen. Da der mickrige Flattermann aber auch keinen vernünftigen Braten abgab, ließ er ihn - ständig nörgelnd - weiter im Hühnerharem einher stolzieren.
„Wenn wir schon einen Hahn durchfüttern, können wir uns auch noch weitere Hennen dazu anschaffen und die Eier verkaufen", beschloss Vater nach einiger Zeit.
Als die Junghennen in das Gehege kamen, war Otto sehr aufgeregt. Er flatterte wie wild umher. Vater schickte sich an, zur allgemeinen Beruhigung ein paar Körner einzustreuen. Da sprang der Hahn mit einem Satz auf seine Hand und pickte mit aller Kraft hinein.
Laut schimpfend kam Vater ins Haus zurück, um seine blutende Wunde zu versorgen. Während Mutter ihn verarztete, konnte sie sich den Spruch nicht verkneifen: „Ja, ja, so seid ihr Männer - kaum kommt was Junges in den Stall, schon flippt ihr aus!"
Und sie blieb bei weitem nicht die einzige, die ihre Witzchen über den Vorfall machte.
Vater bekam zu allem Überfluss eine Blutvergiftung und musste den verbundenen Arm vorübergehend in einer Schlinge tragen.
Als meine Schulfreundin ihn so sah, fragte sie, ob sein Arm gebrochen sei.
„Ne, der Hahn hat mich gepickt", gab er wahrheitsgemäß zur Antwort.
Meine Freundin platzte laut lachend heraus: „Sie wollen mich wohl veralbern!"
Danach vermied Vater es, über seinen unerfreulichen Zusammenstoß mit unserem Hähnchen zu reden. Er betrachtete das Tier nur noch mit ärgerlichem Blick.
Da Otto immer aggressiver wurde, starteten wir den Versuch, ihn mit den Hühnern frei laufen zu lassen, damit er sich richtig austoben könnte. Es nützte nichts. Er war so angriffslustig, dass sich niemand von uns in seine Nähe wagte. Um an die Eier heran zu kommen, wurden sogar Ablenkungsmanöver mit Futter nötig.
Der Familienrat tagte schließlich wegen des wilden Gockels. Es wurde einstimmig beschlossen, dass er weg musste. Jedoch waren alle außer Vater dagegen, ihn zu schlachten.
Das Schicksal fügte es, dass eine befreundete Bäuerin, die auf ihrem Hof vielen unerwünschten Tieren Heimat gab, von unserem Dilemma erfuhr. Sie erbot sich, den Hahn in einer Nacht-und Nebel-Aktion zu übernehmen, denn die Dunkelheit machte ihn wehrlos.
Obgleich wir froh waren, den Störenfried endlich los zu sein, interessierte uns alle sehr, wie er sich zwischen den anderen Tieren auf dem fremden Bauernhof benehmen würde.
Ein Anruf eröffnete uns des Dramas Ende:
Otto hatte sich mit anbrechendem Morgen in der völlig unbekannten Umgebung wahrscheinlich nicht orientieren können. Als die Frau das Geflügel fütterte, erhob der kleine Hahn ein fürchterliches Geschrei und flog kurzerhand auf einen nahe stehenden Baum. Dort verfing er sich so unglücklich in einer Astgabel, dass er sich selbst erhängte.
Und die Moral dieser Geschichte?
Auch ein kleiner Hahn kann böse enden!
Die Ente
Lothar lächelte durch die geöffnete Terrassentür in Richtung des Gartenteiches. Seine verhärmten Gesichtszüge wirkten für den Augenblick weich und sanft. Unter der herrlichen Trauerweide, die die Zierde seines gepflegten Gartens darstellte, hatte er sie vor einigen Jahren begraben, seine Daisy.
Das war noch in seinem anderen Leben gewesen, als er bei dem Wort Krebs nur an das Scherentier gedacht hatte und an die erfolgreichen Fangzüge seiner unbeschwerten Kindheit am Meer. Ein Hustenanfall brachte ihn in die Gegenwart zurück. Magda warf ihm einen besorgten Blick zu, wich dem Augenkontakt jedoch geschickt aus und schenkte Tee nach.
„Damals war uns diese weiße Ente zugeflogen. Eines Morgens saß sie einfach da. Kleines elendes Vieh. Der hat es bei unserem Teich so gut gefallen, dass sie gar nich mehr weg wollte.” Er hustete wieder und nippte dann vorsichtig am heißen Tee. Schlucken konnte er auch nicht mehr richtig. Überall wucherte der unberechenbare Tumor. Doch der sollte kein leichtes Spiel mit ihm haben!
„Lothar, weißt du noch, wie die Daisy immer auf deinen Gartenschuhen hockte?” Magda wandte sich dem Besucher zu. “Wenn wir weg mussten, haben wir nur die Schuhe hingestellt, und sie blieb dabei sitzen wie ein dressierter Hund.”
Der kranke Mann lachte krächzend.
„Du hättest die Gesichter der Nachbarn sehen sollen, wenn das dumme Vieh neben meinen Schuhen her watschelte. Sie kam überall mit hin. Aber nur mit mir.”
„Ja, einen Narren hatten die beiden aneinander gefressen.” Magda zwinkerte dem Besucher zu.
„Quatsch, den ganzen Garten hat das hungrige Vieh mir leer gefressen. Mit Gurken haben wir’s zuletzt gefüttert. Die mochte Daisy für ihr Leben gern.”
„Was das im Winter gekostet hat, als die Gurken so teuer waren!”
„Hab das elende Vieh oftmals verflucht”, hüstelte Lothar mit einem Seitenblick auf seine Frau und spuckte in sein Taschentuch.
„Ach, was? Verhätschelt hast du die Daisy, mehr als deine Kinder”, protestierte sie schwach.
„Steck du lieber deinen Kopf in den Putzeimer, davon verstehst du was.” Er klang verärgert. „Mein Sohn ist ein elender Waschlappen, und meine Tochter hat einen Säufer zum Mann. Das sagt doch alles. Und kümmern sie sich vielleicht um ihren kranken Vater?”
Aufgebracht wandte er sich an den Besucher, der etwas peinlich berührt in seinem Kuchen stocherte: „Wenn die anrufen, erzählen sie stundenlang von ihren eigenen Problemen und lassen einen nich zu Wort kommen. - Kannste vergessen die beiden.”
„Wie ging die Geschichte mit der Ente weiter, habt ihr sie geschlachtet?”, fragte der Gast, um von den Familienstreitigkeiten abzulenken.
„Daisy schlachten? Nein, woher denn! Das hätte Lothar niemals erlaubt.”
„Das blöde Vieh ist im Winter vor vier Jahren auf den zugefrorenen Teich gewatschelt. Was es da wollte, weiß der Teufel. Steckst ja nich drin in so’nem Spatzen-, ähm, Entenhirn. Is natürlich ausgerutscht und hat sich glatt das Bein ausgerenkt.” Der folgende Hustenanfall schwächte den Mann so sehr, dass er pfeifend nach Luft rang.
Magda erhob sich schwerfällig aus ihrem Sessel und klopfte ihm so zaghaft auf den knochigen Rücken, als befürchte sie ihm weh zu tun.
„So geht das den ganzen Tag lang. Und nachts ist es am schlimmsten. Da denke ich immer, er erstickt mir. Wenn der Krebs so weiter wächst, müssen die ihm einen Luftröhren-Schnitt machen. Aber er ist ja so stur. Er hört nicht auf die Ärzte.”
„Vielleicht hält ihn seine Sturheit trotz der fortgeschrittenen Krankheit am Leben?”, wandte der Besucher ein und nahm einen Schluck Tee.
„Noch bin ich nich am Abnippeln. Da wird sich mancher sehr gedulden müssen! Und meinen Hals lass ich mir nich aufschneiden, bevor es nich hart auf hart kommt. Was die Doktors angeht, da hab ich meine Zweifel. Die reden schön geschliffen, dass man die Hälfte nich versteht. Aber helfen konnten sie am Ende doch nich - der Daisy nich und mir auch nich.”
Seine blutunterlaufenen Augen starrten wütend in die Teetasse. Als habe man ihn stranguliert, nahm sein Kopf eine bläuliche Verfärbung an. Die knochigen Hände nestelten hektisch an dem feuchten Taschentuch, das mit Blutflecken übersät war.
„Wir hatten die Daisy zum Tierarzt gebracht, weil sie nicht mehr laufen konnte. Aber der musste sie einschläfern.” Magda schluckte und schaute an dem Besucher vorbei in Richtung Teich.
„Im Schuhkarton haben wir sie hier im Garten vergraben. Hab beinah den guten Spaten abgebrochen, so hart war der Boden. Ihre Spielsachen haben wir ihr dazu gelegt. Was sollten wir auch mit dem Plunder. Mussten sowieso noch paar Tage lang Gurkensalat essen.” Lothar strich sich mit der Handfläche die exakt gekämmten und sauber gescheitelten dünnen Haare glatt.
„Schade, dass Daisy so enden musste. Na, wahrscheinlich ist sie jetzt im Entenhimmel, wenn es so etwas geben sollte”, meinte der Gast verbindlich.
„Ne, an so was glaub ich nich. Is alles Schnickschnack und Leute-Verdummung, das mit Himmel und Engeln und so. Am Ende wird es dunkel und dann is Schluss für immer. Hör mir auf mit dem Kinderkram!” Er lauschte einen Moment und stellte dann fest: „Draußen hält ein Auto. Deine Frau will dich jetzt abholen, Fred.”
Erstaunt sah der Besucher auf. Er hatte nichts gehört.
„Ja, ja, glaub ihm nur. Seine Ohren sind noch bestens in Ordnung. Er hört die Flöhe husten”, bestätigte Magda und humpelte zur Tür, während sie sich den schmerzenden Rücken hielt.
Fred verabschiedete sich sehr herzlich, weil er befürchtete, seinen Leidensgenossen nicht lebend wieder zu sehen, und bestieg das wartende Auto. Das alte Ehepaar stand einträchtig nebeneinander in der geöffneten Haustür und winkte ihnen nach.
„Lothar sieht schlecht aus, und Magda ist offensichtlich sehr erschöpft. Die beiden führen nun schon seit drei Jahren diesen aussichtslosen Kampf gegen seinen Krebs. Wie lange mögen sie das noch durchhalten?”, fragte Freds Frau voller Mitgefühl.
„Das kann dir niemand beantworten. Du weißt doch, wie das mit unserer heimtückischen Krankheit ist”, murmelte er.
„Aber wenn man nicht helfen kann, was soll man dann tun?”
„Einfach nur da sein. Zuhören. Zeit schenken. Zeit ist das Kostbarste, was wir Menschen besitzen.”
Zerberus
Es war kein Wetter zum Radfahren. Sie öffnete jedoch energisch die Schuppentür, wuchtete das Rad heraus und schwang sich aus lieber Gewohnheit in den Sattel.
Langsam fand sie einen erträglichen Rhythmus. Unter ihren ausdauernden Tritten, quälte sich das alte Hollandmodell ohne Gangschaltung gegen die Sturmböen. Die feuchte Luft entledigte sich einiger Tropfen in Ritas krauses graumeliertes Haar. Während sie mit einer Hand die Kapuze aufsetzte und die Schnur festzog, begann es auch schon wie aus Eimern zu schütten.
Nur nicht nachlassen zu treten, sonst könnte das Element die Oberhand gewinnen! Den Kopf gesenkt, mit weit vorgeneigtem Oberkörper, ein moderner Zentaur - Mensch eins mit dem Rad - versuchte sie dem Wind einen geringeren Widerstand zu bieten.
Inzwischen gelang es dem rissigen Asphalt unter ihrem Vorderrad nicht mehr, die Regenflut zu schlucken. Kielwasser spritzte, während sich der breite Profilreifen unaufhaltsam seinen Weg vorwärts pflügte. Ritas Jacke begann an den Schultern durchzuweichen, und ihre Jeans klebte wie eine nasskalte zweite Haut an den Oberschenkeln. Sie biss auf ihre Unterlippe, so dass es schmerzte. Dann war es so plötzlich vorbei mit dem Unwetter wie es begonnen hatte.
Wasserwechsel, dachte sie und schob keuchend ihr Rad an der üblichen Stelle über den Deich. Selbst ihre Strümpfe waren zum Auswringen nass.
Der Himmel lachte sie unschuldig an. Federwolken hatten ein Knötchenmuster über das Blau gestrickt. In herbstlichem Rostrot und leuchtenden Gelbtönen überraschten sie die Farben des Uferbewuchses. Dazwischen trugen die Stranddisteln ihre weiß gefiederte Samenpracht zur Schau, als wollten sie Hochzeit halten. Rita fröstelte. Sie musste weiterfahren, sonst war die Erkältung unausweichlich.
Auf der Heimfahrt entlang der Außenseite des Deiches hatte sie den Wind im Rücken, und das Rad rollte mühelos.
Ihr Blick glitt über das feucht glänzende Watt. Die Insel Norderney schwamm noch in Milch. Aber Rita hatte sie so oft gesehen, dass sie jedes kleine Detail erahnte. Der schlank aufragende Leuchtturm sandte ihr seinen strahlenden Morgengruß zu.
Mit Macht drängte das Wasser aus allen Poren des Watts. Bald leckten schaumige kleine Wellen gierig an den schwarzen Steinen der Uferbefestigung. Aus der Flut ragte neben einem tanzenden verrosteten Eimer ein rotes Ding, das sie an einen überdimensionalen Legostein erinnerte.
Während sie noch darüber nachdachte, welche Funktion es wohl früher gehabt haben könnte, sprang auf der Landseite etwas Beunruhigendes in ihren Blickwinkel. Im rasenden Lauf kam es von der Deichkrone auf Rita zu. Die Anspannung der starken Muskulatur war unter dem dunklen glatten Fell hervorragend auszumachen. Unterhalb der bösartig hochgezogenen Nase hechelte die lange Zunge aus dem gefährlichen Rachen.
Rottweiler, dachte die Frau entsetzt.
Nirgends war ein Mensch zu sehen. Wie irrsinnig trat sie in die Pedale, ohne Chance. Dann war der kräftige Hund neben ihr. Sie nahm seine lauten Atemzüge durch das Pulsieren ihres Blutes wahr. Als er ihr Bein packte, reagierte sie instinktiv. Sie stoppte aus voller Fahrt und schleuderte das Rad gegen den Angreifer. Gleichzeitig entfuhr ihrer verkrampften Kehle ein gurgelnder Laut.
Der Hund, für einen Moment verschreckt, begann aggressiv zu kläffen. Rita hielt die Hände schützend vors Gesicht und schrie mit ihrem ganzen Körper. Schon setzte der Rottweiler zum Sprung an, als ihm eine laute Stimme den Befehl gab: „Aus, Bimbo, ruhig!”
Ritas Lebensretter entpuppte sich als der Hundehalter, der für dessen gefährlichen Alleingang die Verantwortung trug. Er war um die Fünfzig, graumeliert, hatte ein markantes Gesicht mit schmalen Lippen und einem ungesund gelblichen Teint. Im Mundwinkel klebte ein Zigarillo, das, selbst während er sprach, wie mit ihm verwachsen erschien.
Bimbo sei völlig ungefährlich und habe nur spielen wollen, hörte Rita wie durch Watte. Seine Stimme klang teilnahmslos, als wolle er Brötchen kaufen. Das brachte sie haarscharf in die Nähe eines Wutausbruchs. Lautstark verlangte sie die Personalien des Mannes, die er ihr aber zynisch lachend verweigerte.
„Reg dich ab, Alte, und lass deinen Frust anderswo ab! Oder soll ich den Hund wieder loslassen?” Der Geruch des Zigarillos verursachte Rita Übelkeit. Böse knurrte der inzwischen an die Leine gelegte Rottweiler sie an. Dann wandten sich Hund und Herr, ohne die geringste Spur von Schuldbewusstsein, zum Gehen.
Hilflos, am ganzen Körper bebend und mit zerfetztem Hosenbein, sah die Frau ihnen nach.
Hundeverbot, dachte sie wutschnaubend. Auf dem Deich herrschte absolutes Hundeverbot! Aber wer hielt sich schon daran, zumal die Schafherde, vor ihrem Umzug ins Winterquartier, bereits auf einem entfernteren Deichabschnitt graste.