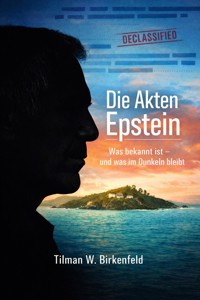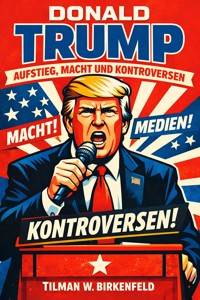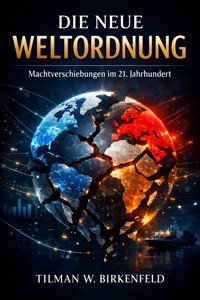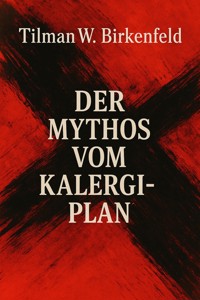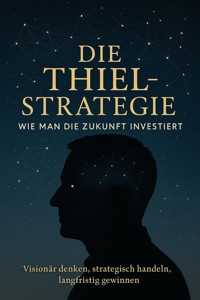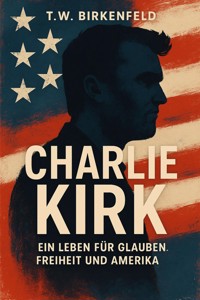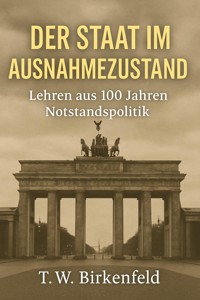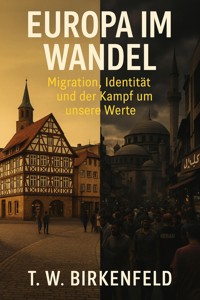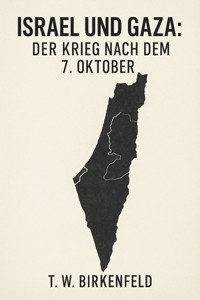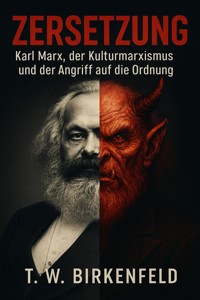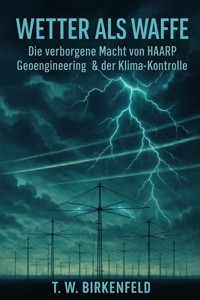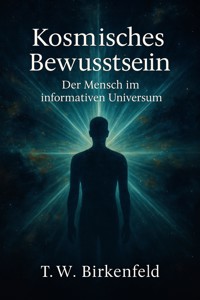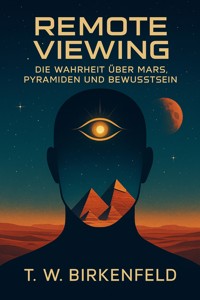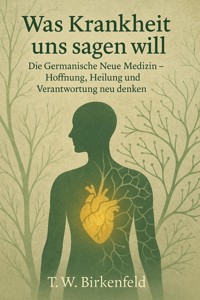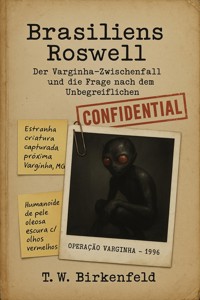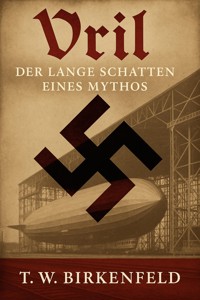
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Vril – ein Wort wie ein Echo aus einer anderen Welt. Zwischen viktorianischer Fiktion, okkulter Spekulation und moderner Verschwörungstheorie entfaltet sich ein Mythos, der bis heute Wirkung zeigt: in esoterischen Zirkeln, rechter Ideologie und digitaler Popkultur. Tilman W. Birkenfeld folgt den Spuren dieser "Lebensenergie" durch Literatur, Pseudowissenschaft und politische Fantasie – vom Roman des 19. Jahrhunderts bis zu Internetmemes und Flugscheibenlegenden. Mit kritischem Blick und erzählerischer Präzision zeigt er, wie sich Fiktion in "Fakten" verwandelt – und warum es dringend Zeit ist, Mythen wie Vril ernst zu nehmen, bevor sie erneut zur ideologischen Projektionsfläche werden. Ein Buch über Geschichte, Glaube und die Macht der Erzählung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tilman W. Birkenfeld
VRIL: Der lange Schatten eines Mythos
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Einleitung: Zwischen Pseudowissenschaft und Popkultur
Kapitel 2: Ursprung in der Fiktion – Bulwer-Lyttons „The Coming Race“
Kapitel 3: Von der Literatur zur „Wahrheit“ – Rezeption durch Theosophie und Okkultismus
Kapitel 4: Vril im deutschen Esoterikmilieu (1900–1933)
Kapitel 5: Die NS-Zeit – Mythosmaschine und okkulte Spekulationen
Kapitel 6: Neonazismus, Esoterik und das digitale Zeitalter
Kapitel 7: Vril heute – Zwischen Verschwörung und Unterhaltung
Kapitel 8: Entzauberung und Verantwortung
Impressum neobooks
1. Einleitung: Zwischen Pseudowissenschaft und Popkultur
Wenn man sich mit dem Begriff „Vril“ beschäftigt, gerät man unweigerlich in ein seltsames Zwischenreich – irgendwo zwischen viktorianischem Zukunftsroman, esoterischem Wunschwissen und politisch motivierter Fiktion. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Aufeinandertreffen mit dieser geheimnisumwitterten Idee. Es war kein akademischer Text, kein Vortrag, auch keine aufwendig recherchierte Monografie. Nein, es war eine vergilbte Zeitschrift auf einem Flohmarkt in Süddeutschland, mit derart marktschreierischem Cover, dass selbst ein B-Movie aus den Achtzigern blass dagegen gewirkt hätte: „Geheime Nazi-Technologie – Vril: Die Energie der Götter!“ stand da, neben einem schemenhaften Ufo, das über einer verschneiten Antarktis-Basis schwebte.
Zunächst hielt ich es für eine besonders ausgefallene Form des Trash-Entertainments, das irgendwo zwischen Däniken und digitalem Verschwörungswahn pendelte. Doch das Heft ließ mich nicht los. Es folgte ein tiefer Griff ins Kaninchenloch. Was ich entdeckte, war kein isoliertes Phänomen – vielmehr ein ganzes diskursives Geflecht aus Mythen, Halbwahrheiten und bewusster Verzerrung. Der Begriff „Vril“ diente dabei als Projektionsfläche für verschiedenste Sehnsüchte: technologische Allmacht, spirituelle Reinheit, nationale Überlegenheit – je nach ideologischer oder kultureller Prägung.
Der Ursprung dieser seltsamen Energie liegt in einem Roman: The Coming Race von Edward Bulwer-Lytton, erschienen 1871. Was als Science-Fiction über eine unterirdisch lebende Superrasse begann, wurde in den folgenden Jahrzehnten von Theosophen, Okkultisten und Esoterikern aufgegriffen, umgedeutet, erweitert – kurzum: in einen Glaubenskomplex überführt. Dabei war die Transformation keine zufällige Mutation der Rezeption, sondern das Resultat eines über Jahrzehnte wachsenden ideengeschichtlichen Netzes, in dem Wissenschaft, Pseudowissenschaft und spirituelle Systeme miteinander konkurrierten. Die Vorstellung eines unsichtbaren Energiefelds, das den Körper durchströmt und den Zugang zu höherem Wissen oder sogar zur Unsterblichkeit verspricht, passte zu gut ins Denken jener Zeit, das die Grenzen zwischen Naturwissenschaft und Magie ohnehin gern verschwimmen ließ.
Inmitten dieser historischen Entwicklung steht Vril wie ein schimmerndes Artefakt: gleichzeitig fiktiv und folgenschwer real. Es wurde nicht nur zu einer Metapher für spirituelle Macht, sondern in späteren Jahrzehnten auch zu einem zentralen Baustein rechter Esoterik, insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Was bei Bulwer-Lytton noch als satirische Warnung oder zumindest als philosophische Spekulation über Macht und Zivilisation gedacht war, wandelte sich in den Händen von Helena Blavatsky, Rudolf Steiner und schließlich diversen Neonazis zu einem esoterischen Dogma, das über geheime Technologien, verschwundene Kontinente und außerirdische Ahnlinien spekulierte.
Heute ist Vril allgegenwärtig – nicht in der Mainstreamwissenschaft, aber als kulturelles Symbol in Filmen, Videospielen, Internetforen und verschwörungstheoretischer Literatur. Wer etwa das Internet durchforstet, findet binnen Sekunden hunderte Einträge zu „Vril-Technologie“, „geheimen Nazi-Ufos“ oder „Aldebaran-Übermenschen“. Manche dieser Erzählungen dienen der Unterhaltung, andere der ideologischen Mobilisierung. Die Grenzen zwischen ernsthafter Esoterik, ironischer Popkultur und gefährlichem Revisionismus sind dabei fließend. Das macht Vril zu einem besonders spannenden Untersuchungsgegenstand – denn wo sonst überlagern sich historische Literatur, spirituelle Heilsversprechen und politische Radikalisierung derart deutlich?
Für mich als Kulturhistoriker mit Fokus auf Esoterik und Ideologiekritik ist der Vril-Mythos nicht bloß ein Randthema. Er ist ein Prisma, durch das sich gleich mehrere gesellschaftliche Prozesse bündeln lassen: die Faszination für das Verborgene, die Sehnsucht nach Ganzheit in einer fragmentierten Moderne und die gefährliche Bereitschaft, Mythen zur Legitimation von Machtansprüchen zu instrumentalisieren.
Im Zentrum dieser Untersuchung steht deshalb nicht nur die Frage, was Vril ist, sondern vielmehr, was aus ihm gemacht wurde. Es geht um das, was man in der historischen Semiotik eine Zeichenwanderung nennt: Wie wandert ein Begriff durch Epochen, Diskurse, Ideologien? Wie verändert er seine Bedeutung – und was verrät uns das über diejenigen, die ihn benutzen?
Der Vril-Mythos ist nicht einfach nur ein kulturelles Kuriosum. Er ist ein ernstzunehmendes Beispiel dafür, wie eine literarische Fiktion in religiöse Weltbilder und politische Ideologien integriert wird. Dabei ist es kein Zufall, dass ausgerechnet rechtsextreme Gruppen das Vril-Konzept mit besonderer Inbrunst adaptierten. Der Gedanke einer uralten, exklusiven Energieform, die nur „Auserwählten“ zugänglich ist, passt hervorragend in das völkische Weltbild von rassischer Hierarchie und göttlicher Sendung. In dieser Welt ist Vril mehr als nur eine Kraft – es wird zum Erweckungsversprechen, zum Symbol einer vermeintlichen arischen Ursprungsidentität, oft gepaart mit aggressiver Technikbegeisterung und spirituellem Überlegenheitswahn.
Der zweite Teil dieser Einleitung widmet sich deshalb der Frage, wie Vril in die heutige Populärkultur eingedrungen ist – und warum gerade Verschwörungstheorien, Esoterikforen und digitale Subkulturen dieses Konzept weitertragen, neu interpretieren oder gezielt missbrauchen.
Je tiefer man in die Welt des Vril eintaucht, desto deutlicher wird: Wir haben es hier nicht nur mit einem obskuren Thema aus der Rumpelkammer der Esoterik zu tun, sondern mit einem Ideenkonstrukt, das sich durch verschiedene kulturelle Schichten hindurchzieht – wie ein Mem, das sich unaufhaltsam verbreitet, weil es auf bestehende Bedürfnisse trifft. In der Popkultur erscheint Vril oft als geheimnisvolle Superkraft, als Quelle unerklärlicher Technologie oder als Treibstoff für unterirdische Reiche, die sich dem Zugriff der normalen Welt entziehen. Das allein wäre noch kein Grund zur Sorge, wäre da nicht die Tatsache, dass dieses Bild in gewissen Milieus bewusst mit politischen Botschaften aufgeladen wird.
Gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als Verschwörungstheorien zunehmend massenmedial verbreitet wurden, verwandelte sich Vril in eine Art ideologisches Trojanisches Pferd. Innerhalb pseudo-historischer Narrative wird es zur Chiffre für eine angeblich unterdrückte Wahrheit – eine Wahrheit, die von einer globalen Elite verschwiegen werde, um die Menschheit in geistiger Knechtschaft zu halten. Wer diese Kraft „zurückgewinne“, so das Versprechen, sei nicht nur frei, sondern erhoben über den Rest der Welt. Die Nähe zu gnostischen Motiven ist unverkennbar, allerdings wird hier nicht das individuelle Seelenheil in Aussicht gestellt, sondern die Wiederherstellung einer autoritären Weltordnung, die sich aus mythischen Ursprüngen speist.
In zahlreichen rechtsesoterischen Publikationen wird das Vril-Konzept mit dem angeblich verlorenen Wissen der „arischen Urahnen“ verbunden. Diese Urahnen hätten demnach Zugang zu einer reinen, göttlich inspirierten Energie gehabt, die ihnen übernatürliche Fähigkeiten, technologische Überlegenheit und spirituelle Klarheit verliehen habe. Vril wird somit zum Identifikationssymbol – nicht zufällig gepaart mit Begriffen wie „Blut“, „Boden“, „Ordnung“ oder „Kosmische Herkunft“. Die rassentheoretische Komponente ist in solchen Texten nicht nur implizit, sie ist strukturell zentral.
Doch es sind nicht allein rechtsideologische Kreise, die an der Vril-Fiktion Gefallen finden. Auch in eher harmlos erscheinenden Kontexten – etwa in Romanen, Computerspielen oder Serien – wird Vril gern als erzählerisches Element genutzt, das technologische Fantasie mit spirituellem Überbau verbindet. Das allein wäre kulturell durchaus interessant, würde nicht auch dort häufig ein Set von Codes reproduziert, das ursprünglich aus den dunkleren Ecken der Esoterikgeschichte stammt. Selbst in scheinbar banalen Science-Fiction-Szenarien, in denen es um unterirdische Basen, Zeitreisen oder Hypertechnologien geht, schleichen sich manchmal Bilder und Begriffe ein, die auf ein ganzes Subsystem an verschwörungsideologischen Erzählungen verweisen – etwa wenn die Schwarze Sonne, die Thule-Gesellschaft oder die „Vril-Damen“ auftauchen.
Diese Rezeption ist keineswegs naiv oder zufällig. In den digitalen Subkulturen, in denen Memes, Podcasts und Videoessays über Vril und verwandte Themen kursieren, wird ein verschwommener Übergangsraum geschaffen: Einerseits ironisch, verspielt, postmodern – andererseits durchsetzt mit ideologischen Mustern, die längst nicht mehr bloß Spielerei sind. Die Grenzen zwischen Spaß, Glaube und Propaganda verwischen. Wer das Thema Vril googelt, landet mit wenigen Klicks in einem Netzwerk aus Seiten, die Ufo-Mythologie, antisemitische Narrative, Quantenesoterik und Reichsbürgerdenken miteinander verschalten.
Gerade diese hybride Struktur – mal popkulturell, mal esoterisch, mal explizit politisch – macht das Thema so gefährlich wie faszinierend. Denn Vril fungiert als semantisches Chamäleon: Es passt sich an, es tarnt sich als Techno-Fantasie oder New-Age-Konzept, es springt von Telegram in Amazon-Bücher, von Rollenspielen in YouTube-Kommentare. Und dabei vermittelt es stets dasselbe: Das Versprechen einer „anderen“, verborgenen Ordnung, zu der nur „Eingeweihte“ Zugang haben. Eine Ordnung, in der sich spirituelle Erwähltheit, technologische Überlegenheit und ethnonationale Reinheit zu einem Weltbild verdichten, das in seiner Konsequenz zutiefst antidemokratisch ist.
Das vorliegende Buch versucht deshalb, Vril nicht als isoliertes Phänomen zu betrachten, sondern als Schnittstelle. Es geht um die Berührungspunkte von Literatur, Wissenschaftsgeschichte, Esoterik und politischer Ideologie. Dabei stehen zwei zentrale Fragen im Mittelpunkt: Wie konnte ein Begriff aus einem fiktionalen Roman zu einer spirituell aufgeladenen Idee werden, die bis heute Verschwörungstheorien und politische Radikalisierung befeuert? Und was verrät diese Entwicklung über unsere kollektive Faszination für das Unsichtbare, das Exklusive, das Machtversprechende?
In einer Zeit, in der sich Pseudowissenschaft mit Popkultur vermischt und dabei politische Wirkung entfaltet, lohnt sich der Blick auf das Vril-Prinzip als kulturhistorisches Lehrstück. Es zeigt, wie eng Fiktion und Ideologie miteinander verwoben sein können – und dass das scheinbar Abseitige manchmal näher an den gesellschaftlichen Kern heranrückt, als uns lieb sein kann.
Kapitel 2: Ursprung in der Fiktion – Bulwer-Lyttons „The Coming Race“
Wer dem Mythos „Vril“ auf den Grund gehen will, kommt an einem Namen nicht vorbei: Edward Bulwer-Lytton. Ein Mann, dessen Werk einst Bestsellerlisten dominierte, heute jedoch weitgehend aus dem literarischen Gedächtnis verschwunden ist – zumindest, wenn man seine Rolle im Kanon der englischen Literatur beurteilt. Was von ihm geblieben ist, sind Spuren: in der Populärkultur, im Okkultismus, in rechten Mythenkonstrukten und nicht zuletzt in einem Roman, der für all das den Grundstein legte – The Coming Race, erschienen 1871.
Die erste Überraschung: Bulwer-Lytton war kein abseitiger Spinner oder fanatischer Esoteriker. Im Gegenteil – er war ein angesehenes Mitglied der viktorianischen Gesellschaft, Politiker, Innenminister, Adliger. Dass jemand mit einem solchen Hintergrund ein Buch schrieb, in dem eine unterirdisch lebende Superrasse dank einer geheimnisvollen Energiequelle – genannt Vril – eine technomagische Utopie errichtet hatte, lässt bereits ahnen, wie porös die Grenzen zwischen Wissenschaft, Spekulation und Fiktion im 19. Jahrhundert tatsächlich waren.
Dabei war Bulwer-Lytton kein Einzelfall. Die viktorianische Epoche war durchzogen von einer eigenwilligen Mischung aus Rationalität und Mystik. Es war das Zeitalter der Dampfmaschine, aber auch das der Geisterfotografie. Die Entdeckung der Elektrizität entzündete nicht nur neue Technologien, sondern auch ein regelrechtes metaphysisches Faszinosum. Für viele Intellektuelle jener Zeit schien der Naturwissenschaftler ebenso eine Art Magier zu sein – ein neuer Alchemist, der die unsichtbaren Kräfte der Welt zu entlocken versuchte. In genau diesem Kontext betrat Bulwer-Lytton die Bühne.
The Coming Race ist kein gewöhnlicher Abenteuerroman. Der Ich-Erzähler, ein anonymer Amerikaner, gelangt durch einen Unfall beim Besuch eines unterirdischen Bergwerks in eine gigantische Höhlenwelt, in der eine hochentwickelte humanoide Spezies lebt: die Vril-ya. Diese Wesen beherrschen eine Kraft namens „Vril“, die ihnen erlaubt, Materie zu kontrollieren, zu heilen oder zu zerstören – je nach geistigem Zustand des Anwenders. Vril ist dabei weder bloße Technologie noch reine Magie. Es ist ein Naturprinzip, vergleichbar mit Elektrizität oder Magnetismus, jedoch weit umfassender in seiner Wirkung und Präsenz. Es durchdringt alles – Körper, Geist, Raum. Und es folgt einer moralischen Logik: Je höher entwickelt das Individuum, desto verantwortungsvoller sein Umgang mit dem Vril.
Was Bulwer-Lytton hier entwirft, ist nicht nur eine futuristische Gesellschaft, sondern ein Gedankenexperiment über Macht, Ethik und Evolution. Die Vril-ya sind in nahezu allen Bereichen dem Menschen überlegen: technologisch, geistig, spirituell. Doch sie leben nicht in dekadentem Luxus oder tyrannischer Ordnung, sondern in einer Art harmonisch strukturierter Meritokratie, in der Gewalt als Werkzeug längst ausgedient hat. Das Gleichgewicht wird nicht durch Unterdrückung bewahrt, sondern durch Einsicht in die Gefahren des Missbrauchs.
Dass Bulwer-Lytton seine unterirdischen Helden ausgerechnet mit einer weiblich dominierten Gesellschaftsstruktur ausstattet – in der Frauen über mehr Rechte und Weisheit verfügen als Männer – war für seine Zeit fast provokant. Die „Gy-ei“, die weiblichen Mitglieder der Vril-ya, sind politisch führend und körperlich überlegen, was dem viktorianischen Geschlechterbild diametral entgegenstand. Bulwer-Lytton kombinierte hier nicht nur technische Utopie mit esoterischem Energieverständnis, sondern auch ein gesellschaftliches Umdenken, das viele seiner Leser damals befremdet haben dürfte.
Interessant ist, dass The Coming Race sich dem Genre der Science-Fiction bediente, bevor dieser Begriff überhaupt existierte. Der Roman lässt sich heute als früher Vertreter des Genres lesen, doch zu seiner Zeit war er schwer einzuordnen. Leser und Kritiker diskutierten leidenschaftlich darüber, ob das Werk als reine Fiktion gedacht war oder doch eine verschlüsselte Offenbarung über eine verborgene Realität. Genau in dieser Ambiguität liegt ein Schlüssel zur späteren Esoterisierung des Vril-Konzepts.
Denn obwohl Bulwer-Lytton mehrfach betonte, dass sein Roman ein Produkt der Vorstellungskraft sei, griffen bald nach der Veröffentlichung theosophische Zirkel, spiritistische Kreise und esoterische Autoren das Konzept auf, als handele es sich um eine verschollene Wahrheit. Besonders Helena Petrovna Blavatsky, Mitbegründerin der Theosophischen Gesellschaft, hielt große Stücke auf Bulwer-Lytton – nicht wegen seiner politischen Ämter oder stilistischen Eleganz, sondern wegen seiner angeblichen Nähe zu geheimem Wissen. Sie erklärte den Vril kurzerhand zur „ätherischen Urkraft“ der atlantischen Hochkultur – ein Begriff, der bis dahin nur aus Bulwer-Lyttons Fiktion bekannt war.
Doch wie kam es dazu? Warum eignete sich ausgerechnet dieses Buch so gut für eine esoterische Umdeutung? Die Antwort liegt in der Zwischenstellung, die The Coming Race im kulturellen Feld einnimmt: Es war gleichermaßen inspiriert von den neuesten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen wie von den mystischen Traditionen der Antike. Bulwer-Lytton ließ sich von alchemistischen Texten ebenso beeinflussen wie von den Experimenten mit Elektrizität, Magnetismus und „animalischem Fluidum“, wie sie etwa von Franz Anton Mesmer und dessen Nachfolgern propagiert wurden. In diesem Denkklima konnte ein fiktives Energieprinzip wie „Vril“ sehr schnell als plausible Erklärung für bislang unerklärliche Phänomene gelesen werden – ein Begriff, der Lücken füllte, wo weder Wissenschaft noch Religion eine vollständige Antwort bieten konnten.
Damit stellt Bulwer-Lyttons Werk einen kulturellen Katalysator dar: Es brachte disparate Strömungen zusammen, die in anderen Kontexten oft getrennt betrachtet wurden – technische Visionen, spirituelle Spekulationen, politische Ordnungsfantasien. Und weil er all das in eine fesselnde Erzählung verpackte, wirkte es weit über den literarischen Raum hinaus.
Um das Konzept des Vril vollständig zu begreifen, muss man tiefer in das kulturelle und geistige Klima des viktorianischen Englands eintauchen – eine Ära, die auf der einen Seite von atemberaubenden wissenschaftlichen Fortschritten geprägt war und sich gleichzeitig für eine Wiederverzauberung der Welt empfänglich zeigte. Es war ein Zeitalter, in dem Naturwissenschaftler als Helden gefeiert wurden, während man zur selben Zeit in Salons über Séancen diskutierte und in gutbürgerlichen Haushalten Geisterbeschwörungen zur Abendunterhaltung gehörten. Es existierte kein harter Bruch zwischen dem Rationalen und dem Irrationalen, vielmehr waren diese Bereiche Teil ein und desselben Denkraums, der sich durch Neugier, Experimentierfreude und metaphysisches Interesse auszeichnete.
Bulwer-Lytton selbst verkörperte dieses Spannungsverhältnis in seiner Person. Als gebildeter Gentleman mit Zugang zu den wissenschaftlichen Debatten seiner Zeit, zeigte er sich zugleich fasziniert von hermetischen Traditionen, Mesmerismus und spiritistischen Praktiken. Er stand in Kontakt mit Persönlichkeiten, die an der Grenze zwischen Wissenschaft und Esoterik operierten, darunter Magnetismus-Verfechter, Theosophen und frühe Psychologen, deren Theorien heute skurril erscheinen, damals jedoch ernsthafte Alternativen zur Erklärung unerklärlicher Phänomene boten.