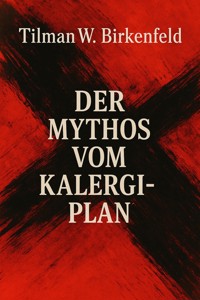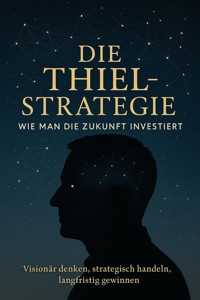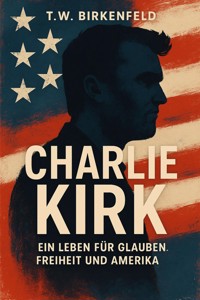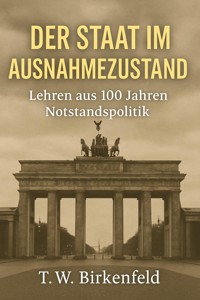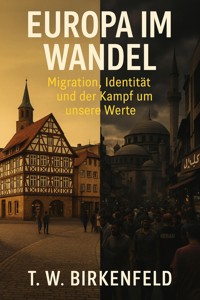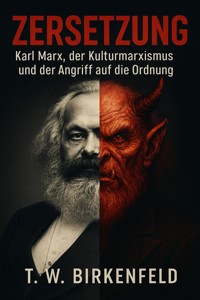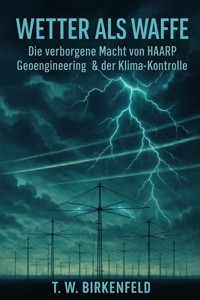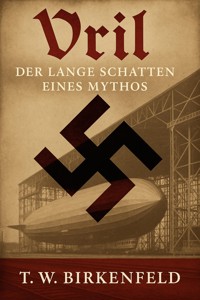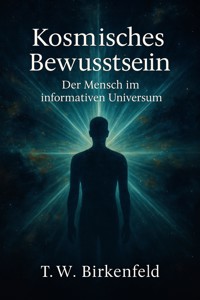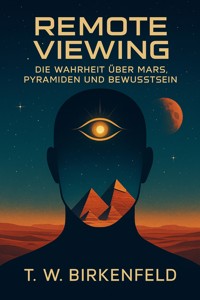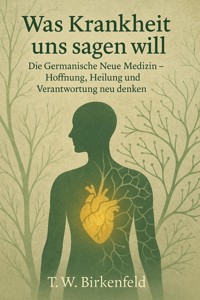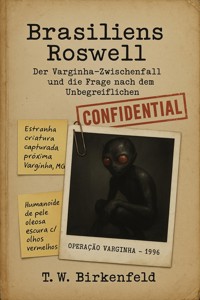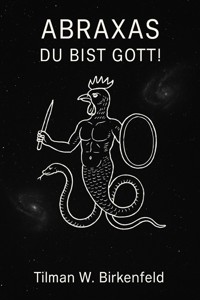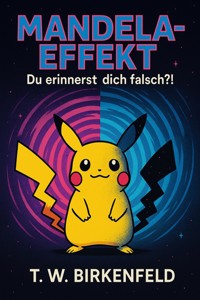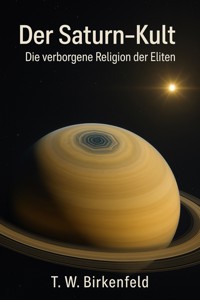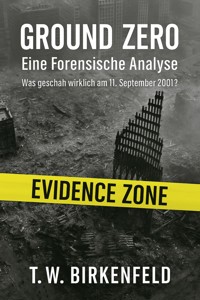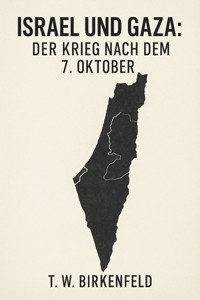
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Konflikt, der Geschichte schreibt – ein Buch, das einordnet, erklärt und herausfordert. Am 7. Oktober 2023 verübte die Hamas den schwersten Angriff auf Israel seit der Staatsgründung. Das Massaker an Zivilisten, die Geiselnahmen und die gezielte Brutalität markierten eine neue Eskalationsstufe im Nahostkonflikt – mit weltweiten Reaktionen und einer tiefen Zäsur in der politischen Debatte. T. W. Birkenfeld zeichnet die historische Entwicklung von der Staatsgründung Israels über Kriege, Intifadas und Friedensversuche bis zur Gegenwart nach. Er analysiert die Rolle von Hamas und Fatah, die Spaltung innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, die innenpolitische Lage Israels sowie das Verhalten der internationalen Gemeinschaft. Mit besonderem Fokus auf die Ereignisse nach dem 7. Oktober zeigt dieses Buch, warum Israels Sicherheit unverzichtbar ist – und was nötig wäre, um aus dem Kreislauf von Terror, Instrumentalisierung und Sprachlosigkeit auszubrechen. Ein sachliches, aber engagiertes Buch für alle, die hinter Schlagzeilen blicken wollen – und verstehen möchten, was war, was ist und was kommen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tilman W. Birkenfeld
Israel und Gaza: Der Krieg nach dem 7. Oktober
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Einleitung – Warum dieses Buch jetzt? Ein persönlicher und journalistischer Zugang zum 7. Oktober und seinen Folgen
Kapitel 1 – Vom Exil zur Heimat: Jüdische Geschichte in Europa und dem Nahen Osten
Kapitel 2 – Palästina unter osmanischer und britischer Herrschaft
Kapitel 3 – Der Holocaust und seine Folgen
Kapitel 4 – 1948: Die Geburt Israels und der erste Krieg
Kapitel 5 – Zwischen Hoffnung und Hass: 1949–1967
Kapitel 6 – Der Sechstagekrieg und seine Folgen
Kapitel 7 – Terror, Intifada und Friedensversuche
Kapitel 8 – Gaza: Von Rückzug zu Raketen
Kapitel 9 – Der Überfall
Kapitel 10 – Die Geiseln und die Weltöffentlichkeit
Kapitel 11 – Israels Antwort: Krieg in Gaza
Kapitel 12 – Die mediale Asymmetrie
Kapitel 13 – Israel innenpolitisch: Polarisierung, Resilienz
Kapitel 14 – Die Palästinenser: Zwischen Terror und Perspektivlosigkeit
Kapitel 15 – Internationale Perspektiven
Kapitel 16 – Was bleibt? Was kommt?
Epilog – Zwischen Erinnerung und Verantwortung
Impressum neobooks
Einleitung – Warum dieses Buch jetzt? Ein persönlicher und journalistischer Zugang zum 7. Oktober und seinen Folgen
Am Morgen des 7. Oktober 2023 veränderte sich etwas Grundsätzliches – nicht nur für Israel, sondern für die gesamte zivilisierte Welt. In den frühen Stunden dieses Tages durchbrachen hunderte Terroristen der Hamas die Grenzanlagen zwischen dem Gazastreifen und Israel. Was folgte, war ein Massaker in einer Brutalität, wie man sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatte. Babys wurden enthauptet, Frauen vergewaltigt, ganze Familien in ihren Häusern verbrannt. Musikfestivalbesucher, junge Menschen, wurden gejagt wie Tiere, verschleppt, erschossen. Mehr als 1.200 Israelis, viele davon Zivilisten, wurden an nur einem einzigen Tag ermordet. Es war der blutigste Tag in der Geschichte des Staates Israel – und der größte Massenmord an Juden seit der Schoah.
Warum also dieses Buch – warum jetzt?Die Antwort liegt in dieser Zäsur, die der 7. Oktober markiert. Dieses Buch entsteht aus der tiefen Überzeugung, dass man die Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts nicht mehr verstehen, einordnen oder ehrlich diskutieren kann, ohne diesen Tag als Wendepunkt zu begreifen. Wer heute über Israel, Gaza, Hamas, Besatzung oder Zwei-Staaten-Lösungen spricht, tut gut daran, sich zunächst die Frage zu stellen: Was ist am 7. Oktober wirklich passiert? Und was bedeutet das für alle folgenden politischen, moralischen und historischen Bewertungen?
Der Impuls, dieses Buch zu schreiben, ist nicht neutral, aber er ist klar: Es geht nicht um platte Parteinahme, sondern um moralische Klarheit in einer Zeit, in der diese zunehmend verloren zu gehen scheint. Der Terror der Hamas war kein politischer Akt – er war ein Angriff auf die Grundlagen menschlichen Zusammenlebens, auf Würde, Freiheit und Leben selbst. Und dennoch begannen bereits wenige Tage nach dem Massaker Stimmen weltweit – in Talkshows, auf Universitätscampussen, in Zeitungsartikeln – zu relativieren, zu erklären, gar zu rechtfertigen, was geschehen war. Der Reflex zur Umkehr der Täter-Opfer-Rollen setzte fast zeitgleich mit dem Angriff ein. Israel, das am Boden lag, trauerte und noch gar nicht realisiert hatte, was ihm angetan worden war, sah sich plötzlich wieder in der Rolle des vermeintlichen Aggressors.
Gerade dieser Umstand macht die Notwendigkeit dieses Buches so dringlich. Es will Erinnerung schaffen, einordnen, dokumentieren. Es will die historische Linie vom jüdischen Exil über den Holocaust bis zur Staatsgründung Israels nachzeichnen – nicht aus Propaganda, sondern aus Wahrheit. Es will erklären, wie sich der Nahostkonflikt entwickelt hat, warum Israel sich immer wieder gegen Kriege und Terror zur Wehr setzen musste, und warum der 7. Oktober ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Nicht nur in der Geschichte Israels, sondern im kollektiven moralischen Koordinatensystem der Welt.
Dieses Buch will dabei auch Brücken schlagen – zwischen Information und Empathie, zwischen Geschichte und Gegenwart. Es richtet sich nicht nur an Experten, Historiker oder Politikinteressierte. Es will Menschen erreichen, die nach Orientierung suchen. Menschen, die spüren, dass der Diskurs über Israel und Palästina oft von Halbwissen, ideologischer Schieflage oder vorschnellen Urteilen geprägt ist. Es will Klarheit schaffen in einer Debatte, die oft von Lärm, Wut und Schwarz-Weiß-Denken dominiert wird.
Denn eines ist nach dem 7. Oktober offensichtlicher denn je: Die Diskussion über Israel ist längst nicht mehr nur eine über Grenzen, Siedlungen oder Resolutionen. Es ist eine Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen: Wer hat das Recht auf Selbstverteidigung? Wann endet Kritik und wann beginnt antisemitischer Hass? Und: Stehen wir als Weltgemeinschaft wirklich an der Seite eines demokratischen Staates, der sich gegen barbarischen Terror verteidigt – oder nur solange es politisch bequem ist?
Dieses Buch ist eine Einladung – zum Denken, Verstehen, Mitfühlen. Und ein Appell: Vergessen wir nicht, was am 7. Oktober geschehen ist. Denn wer die Vergangenheit verdrängt, beraubt sich der Fähigkeit, die Gegenwart zu begreifen. Und wer angesichts von Massakern schweigt oder relativiert, stellt sich selbst auf die falsche Seite der Geschichte.
Kapitel 1 – Vom Exil zur Heimat: Jüdische Geschichte in Europa und dem Nahen Osten
Diaspora, Pogrome, Antisemitismus – die Vorgeschichte einer Heimkehr
Die Geschichte des jüdischen Volkes ist in weiten Teilen eine Geschichte des Exils. Bereits nach der Zerstörung des ersten Tempels in Jerusalem im Jahr 586 v. Chr. durch die Babylonier begannen sich jüdische Gemeinden außerhalb des antiken Israels zu etablieren. Mit der Zerschlagung des jüdischen Aufstands gegen das Römische Reich und der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 n. Chr. setzte sich die Zerstreuung fort. Die Diaspora – das Leben außerhalb der historischen Heimat – wurde zur kollektiven Realität für Generationen. Über Jahrhunderte hinweg bildeten sich jüdische Gemeinschaften in Persien, Nordafrika, später in Spanien, Italien und Mitteleuropa. Trotz aller geografischen Verlagerungen hielten viele Juden an ihren religiösen Traditionen und der Hoffnung auf Rückkehr nach Zion fest.
In Europa waren Juden lange Zeit eine Minderheit unter rechtlicher, sozialer und wirtschaftlicher Beobachtung. Während des Mittelalters wurden sie in zahlreichen Regionen systematisch diskriminiert, aus Städten vertrieben oder mit Sondersteuern belegt. Ihre Rolle als Geldverleiher – eine Tätigkeit, die Christen oft verboten war – nährte Neid und Hass. Immer wieder wurden sie zu Sündenböcken gemacht, insbesondere in Krisenzeiten. Die Pestwellen des 14. Jahrhunderts etwa lösten mörderische Pogrome aus: Man beschuldigte Juden, Brunnen vergiftet zu haben. Ganze Gemeinden wurden ausgelöscht.
Antisemitismus war nicht nur ein Produkt des religiösen Eifers, sondern wurde mit der Zeit immer stärker politisiert und säkularisiert. Der Übergang in die Neuzeit brachte zwar neue Möglichkeiten – etwa durch die jüdische Aufklärung (Haskala) oder die Emanzipation in Teilen Europas –, doch parallel wuchs auch ein moderner Antisemitismus, der sich pseudowissenschaftlich und rassistisch präsentierte. In Ländern wie Russland verschärfte sich die Lage massiv: Zwischen 1881 und 1914 flohen rund zwei Millionen Juden aus dem Zarenreich vor Pogromen, Repressionen und ökonomischer Perspektivlosigkeit, viele in die USA, einige nach Westeuropa und ein kleinerer Teil bereits nach Palästina.
In dieser Gemengelage von Bedrohung und Assimilationsversuch, von Isolation und Selbstbehauptung formte sich eine neue Idee: Die Rückkehr ins eigene Land – nicht bloß als religiöse Hoffnung, sondern als konkretes politisches Projekt. Der Zionismus war geboren.
Ende des 19. Jahrhunderts trat die Vision eines jüdischen Staates in das politische Denken ein. Der Wiener Journalist Theodor Herzl, selbst Zeuge des Dreyfus-Skandals im antisemitisch geprägten Frankreich, wurde zu einer der zentralen Figuren dieser Bewegung. In seinem Werk Der Judenstaat (1896) forderte er ein eigenes Land für das jüdische Volk – nicht als Folge mystischer Prophezeiung, sondern als pragmatische Reaktion auf den strukturellen Hass, dem Juden überall ausgesetzt waren. Herzl war überzeugt: Solange Juden in fremden Gesellschaften als Fremde betrachtet werden, wird es keinen echten Schutz geben. Daher müsse man selbst handeln, selbst gestalten, selbst eine Nation aufbauen.
Schon vor Herzl gab es in Osteuropa kleinere zionistische Bewegungen, etwa die "Chowewei Zion" (Liebhaber Zions), die erste Gruppen von jüdischen Siedlern nach Palästina entsandten. Diese sogenannten "Alijot", die Auswanderungswellen in das damalige osmanisch verwaltete Gebiet, waren oft beschwerlich. Die Lebensumstände in den neuen Siedlungen waren hart, es fehlte an Infrastruktur, Wasser, medizinischer Versorgung. Dennoch wuchs der Zustrom – getragen von der Überzeugung, dass ein jüdisches Leben in Würde und Sicherheit nur in der alten Heimat möglich sei.
Palästina war zu jener Zeit ein vielfach unterschätzter Ort: dünn besiedelt, wirtschaftlich rückständig, politisch marginal. Jüdische Siedler kauften Land – oft zu hohen Preisen – von arabischen Großgrundbesitzern und begannen mit dem Aufbau von Kibbuzim, landwirtschaftlichen Genossenschaften, die auf gemeinschaftlicher Arbeit und Selbstversorgung beruhten. Die Rückkehr war weder romantisch noch reibungslos – sie war von harter Arbeit, Rückschlägen und immer wieder auch von Spannungen mit Teilen der arabischen Bevölkerung begleitet. Doch das Ziel war klar: ein jüdisches Gemeinwesen aufbauen, das selbstbestimmt, demokratisch und zukunftsfähig sein sollte.
Die frühen Zionisten waren keine einheitliche Gruppe. Ihre Ideen reichten von sozialistischen bis hin zu nationalkonservativen Ausprägungen. Was sie verband, war der Glaube, dass das jüdische Volk nicht ewig in Abhängigkeit leben dürfe. Der Antisemitismus in Europa hatte nicht abgenommen, sondern sich gewandelt. Er war in Teilen der Gesellschaft verankert, unabhängig vom politischen System – ob im zaristischen Russland, im deutschen Kaiserreich oder in der französischen Republik. Diese universelle Erfahrung der Ausgrenzung führte zur Erkenntnis, dass es keinen sicheren Ort für Juden geben konnte – außer einen, den sie selbst kontrollierten.
Herzl, dem es zunächst sogar gleichgültig war, wo der jüdische Staat entstehen sollte (er sprach kurzzeitig auch von Argentinien oder Uganda als Optionen), erkannte bald, dass nur Palästina als emotional und historisch aufgeladener Ort geeignet war, breite Unterstützung zu mobilisieren. Mit dem ersten Zionistenkongress in Basel im Jahr 1897 wurde der Grundstein für eine organisierte, weltweite Bewegung gelegt. Herzl schrieb nach dem Kongress in sein Tagebuch: "In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde ich auf allgemeines Gelächter stoßen. In fünf Jahren vielleicht, jedenfalls in fünfzig, wird es jeder einsehen." Fünfzig Jahre später, 1948, wurde der Staat Israel ausgerufen.
Die frühe zionistische Bewegung, ihre Entwicklung und der Weg nach Palästina
Die Jahre nach dem ersten Zionistenkongress markierten eine Phase intensiver organisatorischer, diplomatischer und praktischer Aufbauarbeit. Was mit Visionen und Worten begann, wurde Stück für Stück in politische Realität überführt. In Europa entstanden zionistische Vereine, Zeitungen und Unterstützerkreise, die Spendengelder sammelten, Bildungsarbeit leisteten und Alijot – Auswanderungswellen nach Palästina – organisierten. Die Idee des „Heimkehrens“ wurde zu einer praktischen Lebensentscheidung, die viele junge Juden vor allem aus Osteuropa trafen. Sie verließen ihre Heimatorte, oft ohne Aussicht auf Rückkehr, um Teil eines Projekts zu werden, das größer war als sie selbst.
Die zweite Alija, ab 1904, war geprägt von jungen idealistischen Pionieren, die oft sozialistisch gesinnt waren. Diese Menschen wollten nicht nur einen jüdischen Staat errichten, sie wollten eine neue Gesellschaft schaffen – frei von Klassenunterschieden, religiösem Zwang oder den sozialen Ungerechtigkeiten, die sie in Europa erlebt hatten. In Palästina bauten sie erste Städte, wie Tel Aviv, errichteten Genossenschaften, schufen landwirtschaftliche Infrastrukturen und entwickelten eine neue Form jüdischer Identität: weltlich, wehrhaft, pragmatisch. Auch die hebräische Sprache, die bis dahin im religiösen Kontext und im Gebet überlebt hatte, wurde zu einer modernen Alltagssprache wiederbelebt – ein kultureller Akt von enormer Symbolkraft.
Doch mit dem wachsenden zionistischen Engagement in Palästina wuchs auch der Widerstand. Zunächst war die arabische Bevölkerung dem zionistischen Siedlungsprojekt eher neutral oder unbeteiligt gegenübergestanden, da es wirtschaftliche Entwicklung brachte und Arbeitsplätze schuf. Doch mit zunehmender jüdischer Präsenz und der wachsenden internationalen Aufmerksamkeit veränderte sich die Lage. Erste Unruhen, Anfeindungen und Übergriffe in den 1920er-Jahren zeigten: Der Weg zur Staatlichkeit würde nicht nur mühsam, sondern zunehmend auch gewaltsam.
Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall des Osmanischen Reichs kam Palästina unter britische Kontrolle. Das Völkerbundmandat wurde Großbritannien 1920 zugesprochen – mit dem ausdrücklichen Ziel, die sogenannte „Balfour-Deklaration“ von 1917 umzusetzen. In diesem Dokument hatte die britische Regierung öffentlich erklärt, dass sie „die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina mit Wohlwollen betrachten“ werde. Diese diplomatische Formulierung war für die Zionisten ein historischer Durchbruch, für viele arabische Nationalisten hingegen eine Provokation.
In den Jahren des britischen Mandats (1920–1948) spitzte sich die Lage weiter zu. Die jüdische Bevölkerung wuchs durch mehrere Alijot, die von Pogromen, Nationalismus und später auch dem aufkommenden Faschismus in Europa angetrieben wurden. Parallel dazu formierte sich unter den arabischen Bewohnern Palästinas eine politische Identität, die zunehmend im Gegensatz zum jüdischen Staatlichkeitsprojekt stand. Die Arabische Revolte von 1936 bis 1939 war ein deutlicher Ausdruck dieses Widerstands. Die britische Reaktion fiel brutal aus, aber auch die jüdische Verteidigungsorganisation Haganah begann, sich militärisch zu strukturieren.
Die 1930er-Jahre brachten eine dramatische Zuspitzung: In Deutschland übernahmen die Nationalsozialisten die Macht. Der staatlich organisierte Antisemitismus der NS-Zeit, gipfelnd in der Shoah, führte dazu, dass der Zionismus nicht länger als Utopie erschien, sondern als existenzielle Notwendigkeit. Millionen Juden in Europa suchten verzweifelt nach Fluchtmöglichkeiten – doch viele Staaten hielten ihre Grenzen geschlossen. Palästina war eines der wenigen realistischen Ziele, wenngleich die britischen Behörden mit Einreisebeschränkungen reagierten, um Spannungen mit der arabischen Bevölkerung zu vermeiden.
Tausende Juden, oft illegal und unter Lebensgefahr, erreichten dennoch Palästina. Sie kamen in überfüllten Schiffen, durch Schmuggelrouten oder mit gefälschten Papieren. Diese Phase – die Zeit der sogenannten „Aliyah Bet“ – war geprägt von dramatischen Rettungsaktionen und gleichzeitig wachsendem politischem Druck. Die jüdische Gemeinschaft in Palästina, das „Jischuw“, entwickelte sich während dieser Zeit zu einer proto-staatlichen Struktur. Mit Schulen, Krankenhäusern, Verteidigungsorganisationen und politischen Institutionen legte sie den Grundstein für das, was 1948 formal ausgerufen wurde: den Staat Israel.
Die frühe zionistische Bewegung war also keine uniforme ideologische Strömung, sondern ein komplexes Geflecht aus Hoffnung, Schutzsuche, Selbstbehauptung und Nationenbildung. Sie war eine Reaktion auf die historische Erfahrung von Ausgrenzung, Verfolgung und Heimatlosigkeit – und zugleich ein zutiefst moderner Versuch, das Schicksal des jüdischen Volkes nicht mehr anderen zu überlassen. Die Rückkehr nach Palästina war keine romantische Heimkehr in ein verklärtes „Heiliges Land“, sondern ein praktischer, oft konfliktgeladener Prozess, der unter großem persönlichen Einsatz geführt wurde.
Was als vage Idee in europäischen Salons und auf Kongressen begann, wurde durch die historischen Umstände – vor allem durch die Gewalt gegen Juden in Europa – zu einem Projekt von globaler Relevanz. Die Geschichte des Zionismus ist damit auch die Geschichte davon, wie ein über Jahrhunderte entrechtetes Volk Schritt für Schritt versuchte, Kontrolle über sein eigenes Schicksal zu gewinnen. Dieser Versuch verlief nicht konfliktfrei und war auch nie frei von inneren Widersprüchen. Doch er war getragen von dem Wunsch, endlich einen Ort zu schaffen, an dem Juden nicht mehr Opfer fremder Gewalt sein mussten – sondern Bürger ihres eigenen Staates.
Kapitel 2 – Palästina unter osmanischer und britischer Herrschaft
Politische Weichenstellungen, internationale Interessen und erste Konfliktlinien
Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war Palästina ein Randgebiet innerhalb des Osmanischen Reichs. Die Region war in erster Linie agrarisch geprägt, mit einer dünnen, verstreuten Bevölkerung. Jerusalem war ein religiöses Zentrum, das Juden, Christen und Muslime gleichermaßen anzog. Politisch und wirtschaftlich jedoch spielte Palästina im größeren Rahmen des Osmanischen Reichs kaum eine Rolle. Verwaltet wurde das Gebiet durch osmanische Statthalter, während lokale Eliten – arabische Großgrundbesitzer und religiöse Würdenträger – in der Gesellschaft das Sagen hatten.
Die jüdische Einwanderung, die mit den ersten zionistischen Alijot Ende des 19. Jahrhunderts einsetzte, war für viele Araber in Palästina zunächst kein zentrales Thema. Die ersten Einwanderer waren relativ wenige, viele kamen mit der Absicht, brachliegendes Land zu kaufen und zu bewirtschaften. In dieser frühen Phase entstanden landwirtschaftliche Kollektive und Siedlungen, die sich meist auf legal erworbenem Grund entwickelten. Die wirtschaftliche Belebung, die von diesen jüdischen Siedlungen ausging, wurde teilweise sogar begrüßt. Einige arabische Landbesitzer profitierten vom Verkauf von Flächen, die sie bis dahin nicht selbst nutzten.
Mit dem Ersten Weltkrieg veränderte sich das geopolitische Bild jedoch grundlegend. Das Osmanische Reich kämpfte an der Seite der Mittelmächte und verlor mit Kriegsende seine Kontrolle über große Teile des Nahen Ostens. Bereits während des Kriegs begannen Großbritannien und Frankreich, ihre jeweiligen Einflusssphären im östlichen Mittelmeerraum zu planen. Diese Absichten wurden im sogenannten Sykes-Picot-Abkommen 1916 festgehalten, einem geheimen Vertrag, der die Aufteilung der osmanischen Gebiete zwischen beiden Kolonialmächten regelte. Palästina war dabei zunächst als internationale Zone vorgesehen.
Parallel dazu versuchte Großbritannien, sich die Unterstützung verschiedener Gruppen im Nahen Osten zu sichern. Einerseits versprach es in den Hussein-McMahon-Briefen arabischen Anführern Autonomie oder gar Unabhängigkeit im Gegenzug für einen Aufstand gegen die Osmanen. Andererseits wandte sich die britische Regierung im November 1917 mit der sogenannten Balfour-Deklaration an die zionistische Bewegung. In einem knappen Schreiben erklärte der damalige Außenminister Arthur Balfour, dass Großbritannien „die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina mit Wohlwollen betrachte“ und dafür eintrete, „dass nichts getan werde, was die bürgerlichen und religiösen Rechte bestehender nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina beeinträchtigt“.
Dieses Dokument markierte einen Wendepunkt. Die Balfour-Deklaration war keine formale völkerrechtliche Verpflichtung, doch sie verlieh dem zionistischen Projekt eine neue politische Legitimation. Für viele Juden in Europa und Amerika war sie ein Zeichen, dass ihr Streben nach Selbstbestimmung internationale Anerkennung finden könnte. Der Text war allerdings vage gehalten und ließ Interpretationsspielraum. Während Juden in der Erklärung eine historische Chance sahen, fühlten sich arabische Gruppen verraten – insbesondere, weil ihnen ebenfalls politische Unabhängigkeit versprochen worden war.
Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm Großbritannien offiziell die Kontrolle über Palästina im Rahmen eines Mandats des Völkerbunds. Dieses Mandat, das ab 1920 wirksam wurde, beauftragte die britische Verwaltung, die Umsetzung der Balfour-Deklaration zu unterstützen und zugleich die Rechte aller Bevölkerungsgruppen zu wahren. Diese doppelte Zielsetzung erwies sich rasch als problematisch. Die jüdische Einwanderung nahm zu, vor allem durch Pogrome in Osteuropa und die zunehmende Instabilität nach der russischen Revolution. Viele Jüdinnen und Juden, die vor Gewalt und Armut flohen, kamen nun nach Palästina. In den Städten, besonders in Tel Aviv und Haifa, wuchs die jüdische Bevölkerung deutlich.
Die wachsende Präsenz neuer Siedlungen, wirtschaftlicher Strukturen und politischer Organisationen führte zu Unruhe innerhalb der arabischen Bevölkerung. Lokale Führer befürchteten, dass die jüdische Einwanderung langfristig nicht nur demografische, sondern auch politische Verschiebungen mit sich bringen würde. Erste Proteste wurden laut, und bereits in den 1920er-Jahren kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Die Unruhen von 1920 in Jerusalem, die Pogrome von 1929 in Hebron und anderen Orten markierten den Beginn eines zunehmend gewaltsam ausgetragenen Konflikts.
Der britischen Mandatsmacht gelang es nur unzureichend, zwischen den Gruppen zu vermitteln. Ihre Haltung schwankte zwischen der Unterstützung zionistischer Infrastrukturprojekte und dem Versuch, arabische Unzufriedenheit zu beschwichtigen. Die Briten gerieten in eine politische Zwickmühle, da sie sowohl strategische Interessen in der Region verfolgten als auch auf die politische Unterstützung jüdischer Kreise in London und Washington angewiesen waren. Die Widersprüchlichkeit ihrer Politik ließ beide Seiten zunehmend misstrauisch werden.
In dieser Phase wurde der Widerstand gegen die jüdische Einwanderung nicht nur stärker, sondern auch organisierter. Arabische Führer wie Amin al-Husseini, der Großmufti von Jerusalem, mobilisierten gezielt gegen die jüdische Präsenz. Sie stellten das zionistische Projekt als kolonialistische Invasion dar, die die angestammte arabische Bevölkerung verdrängen wolle. Der Widerstand nahm nicht nur die Form von Demonstrationen oder Boykottbewegungen an, sondern schlug immer wieder in offene Gewalt um.