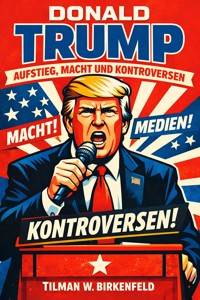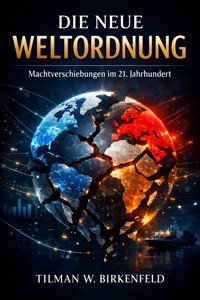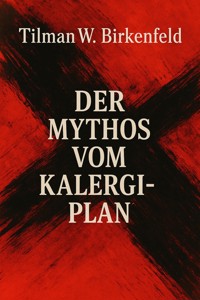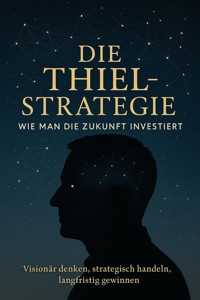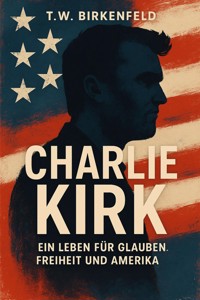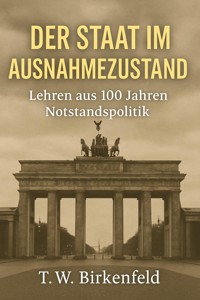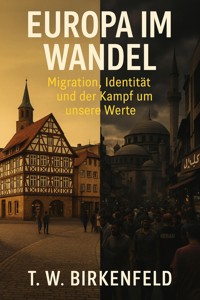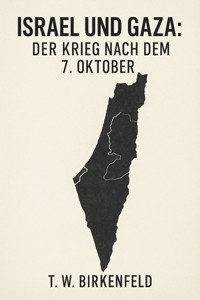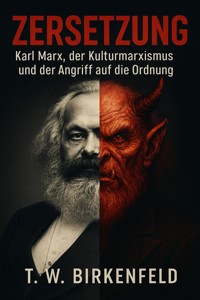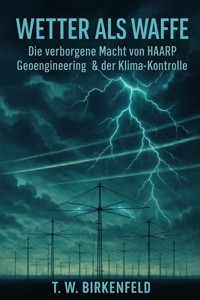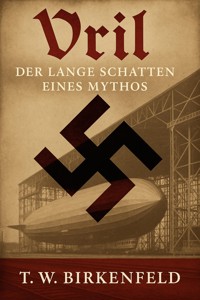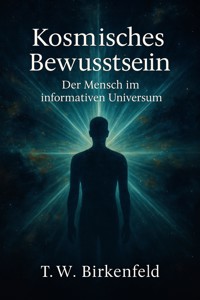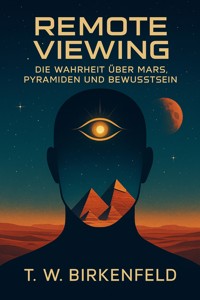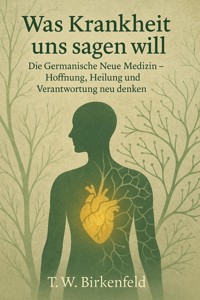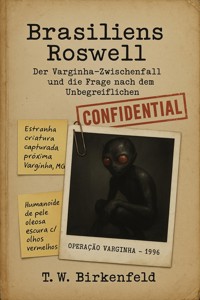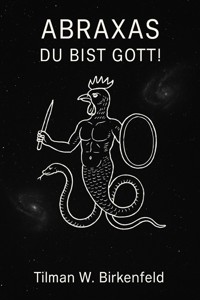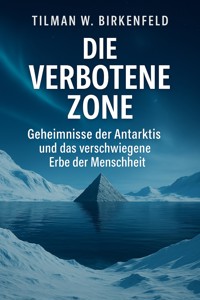
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was, wenn die Antarktis nicht nur ein Kontinent aus Eis ist – sondern ein Archiv verlorener Wahrheiten? Tilman W. Birkenfeld nimmt den Leser mit auf eine atemraubende Spurensuche an den Rand des Bekannten: von Admiral Byrds mysteriöser Operation Highjump über das dunkle Erbe von Neuschwabenland, verborgene Pyramidenstrukturen und die Theorie einer vergessenen Megazivilisation namens Tartaria – bis hin zu elektromagnetischen Netzen, außerirdischen Artefakten und dem globalen Schweigen um das südlichste Gebiet der Erde. Basierend auf historischen Karten, geleakten Dokumenten, Augenzeugenberichten und eigenen Recherchereisen fragt dieses Buch: Was liegt wirklich unter dem Eis? Und warum dürfen wir es nicht wissen? Ein faktennahes Sachbuch mit essayistischen Einschüben, ein dokumentarischer Reisebericht – und ein provozierender Blick auf die blinden Stellen unserer Weltkarte. "Es geht nicht darum, alles zu glauben. Es geht darum, zu erkennen, wo das Fragen endet – und warum."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tilman W. Birkenfeld
Die verbotene Zone
Geheimnisse der Antarktis und das verschwiegene Erbe der Menschheit
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Kapitel 1: Operation Highjump – Der Krieg, der nie endete
Kapitel 2: Neuschwabenland – Das vierte Reich im Eis
Kapitel 3: Pyramiden im Permafrost – Die unterdrückte Archäologie
Kapitel 4: Tartaria unter Eis – Die vergessene Megazivilisation
Kapitel 5: Die Mauer am Ende der Welt – Flat Earth und der Rand
Kapitel 6: HAARP, Frequenzen und die verborgene Kommunikation
Kapitel 7: Artefakte der Anunnaki – Außerirdische unter dem Eis
Kapitel 8: Geheimverträge und der große Konsens
Kapitel 9: Tilman in Neuschwabenland – Eine Reise ins Verborgene
Nachwort: Warum wir trotzdem gehen müssen
Impressum neobooks
Vorwort
Von Tilman W. Birkenfeld
„Die größte Lüge ist jene, die als lächerlich gilt.“(aus einem anonymen Brief an den Autor)
Es gibt Orte, über die kaum jemand spricht – nicht, weil sie unbedeutend wären, sondern weil man nicht soll. Die Antarktis ist ein solcher Ort. Ein Kontinent, der größer ist als Europa, aber in unserem kulturellen Gedächtnis kaum mehr als eine weiße Fläche darstellt. Pinguine, Schnee, ein paar Forschungsstationen, vielleicht ein altes Expeditionsfoto – das war’s. Aber was, wenn das nur die offizielle Geschichte ist? Eine Fassade, sorgfältig konstruiert, um uns vom eigentlichen Interesse abzulenken?
Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal auf die sogenannten "Neuschwabenland-Dokumente" stieß – eine schlecht gescannte Mappe, anonym gepostet in einem obskuren Archivforum – dachte ich, ich hätte es mit dem üblichen verschwörungstheoretischen Irrsinn zu tun: Nazis unter dem Eis, UFOs am Südpol, alte Zivilisationen mit Energiekristallen. Ich lachte. Und dann las ich weiter.
Denn zwischen dem Irrsinn liegt etwas. Nicht unbedingt Wahrheit, aber Muster. Wiederholungen. Namen. Koordinaten. Karten, die nicht übereinstimmen. Expeditionen, die scheiterten – oder nie dokumentiert wurden. Verträge, die verhindern, dass jemand zu nahe kommt. Und vor allem: eine anhaltende Mühe, all das ins Lächerliche zu ziehen. In meiner Erfahrung ist genau das immer ein Hinweis.
Dieses Buch ist keine These, sondern eine Reise. Kein endgültiger Beweis, sondern eine Sammlung. Sie finden darin Geschichten, Karten, Auszüge, Begegnungen, Zitate, Wahnsinn und gelegentlich Klarheit. Ich erhebe nicht den Anspruch, etwas zu entlarven – vielmehr will ich zeigen, wie viele Schichten das Eis tatsächlich hat.
Die Antarktis ist nicht nur kalt. Sie ist absichtlich kalt. Eine natürliche Grenze – aber vielleicht auch eine kulturelle. Jenseits davon beginnt etwas, das mit unserem üblichen Verständnis von Geschichte, Macht und Realität nicht mehr kompatibel ist. Ich nenne es: die verbotene Zone.
T.W.B.
Kapitel 1: Operation Highjump – Der Krieg, der nie endete
Eine Expedition der Extreme
Im Spätsommer 1946, nur ein Jahr nach dem Abwurf der ersten Atombombe und der offiziellen Kapitulation des Deutschen Reiches, geschah etwas Merkwürdiges. Während Europa in Trümmern lag und sich die Weltöffentlichkeit langsam wieder dem Frieden zuwandte, rüsteten die Vereinigten Staaten erneut auf. Doch diesmal richtete sich der Blick nicht gen Osten, nicht nach Moskau, nicht nach Fernost – sondern tief in den Süden. In eine Region, die bisher fast ausschließlich das Reich der Wissenschaftler, Träumer und Wahnsinnigen gewesen war: die Antarktis.
Es war, als wollte man etwas beenden, das nie ganz begonnen hatte.
Im Zentrum dieser Bewegung stand ein Mann, den man im amerikanischen Bewusstsein irgendwo zwischen Entdeckerlegende und Kriegsheld verortete: Admiral Richard Evelyn Byrd. Fliegerpionier, dreifacher Polarkreuzträger, ein Charakter wie aus einem Abenteuerroman der Vorkriegszeit. Byrd war nicht irgendein Befehlshaber. Er war Symbol. Integrität mit Fliegermütze. Wenn er einen Befehl ausführte, zweifelte niemand – zumindest nicht öffentlich.
Sein Auftrag? Eine Expedition in die unwirtlichste Region der Erde, ausgestattet mit einer Flotte, wie sie selbst in Kriegszeiten selten gesichtet wurde. Der Verband umfasste dreizehn Schiffe, darunter der Flugzeugträger USS Philippine Sea, der Zerstörer USS Brownson, ein Versorgungsschiff, ein U-Boot (USS Sennet), mehrere Eisbrecher, Tanker – und eine Einheit von über 4.700 Mann. Begleitet wurden sie von 33 Flugzeugen, darunter Wasserflugzeuge, Langstreckenbomber, Helikopter und Spähmaschinen. Die Mission erhielt den technischen Namen: The United States Navy Antarctic Developments Program 1946–1947. Intern nannte man sie: Operation Highjump.
Offiziell, so hieß es in den kommuniqués, sollte man die Belastbarkeit von Mensch und Maschine unter extremen klimatischen Bedingungen testen. Man wolle logistische Abläufe proben, das Verhalten von Flugzeugen bei Eiseskälte untersuchen, Gelände erfassen und kartografieren – also im Grunde: forschen, üben, messen. Das erklärte Ziel war es, binnen acht Monaten eine Vielzahl wissenschaftlicher Daten zu sammeln, Eisflächen zu vermessen und potenzielle Versorgungswege zu prüfen.
Doch wer das Ausmaß der Mission betrachtet, dem drängt sich eine unbequeme Frage auf:Warum ein solcher Aufwand – für Forschung?
Warum eine halbe Kriegsflotte an einen Ort entsenden, der in geopolitischer Hinsicht, zumindest nach damaligem Kenntnisstand, als leer, roh und ökonomisch bedeutungslos galt? Es gab dort keine Städte, keine Ressourcen, keine Gegner. Es war ein Kontinent aus Eis, von dem selbst die präzisesten Karten nur Ränder kannten. Und doch behandelte ihn das US-Militär, als würde es sich auf eine Invasion vorbereiten.
War es bloß ein Zeichen militärischer Überlegenheit in Zeiten des Kalten Kriegs – eine Machtdemonstration vor sowjetischen Augen? Oder steckte mehr dahinter? Eine Suche? Eine Reaktion? Oder gar eine Bereinigung?
In den Depeschen jener Zeit liest man zwischen den Zeilen eine gewisse Hast. Als hätte man sich beeilt, etwas zu erreichen, bevor jemand anders es tat. Oder bevor es sich endgültig verbarg.
Ein Marineoffizier, der anonym bleiben wollte, schrieb Jahrzehnte später in einem Brief an einen Historiker:
„Wir wurden nicht in die Antarktis geschickt, um das Wetter zu testen. Wir wurden geschickt, um etwas zu finden. Etwas, das dort nicht sein sollte.“
Was dieses etwas war, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Aber das Ausmaß, die Geheimhaltung, und vor allem die spätere Sprachlosigkeit der Beteiligten, deuten darauf hin, dass Operation Highjump mehr war als ein logistisches Trainingslager auf Eis. Sie war – wie so vieles in dieser Zeit – ein Spiel mit dem Unbekannten. Und womöglich ein erstes ernsthaftes Kräftemessen mit etwas, das außerhalb unseres Weltbilds lag.
Ein „Trainingsmanöver“, so wurde es genannt. Aber es war ein Zug ins tiefste Weiß, von dem viele zurückkehrten – und nie wieder sprachen.
Der Feind unter dem Eis
Der Anfang war harmlos – jedenfalls auf dem Papier. Ein paar ausgefallene Funksprüche. Kleine technische Defekte, wie sie unter den harschen Bedingungen des antarktischen Sommers nichts Ungewöhnliches sind. Doch schon bald wandelte sich das Bild. Die Berichte, zunächst spärlich und ausweichend, wurden zahlreicher, klarer – und vor allem: seltsamer.
Zuerst waren es nur die Funker. Sie meldeten, dass Kanäle plötzlich wie abgeschnitten wirkten, als hätte sich eine Wand zwischen Sender und Empfänger geschoben. Es war keine einfache Störung. Es war ein plötzlicher, totaler Ausfall – mit einem scharfen metallischen Ton, der einige der Männer später als „bohrend“ beschrieben. Dann kamen die Sichtungen.
Ein Wachposten auf dem Eisbrecher USS Burton Island berichtete von einem leuchtenden Objekt, das „ohne Geräusch“ mit hoher Geschwindigkeit über das Eis raste – aus dem Nichts auftauchend, im nächsten Moment wieder verschwunden. Zuerst wurde er belächelt. Dann meldete sich ein Pilot zu Wort. Und noch einer. Und noch einer.
Alle beschrieben dasselbe Phänomen: metallisch schimmernde, scheibenförmige Flugobjekte, die in Flugmanövern agierten, die jenseits jeglicher irdischer Aerodynamik lagen. Kein Gieren, kein Kreisen – nur blitzartige Richtungswechsel, Bewegungen wie von Gedanken gelenkt. Geschwindigkeit: unmöglich zu messen. Herkunft: unbekannt. Technische Erklärung: nicht vorhanden.
Ein Pilot, der anonym bleiben wollte, schrieb später in sein Tagebuch:
„Ich habe Kampfflugzeuge gesehen. Ich habe V2-Raketen gesehen. Aber das da … das war, als würde jemand die Regeln des Himmels neu schreiben.“
Die Stimmung an Bord der Schiffe kippte. Es wurde nicht mehr gelacht. Die Soldaten blieben länger unter Deck. Die Maschinen, die sich noch am ersten Tag stolz über die Eisschollen geschwungen hatten, hoben nun seltener ab. Und wenn sie es taten, geschah es mit einer wachsenden, unausgesprochenen Furcht.
Dann kam der Vorfall vom 3. Februar 1947.
Zwei Maschinen, eine PBM Mariner und ein Aufklärungsflugzeug, starteten zu einem Routineflug über das sogenannte Queen Maud Land – ein Gebiet, das auf manchen Karten als „Neuschwabenland“ bezeichnet war. Sie funken kurz nach dem Start wie gewohnt. Dann Stille. Als man schließlich eine Suchmission entsandte, fand man nur noch Trümmer. Metallteile. Verschmortes Plexiglas. Keine Überlebenden. Keine Erklärung.
In einem internen Lagebericht, der später in einem Archiv in Buenos Aires auftauchte – handschriftlich, nicht offiziell – heißt es:
„Kontakt abgebrochen. Sichtung von Lichtphänomenen. Keine Flugabwehr erkennbar. Verlust nicht nachvollziehbar.“
Zeitgleich meldeten mehrere lateinamerikanische Zeitungen, darunter El Mercurio (Chile) und La Prensa (Argentinien), unbestätigte Berichte über ein Luftgefecht in der Antarktis. Angeblich seien amerikanische Maschinen „von unbekannten Flugobjekten angegriffen“ worden. Die Quellen blieben anonym, der Wortlaut vage. Doch sie tauchten innerhalb von 48 Stunden in mehreren voneinander unabhängigen Publikationen auf.
Augenzeugen, zitiert in einem inzwischen verschwundenen Radiomitschnitt aus Ushuaia, sprachen von „Feuern am Himmel“, von einem „summenden Lichtball“, der „nicht flog, sondern erschien“. Ein Fischer an der Küste von Feuerland behauptete, er habe „drei Explosionen am Horizont“ gesehen, „wie Sonnenaufgänge in der Nacht“.
Was geschah dort wirklich?
Die US Navy schwieg. Keine offiziellen Verluste wurden anerkannt. Die Toten wurden nicht öffentlich genannt. Die Berichte der Flugzeuge – sofern sie überhaupt existieren – verschwanden. Admiral Byrd selbst ließ jede Pressekonferenz zu diesem Thema abbrechen oder umleiten. Später, so heißt es, sei er nervös geworden. In sich gekehrt. Manche sprachen sogar von einem leichten Zittern in seinen Händen, als er am 10. März 1947 das letzte Mal vor der Kamera erschien.
Bis heute ist nicht geklärt, was Operation Highjump an jenem Februar-Wochenende wirklich begegnete. War es eine unbekannte Technologie? Ein Überbleibsel aus dem Krieg? Etwas Außerirdisches? Oder schlicht ein kollektives Trauma im ewigen Weiß?
Doch eines ist sicher: Etwas griff ein. Etwas, das dort unten war – im Eis, über dem Eis, unter dem Himmel, der über allem liegt.
Ein Feind? Vielleicht. Aber wenn ja – dann keiner, den man mit Kanonen vertreiben kann.
Das Byrd-Interview
Manchmal genügt ein einziger Satz, um Jahrzehnte später noch nachzuhallen – wie ein schwacher Funkspruch aus einer anderen Zeit. Im Fall von Admiral Richard Evelyn Byrd war es ein Zitat, das weniger durch seine Wortwahl als durch seine Herkunft und seinen Kontext schockierte. Es war nicht, was er sagte – sondern dass er es sagte.
Nach dem abrupten Abbruch der Operation Highjump im März 1947, wenige Wochen nachdem mehrere Zwischenfälle in der Antarktis für Irritationen innerhalb der amerikanischen Marine gesorgt hatten, kehrte Byrd über Südamerika zurück. Ein Zwischenstopp in Valparaíso, Chile – offiziell aus logistischen Gründen. Inoffiziell, so munkelt man, war es eine Art Zwischenraum, eine Pause, in der er noch sprechen durfte, bevor er es nicht mehr sollte.
Am 5. März 1947 erschien in der konservativen chilenischen Zeitung El Mercurio ein Artikel, der bis heute zu den meistzitierten, zugleich aber am wenigsten überprüfbaren Fragmenten der Nachkriegsgeschichte gehört. Der Text erschien auf Seite eins, neben Börsendaten und einem Bericht über die Lage in Griechenland. Der Titel:„Admiral Byrd warnt: USA müssen sich auf Angriffe über die Polarregion vorbereiten“.
Darin wurde Byrd mit den Worten zitiert:
„Die Vereinigten Staaten sollten sich dringend auf die Möglichkeit vorbereiten, durch Flugobjekte angegriffen zu werden, die in der Lage sind, von einem Pol zum anderen mit unglaublicher Geschwindigkeit zu fliegen.“
Ein einzelner Satz. Keine weiteren Erklärungen. Kein technischer Kontext. Keine Kategorisierung der Bedrohung – kein Hinweis, ob diese Objekte irdischer, außerirdischer oder sonstiger Herkunft seien. Doch der Satz fiel. Und die Wirkung war explosiv – zumindest in den Kreisen, die wussten, wonach sie zu suchen hatten.
In den Vereinigten Staaten wurde das Zitat nie offiziell anerkannt. Es wurde nie dementiert, aber auch nie wiederholt. Weder in Pressekonferenzen noch in offiziellen Protokollen der Navy tauchte es auf. Einige Historiker behaupteten später, es habe sich um eine Fehlübersetzung gehandelt. Andere – vor allem aus dem Lager der Skeptiker – behaupteten, das Interview sei frei erfunden worden. Doch Kopien des Artikels existieren. Im Mikrofilmarchiv der Biblioteca Nacional de Chile findet man ihn bis heute – gelistet, nummeriert, datiert.
Was passierte danach?
Admiral Byrd kehrte zurück in die Vereinigten Staaten – doch er war nicht mehr derselbe. Die einst so omnipräsente Gallionsfigur amerikanischer Forschung zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Auftritte wurden abgesagt. Vorträge verschoben. Interviews verweigert. Selbst bei der anschließenden Operation Deep Freeze (1955–1956) trat er nicht mehr in leitender Funktion auf. Er war noch dabei – aber er wirkte, so ein Weggefährte später, „wie ein Schatten hinter Glas“.
Ein ehemaliger Assistent Byrds, der anonym bleiben wollte, berichtete in einem Tonbandinterview, das 1986 dem Forscher Michael C. Jansen übergeben wurde:
„Er wurde still. Nachdenklich. Manchmal saß er einfach da, schaute auf eine leere Karte und sagte: ‚Wenn die Leute wüssten, was da draußen ist …‘“
Was meinte Byrd?
Die Spekulationen nahmen ihren Lauf. Einige glaubten, er habe während Highjump mit außerirdischer Technologie Kontakt gehabt – oder zumindest deren Spuren gesehen. Andere sahen in seinen Worten einen Hinweis auf geheime Nazi-Fluggeräte, die aus Stützpunkten in der Antarktis operierten. Wieder andere vermuteten, Byrd sei schlicht von der psychischen Belastung der Antarktis zerbrochen. Eine vierte Gruppe – die vielleicht beunruhigendste – behauptet bis heute, dass Byrd nicht allein gesprochen habe, sondern im Auftrag.
Was, wenn das Interview keine spontane Aussage war, sondern ein gezielter Warnschuss an diejenigen, die verstanden, was gemeint war?
Der Begriff „Flugobjekte, die von einem Pol zum anderen fliegen können“ lässt sich auf viele Arten deuten. Technologie. Macht. Geschwindigkeit. Aber vor allem: Unkontrollierbarkeit. Etwas, das sich jenseits der bekannten Spielregeln bewegt. Byrds Warnung war keine strategische. Sie war existenziell.
Und genau das war vermutlich das Problem.
Ein Jahr nach dem Interview verschwand der Artikel aus den chilenischen Pressediensten. Archive wurden bereinigt, Kopien entfernt. Heute sind nur noch wenige Originale erhalten. Ein einzelnes, vergilbtes Exemplar liegt im Privatarchiv des deutschen Polarforschers Dr. Lukas Heisler – sorgfältig laminiert, eingeklemmt zwischen einem Expeditionsprotokoll von 1939 und einem sowjetischen Wetterbericht aus dem Jahr 1952.
Ich durfte es 2019 sehen. Und ich erinnere mich, dass es beim Umblättern kurz nach Schwefel roch.
Neuschwabenland und das Erbe der Nazis
Es war ein seltsamer Anblick: ein deutscher Flugzeugträger, der keiner war, inmitten einer leeren, schneeweißen Welt, über deren Oberfläche plötzlich Hakenkreuz-Flaggen herabschwebten – abgeworfen von der Luftwaffe, in metallischen Zylindern verpackt. Die „Schwabenland“, ein umgebautes Passagierschiff mit Startkatapulten, war nicht für den Krieg gebaut, aber für einen seltsamen, eisigen Eroberungsdrang umgerüstet worden. Im Januar 1939 erreichte sie die Antarktis – und mit ihr begann ein Mythos, der bis heute nicht zu schweigen ist: Neuschwabenland.
Offiziell handelte es sich um eine wissenschaftliche Expedition, durchgeführt von der Deutschen Reichsmarine und der Luftwaffe. Das Ziel war, angeblich, die Erkundung neuer Fanggebiete für den Walfang – eine logistische, ökonomische Maßnahme, so harmlos wie pragmatisch. Doch niemand, der sich je ernsthaft mit dem Dritten Reich beschäftigt hat, glaubt an derartige Alibis. Nicht in diesem Maßstab.
Zwischen Januar und Februar 1939 überflogen die speziell ausgerüsteten Flugzeuge vom Typ Dornier Wal ein riesiges Gebiet im östlichen Teil der Antarktis – und belegten es, nach damaliger Lesart, für das Deutsche Reich. Man warf nicht nur Flaggen ab, man kartografierte auch akribisch, fotografierte, vermaß – mit einer Gründlichkeit, wie sie kaum zu einem „Erkundungsflug“ passte. Auf den Karten wurde das Areal als Neuschwabenland eingetragen, benannt nach dem Expeditionsschiff. Ein neues Territorium – in einer Welt, die zu dieser Zeit schon fast vollständig aufgeteilt war.
Doch der wahre Kern des Mythos liegt nicht in der offiziellen Kartografie, sondern in dem, was danach geschah – oder vielleicht eben nicht mehr dokumentiert wurde.
In den Jahren nach dem Krieg, als sich allmählich das ganze Ausmaß des nationalsozialistischen Größenwahns offenbarte, tauchten auch Gerüchte über geheime Basen in der Antarktis auf. Unterirdische Anlagen, Tunnelnetzwerke, Hohlräume unter dem Eis. Manche Theorien – besonders im angloamerikanischen Raum – gingen sogar so weit zu behaupten, dass Teile der Nazi-Führung sich in den letzten Kriegsmonaten dorthin abgesetzt hätten. Adolf Hitler selbst, so diese Narrative, sei nicht in Berlin gestorben, sondern unter das Eis geflohen – geschützt von einer Eliteeinheit der Waffen-SS und transportiert von U-Booten der Typen XXI und XXIII, deren Reichweiten und Tarntechnologien ihrer Zeit voraus gewesen sein sollen.
So abwegig das klingt: Der historische Boden, auf dem diese Geschichten keimen, ist nicht vollkommen leer.
U-530 und U-977, zwei deutsche U-Boote, kapitulierten erst Monate nach Kriegsende in Argentinien – über 70 Tage nach der Kapitulation. Ihre Kommandanten machten vage Angaben über ihre Routen. Es gab keine vollständigen Logbücher, keine Erklärung, warum man so lange unterwegs war, warum man sich nicht früher stellte. Und es gab diese merkwürdige Übereinstimmung mit Aussagen argentinischer Fischer, die von „deutschen Schiffen“ berichteten, die weiter Richtung Süden fuhren – und nie zurückkehrten.
Ein ehemaliger norwegischer Polarforscher, der im Jahr 1954 unter UN-Flagge im Rahmen eines internationalen Vermessungsprojekts in Queen Maud Land arbeitete, beschrieb später in einem privaten Manuskript, das nie veröffentlicht wurde:
„Wir fanden eine Zone, in der der Kompass sprang. Die Hunde wurden unruhig. Es war ein Tal, das sich gegen alle Regeln unter der Eisschicht befand – warm, bewachsen, nicht kartiert. Unsere Befehle waren klar: keine weitere Erkundung. Zwei Tage später wurde das Camp aufgelöst.“
Natürlich wurde diese Geschichte von offiziellen Stellen nie bestätigt. Doch es gibt Dutzende ähnlicher Aussagen – verstreut über die Jahrzehnte. Mal aus Russland, mal aus Argentinien, mal aus dem britischen Geheimdienst. Immer inoffiziell. Immer zwischen den Zeilen.
Was, wenn Neuschwabenland nie verlassen wurde? Was, wenn es nicht nur ein Fleck auf einer Karte war, sondern ein Knotenpunkt? Ein geheimer Ort, an dem Technologie, Ideologie und Macht sich für einen letzten Versuch sammelten – in der Hoffnung, eines Tages zurückzukehren?
Die sogenannte „Hohlwelt-Theorie“, die teils absurd, teils archaisch daherkommt, spielt hier ebenfalls hinein. In ihrer extremsten Ausformung geht sie davon aus, dass die Erde nicht massiv, sondern hohl ist – und dass der Zugang zu ihrem Inneren sich an den Polen befindet. Die Nazis, so behaupten manche Autoren, hätten bereits vor dem Krieg geologische Hinweise auf unterirdische Lebensräume entdeckt – und gezielt nach Möglichkeiten gesucht, sich dorthin zurückzuziehen. Diese Theorien sind nicht belegbar. Aber auffällig ist: Sie wurden von den Alliierten nicht öffentlich lächerlich gemacht, sondern schlicht totgeschwiegen.
Warum?
Vielleicht, weil es gar nicht so sehr um die Frage geht, ob Neuschwabenland heute noch existiert – sondern darum, was es symbolisiert. Eine Zuflucht. Eine Idee. Ein letztes Bollwerk eines Systems, das unterging – aber nicht zerstört wurde. Ein Phantom, das immer dann wiederkehrt, wenn Macht, Technologie und Geheimhaltung sich zu nahe kommen.
In einem Brief aus dem Jahr 1956 schrieb der argentinische Marineoffizier Esteban Ramírez an seinen Vorgesetzten:
„Ich glaube, wir haben sie nicht besiegt. Wir haben sie nur verloren.“
Die verschwundenen U-Boote
Es gibt in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs viele dunkle Ecken, viele Akten mit Stempel „verschwunden“, „nicht vollständig“, „in Bearbeitung“. Doch kaum eine Spur ist so seltsam und gleichzeitig so hartnäckig wie die der verschwundenen U-Boote.
Als die Kapitulationsurkunde des Dritten Reichs unterzeichnet wurde, zählte der alliierte Marinegeheimdienst die U-Boot-Flotte der Kriegsmarine akribisch – auf Papier, auf Radarbildern, in Berichten von Kommandanten. Und doch fehlten mehrere Boote. Einfach verschwunden. Kein Funkspruch. Kein Wrack. Kein Lebenszeichen.
Zwei von ihnen tauchten Monate später auf – in Argentinien, über 13.000 Kilometer vom ehemaligen Einsatzgebiet entfernt. U-530, unter dem Kommando von Oberleutnant Otto Wermuth, lief am 10. Juli 1945 im argentinischen Mar del Plata ein – fast zwei Monate nach Kriegsende. U-977, unter Leutnant Heinz Schäffer, folgte am 17. August desselben Jahres. Die Welt nahm Notiz – zunächst verwundert, dann alarmiert.
Denn was diese beiden Boote so besonders machte, war nicht nur ihr plötzliches Wiederauftauchen, sondern das, was sie nicht sagten.
Beide Kommandanten gaben widersprüchliche, vage oder auffällig nichtssagende Erklärungen über ihre Route, ihre Aufgaben und ihren Verbleib während der fraglichen Wochen. Wermuth behauptete, sie hätten sich lediglich „lange auf See gehalten, um nicht in alliierte Gefangenschaft zu geraten“. Schäffer wiederum berichtete von einer „Reise direkt nach Südamerika“, um sich und seine Mannschaft vor sowjetischer Kriegsgefangenschaft zu retten. Doch die offiziellen Reiseprotokolle, so spärlich sie auch waren, ließen Lücken von bis zu 66 Tagen. Was geschah in dieser Zeit?
Und warum befanden sich beide U-Boote völlig entwaffnet, mit auffällig gereinigten Logbüchern und keinerlei Fracht, als wären sie für eine letzte Mission beladen – und anschließend gründlich entleert worden?
Die Spekulationen ließen nicht lange auf sich warten.
Einige Historiker mutmaßten, die Boote hätten Nazi-Funktionäre nach Südamerika gebracht – was mit der späteren Entdeckung zahlreicher SS- und Gestapo-Leute in Argentinien, Chile und Brasilien zumindest teilweise korrespondiert. Andere gingen weiter: Sie glaubten, dass U-530 und U-977 nicht nur Personen, sondern auch streng geheime Technik, Dokumente oder sogar Prototypen transportiert hätten – nicht nach Argentinien, sondern weiter. In Richtung Süden.
Denn da war noch etwas. Ein Gerücht, das in den späten 1940ern in südamerikanischen Marinekreisen zu flüstern begann – über einen geheimen Unterwasserkorridor, der angeblich von der Südspitze Südamerikas tief in das südliche Polarmeer führte. Manche nannten ihn die „Todesstraße des Reiches“. Ein angeblich natürlicher oder künstlich erweiterter Graben, durch den speziell modifizierte U-Boote unter dem antarktischen Eis vordringen konnten. Ziel: eine riesige subglaziale Höhle unterhalb des sogenannten Neuschwabenlands.
Diese Theorie stützt sich auf Berichte über „thermisch aktive Zonen“ in der Antarktis, unterirdische Seen wie den Lake Vostok, magnetische Anomalien – aber vor allem auf eine hartnäckige Reihe von Aussagen ehemaliger Marineoffiziere aus Deutschland und Argentinien, die unabhängig voneinander von „einem Fluchtraum im Eis“ sprachen.
Ein angeblicher Funkspruch, 1952 von einem argentinischen Horchposten abgefangen, lautete:
„Punkt 211 erreicht. Energieversorgung stabil. Rückmeldung in 72 h.“
„Punkt 211“ ist bis heute ein Codewort unter jenen, die an die antarktische Flucht der Nationalsozialisten glauben. Es bezeichnet jenen sagenhaften Ort, von dem aus ein „letzter Rückzug“ erfolgt sein soll – eine autarke Basis tief unter dem Eis, geschützt durch Gletscher, isoliert durch Schnee, und so verborgen, dass kein Satellit sie je entdecken konnte.
Ist das reine Fiktion?
Vielleicht. Wahrscheinlich. Aber nicht vollständig auszuschließen.
Denn auch Jahrzehnte später existieren noch immer keine vollständigen Routenaufzeichnungen der U-530 und der U-977. Ihre Logbücher enden abrupt. Die amerikanischen und britischen Verhöre der Besatzungen wurden teilweise klassifiziert oder gingen verloren. Und es gibt, so wurde mir einmal in Buenos Aires zugeflüstert, mindestens ein weiteres Boot