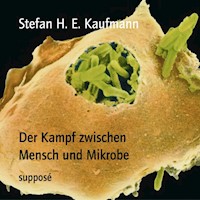8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
AIDS, Tuberkulose, Influenza, H5N1, SARS - die großen Seuchen versetzen die Welt nicht nur in Angst und Schrecken, sondern ziehen auch ökonomische Auswirkungen und Kosten für die Gesellschaft nach sich. Wo und wie entstehen neue Seuchen? Was haben sie mit Armut, was mit dem Klima zu tun? Welche Möglichkeiten liegen in Impfungen? Dieser Band erklärt, was zur Eindämmung der Seuchen geschehen muss, was der Staat, die Industrie und Stiftungen tun können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Prof. Dr. Stefan H.E. Kaufmann
Wächst die Seuchengefahr?
Globale Epidemien und Armut: Strategien zur Seucheneindämmung in einer vernetzten Welt
Sachbuch
Fischer e-books
Durch die Geschichte der Menschheit hinweg haben Infektionskrankheiten und Seuchen immer wieder ganze Landstriche ausgelöscht, Völkerwanderungen ausgelöst und Kriege entschieden. Doch auch und gerade heute im Zuge der zunehmenden Globalisierung unserer Welt haben ansteckende Krankheiten nichts von ihrer Bedrohung verloren. Sie greifen in alle Bereiche unseres Lebens ein, sind Thema von Forschung und Medizin, prägen Gesellschaft und Kultur, beeinflussen Wirtschaft und Politik.
In diesem Band wird nicht nur die Seuchengefahr in einer globalen Welt beschrieben, es werden auch Möglichkeiten und Strategien zu ihrer Eindämmung vorgestellt.
Was können wir tun, um einer drohenden Gefahr zu entgehen?
Stefan H. E. Kaufmann ist Professor für Mikrobiologie und Immunologie und Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in Berlin.
Unsere Adressen im Internet: www.fischerverlage.de www.hochschule.fischerverlage.de www.forum-fuer-verantwortung.de
Verlag und Autor haben alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und akurate Informationen in diesem Buch zu publizieren. Sie übernehmen aber keine Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfahren und Materialien frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen oder Warenbezeichnungen in diesem Buch berechtigt ohne besondere Kennzeichnung nicht zur Annahme, dass diese Namen im Sinne der Warenzeichen und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Für Angaben über Dosierungen und Applikationen oder Kontraindikationen, Wirkungen und Nebenwirkungen kann vom Verlag und Autor keine Verantwortung übernommen werden.
Vorwort des Herausgebers
Handeln – aus Einsicht und Verantwortung
»Wir waren im Begriff, Götter zu werden, mächtige Wesen, die eine zweite Welt erschaffen konnten, wobei uns die Natur nur die Bausteine für unsere neue Schöpfung zu liefern brauchte.«
Dieser mahnende Satz des Psychoanalytikers und Sozialphilosophen Erich Fromm findet sich in Haben oder Sein – die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft (1976). Das Zitat drückt treffend aus, in welches Dilemma wir durch unsere wissenschaftlich-technische Orientierung geraten sind.
Aus dem ursprünglichen Vorhaben, sich der Natur zu unterwerfen, um sie nutzen zu können (»Wissen ist Macht«), erwuchs die Möglichkeit, die Natur zu unterwerfen, um sie auszubeuten. Wir sind vom frühen Weg des Erfolges mit vielen Fortschritten abgekommen und befinden uns auf einem Irrweg der Gefährdung mit unübersehbaren Risiken. Die größte Gefahr geht dabei von dem unerschütterlichen Glauben der überwiegenden Mehrheit der Politiker und Wirtschaftsführer an ein unbegrenztes Wirtschaftswachstum aus, das im Zusammenspiel mit grenzenlosen technologischen Innovationen Antworten auf alle Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft geben werde.
Schon seit Jahrzehnten werden die Menschen aus Kreisen der Wissenschaft vor diesem Kollisionskurs mit der Natur gewarnt. Bereits 1983 gründeten die Vereinten Nationen eine Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, die sich 1987 mit dem sogenannten Brundtland-Bericht zu Wort meldete. Unter dem Titel »Our Common Future« wurde ein Konzept vorgestellt, das die Menschen vor Katastrophen bewahren will und zu einem verantwortbaren Leben zurückfinden lassen soll. Gemeint ist das Konzept einer »langfristig umweltverträglichen Ressourcennutzung« – in der deutschen Sprache als Nachhaltigkeit bezeichnet. Nachhaltigkeit meint – im Sinne des Brundtland-Berichts – »eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstandard zu wählen«.
Leider ist dieses Leitbild für ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges Handeln trotz zahlreicher Bemühungen noch nicht zu der Realität geworden, zu der es werden kann, ja werden muss. Dies liegt meines Erachtens darin begründet, dass die Zivilgesellschaften bisher nicht ausreichend informiert und mobilisiert wurden.
Forum für Verantwortung
Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf zunehmend warnende Stimmen und wissenschaftliche Ergebnisse habe ich mich entschlossen, mit meiner Stiftung gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte zur Verbreitung und Vertiefung des öffentlichen Diskurses über die unabdingbar notwendige nachhaltige Entwicklung beitragen. Mein Anliegen ist es, mit dieser Initiative einer großen Zahl von Menschen Sach- und Orientierungswissen zum Thema Nachhaltigkeit zu vermitteln sowie alternative Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Denn das Leitbild »nachhaltige Entwicklung« allein reicht nicht aus, um die derzeitigen Lebens- und Wirtschaftsweisen zu verändern. Es bietet zwar eine Orientierungshilfe, muss jedoch in der Gesellschaft konkret ausgehandelt und dann in Handlungsmuster umgesetzt werden. Eine demokratische Gesellschaft, die sich ernsthaft in Richtung Zukunftsfähigkeit umorientieren will, ist auf kritische, kreative, diskussionsund handlungsfähige Individuen als gesellschaftliche Akteure angewiesen. Daher ist lebenslanges Lernen, vom Kindesalter bis ins hohe Alter, an unterschiedlichen Lernorten und unter Einbezug verschiedener Lernformen (formelles und informelles Lernen), eine unerlässliche Voraussetzung für die Realisierung einer nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung. Die praktische Umsetzung ökologischer, ökonomischer und sozialer Ziele einer wirtschaftspolitischen Nachhaltigkeitsstrategie verlangt nach reflexions- und innovationsfähigen Menschen, die in der Lage sind, im Strukturwandel Potenziale zu erkennen und diese für die Gesellschaft nutzen zu lernen.
Es reicht für den Einzelnen nicht aus, lediglich »betroffen« zu sein. Vielmehr ist es notwendig, die wissenschaftlichen Hintergründe und Zusammenhänge zu verstehen, um sie für sich verfügbar zu machen und mit anderen in einer zielführenden Diskussion vertiefen zu können. Nur so entsteht Urteilsfähigkeit, und Urteilsfähigkeit ist die Voraussetzung für verantwortungsvolles Handeln.
Die unablässige Bedingung hierfür ist eine zugleich sachgerechte und verständliche Aufbereitung sowohl der Fakten als auch der Denkmodelle, in deren Rahmen sich mögliche Handlungsalternativen aufzeigen lassen und an denen sich jeder orientieren und sein persönliches Verhalten ausrichten kann.
Um diesem Ziel näher zu kommen, habe ich ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gebeten, in der Reihe »Forum für Verantwortung« zu zwölf wichtigen Themen aus dem Bereich der nachhaltigen Entwicklung den Stand der Forschung und die möglichen Optionen allgemeinverständlich darzustellen.
Innerhalb eines Jahres ist nun unsere Reihe mit Erscheinen der letzten vier Bände im Januar 2008 komplettiert:
Was verträgt unsere Erde noch? Wege in die Nachhaltigkeit (Jill Jäger)
Kann unsere Erde die Menschen noch ernähren? Bevölkerungsexplosion, Umwelt, Gentechnik (Klaus Hahlbrock)
Nutzen wir die Erde richtig? Die Leistungen der Natur und die Arbeit des Menschen (Friedrich Schmidt-Bleek)
Bringen wir das Klima aus dem Takt? Hintergründe und Prognosen (Mojib Latif)
Wie schnell wächst die Zahl der Menschen? Weltbevölkerung und weltweite Migration (Rainer Münz/Albert F. Reiterer)
Wie lange reicht die Ressource Wasser? Der Umgang mit dem blauen Gold (Wolfram Mauser)
Was sind die Energien des 21. Jahrhunderts? Der Wettlauf um die Lagerstätten (Hermann-Josef Wagner)
Wie bedroht sind die Ozeane? Biologische und physikalische Aspekte (Stefan Rahmstorf/Katherine Richardson)
Wächst die Seuchengefahr? Globale Epidemien und Armut: Strategien zur Seucheneindämmung in einer vernetzten Welt (Stefan H. E. Kaufmann)
Wie muss die Wirtschaft umgebaut werden? Perspektiven einer nachhaltigeren Entwicklung (Bernd Meyer)
Wie kann eine neue Weltordnung aussehen? Wege in eine nachhaltige Politik (Harald Müller)
Ende der Artenvielfalt? Gefährdung und Vernichtung von Biodiversität (Josef H. Reichholf)
Zwölf Bände – es wird niemanden überraschen, wenn im Hinblick auf die Bedeutung von wissenschaftlichen Methoden oder die Interpretationsbreite aktueller Messdaten unterschiedliche Auffassungen vertreten werden. Unabhängig davon sind sich aber alle an diesem Projekt Beteiligten darüber einig, dass es keine Alternative zu einem Weg aller Gesellschaften in die Nachhaltigkeit gibt.
Öffentlicher Diskurs
Was verleiht mir den Mut zu diesem Projekt und was die Zuversicht, mit ihm die deutschsprachigen Zivilgesellschaften zu erreichen und vielleicht einen Anstoß zu bewirken?
Zum einen sehe ich, dass die Menschen durch die Häufung und das Ausmaß der Naturkatastrophen der letzten Jahre sensibler für Fragen unseres Umgangs mit der Erde geworden sind. Zum anderen gibt es im deutschsprachigen Raum bisher nur wenige allgemeinverständliche Veröffentlichungen wie Die neuen Grenzen des Wachstums (Donella und Dennis Meadows), Erdpolitik (Ernst Ulrich von Weizsäcker), Zukunftsfähiges Deutschland (Wuppertal Institut), Balance oder Zerstörung (Franz Josef Radermacher), Fair Future (Wuppertal Institut) und Kollaps (Jared Diamond). Insbesondere liegen keine Schriften vor, die zusammenhängend das breite Spektrum einer umfassend nachhaltigen Entwicklung abdecken.
Das vierte Kolloquium meiner Stiftung, das im März 2005 in der Europäischen Akademie Otzenhausen (Saarland) zu dem Thema »Die Zukunft der Erde – was verträgt unser Planet noch?« stattfand, zeigte deutlich, wie nachdenklich eine sachgerechte und allgemeinverständliche Darstellung der Thematik die große Mehrheit der Teilnehmer machte.
Darüber hinaus stimmt mich persönlich zuversichtlich, dass die mir eng verbundene ASKO EUROPA-STIFTUNG alle zwölf Bände vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie didaktisieren lässt, um qualifizierten Lehrstoff für langfristige Bildungsprogramme zum Thema Nachhaltigkeit sowohl im Rahmen der Stiftungsarbeit als auch im Rahmen der Bildungsangebote der Europäischen Akademie Otzenhausen zu erhalten. Inzwischen haben wir daraus die Initiative »Mut zur Nachhaltigkeit« entwickelt, deren beide Säulen »Zwölf Bücher zur Zukunft der Erde« und »Vom Wissen zum Handeln« die Grundlage für unsere umfassenden geplanten Bildungsaktivitäten der nächsten Jahre darstellen. »Mut zur Nachhaltigkeit« wurde Anfang 2007 als offizielles Projekt der UN-Dekade »Bildung für Nachhaltigkeit« 2007/2008 ausgezeichnet. Auch die Resonanz in den deutschen Medien ist überaus positiv.
Als ich vor gut zwei Jahren begann, meine Vorstellungen und die Voraussetzungen zu einem öffentlichen Diskurs über Nachhaltigkeit zu strukturieren, konnte ich nicht voraussehen, dass bis zum Erscheinen der ersten Bücher dieser Reihe zumindest der Klimawandel und die Energieproblematik von einer breiten Öffentlichkeit mit großer Sorge wahrgenommen würde. Dies ist meines Erachtens insbesondere auf folgende Ereignisse zurückzuführen:
Zunächst erlebte die USA die fast vollständige Zerstörung von New Orleans im August 2005 durch den Hurrikan Katrina, und dieser Katastrophe folgte tagelange Anarchie.
Im Jahre 2006 startete Al Gore seine Aufklärungskampagne zum Klimawandel und zum Thema Energieverschwendung. Sie gipfelte in seinem Film »Eine unbequeme Wahrheit«, der weltweit große Teile in allen Altersgruppen der Bevölkerung erreicht und beeindruckt.
Der 2007 publizierte 700-seitige Stern-Report, den der Ökonom und frühere Chefvolkswirt der Weltbank, NICHOLAS STERN, im Auftrag der britischen Regierung mit anderen Wirtschaftswissenschaftlern erstellt hat, schreckte Politiker wie auch Wirtschaftsführer gleichermaßen auf. Dieser Bericht macht deutlich, wie hoch weltweit der wirtschaftliche Schaden sein wird, wenn wir »business as usual« betreiben und nicht energisch Maßnahmen dem Klimawandel entgegensetzen. Gleichzeitig wird in diesem Bericht dargelegt, dass wir mit nur einem Zehntel des wahrscheinlichen Schadens Gegenmaßnahmen finanzieren und die durchschnittliche Erderwärmung auf 2°C beschränken könnten – wenn wir denn handeln würden.
Besonders große Aufmerksamkeit in den Medien und damit in der öffentlichen Wahrnehmung fand der jüngste ICPP-Bericht, der Anfang 2007 deutlich wie nie zuvor den Ernst der Lage offenlegte und drastische Maßnahmen gegen den Klimawandel einforderte.
Zu guter Letzt sei erwähnt, dass auch das außergewöhnliche Engagement einiger Milliardäre wie Bill Gates, Warren Buffet, George Soros und Richard Branson sowie das Engagement von Bill Clinton zur »Rettung unserer Welt« die Menschen auf der ganzen Erde beeindruckt.
Eine wesentliche Aufgabe unserer auf zwölf Bände angelegten Reihe bestand für die Autorinnen und Autoren darin, in dem jeweils beschriebenen Bereich die geeigneten Schritte zu benennen, die in eine nachhaltige Entwicklung führen können. Dabei müssen wir uns immer vergegenwärtigen, dass der erfolgreiche Übergang zu einer derartigen ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung auf unserem Planeten nicht sofort gelingen kann, sondern viele Jahrzehnte dauern wird. Es gibt heute noch keine Patentrezepte für den langfristig erfolgreichsten Weg. Sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und noch mehr innovationsfreudige Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Managerinnen und Manager werden weltweit ihre Kreativität und Dynamik zur Lösung der großen Herausforderungen aufbieten müssen. Dennoch sind bereits heute erste klare Ziele erkennbar, die wir erreichen müssen, um eine sich abzeichnende Katastrophe abzuwenden. Dabei können weltweit Milliarden Konsumenten mit ihren täglichen Entscheidungen beim Einkauf helfen, der Wirtschaft den Übergang in eine nachhaltige Entwicklung zu erleichtern und ganz erheblich zu beschleunigen – wenn die politischen Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind. Global gesehen haben zudem Milliarden von Bürgern die Möglichkeit, in demokratischer Art und Weise über ihre Parlamente die politischen »Leitplanken« zu setzen.
Die wichtigste Erkenntnis, die von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft gegenwärtig geteilt wird, lautet, dass unser ressourcenschweres westliches Wohlstandsmodell (heute gültig für eine Milliarde Menschen) nicht auf weitere fünf oder bis zum Jahr 2050 sogar auf acht Milliarden Menschen übertragbar ist. Das würde alle biophysikalischen Grenzen unseres Systems Erde sprengen. Diese Erkenntnis ist unbestritten. Strittig sind jedoch die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind.
Wenn wir ernsthafte Konflikte zwischen den Völkern vermeiden wollen, müssen die Industrieländer ihren Ressourcenverbrauch stärker reduzieren als die Entwicklungs- und Schwellenländer ihren Verbrauch erhöhen. In Zukunft müssen sich alle Länder auf gleichem Ressourcenverbrauchsniveau treffen. Nur so lässt sich der notwendige ökologische Spielraum schaffen, um den Entwicklungs- und Schwellenländern einen angemessenen Wohlstand zu sichern.
Um in diesem langfristigen Anpassungsprozess einen dramatischen Wohlstandsverlust des Westens zu vermeiden, muss der Übergang von einer ressourcenschweren zu einer ressourcenleichten und ökologischen Marktwirtschaft zügig in Angriff genommen werden.
Die Europäische Union als stärkste Wirtschaftskraft der Welt bringt alle Voraussetzungen mit, in diesem Innovationsprozess die Führungsrolle zu übernehmen. Sie kann einen entscheidenden Beitrag leisten, Entwicklungsspielräume für die Schwellen- und Entwicklungsländer im Sinn der Nachhaltigkeit zu schaffen. Gleichzeitig bieten sich der europäischen Wirtschaft auf Jahrzehnte Felder für qualitatives Wachstum mit zusätzlichen Arbeitsplätzen. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch die Rückgewinnung von Tausenden von begabten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Europa nicht nur aus materiellen Gründen, sondern oft auch wegen fehlender Arbeitsmöglichkeiten oder unsicheren -bedingungen verlassen haben.
Auf der anderen Seite müssen die Schwellen- und Entwicklungsländer sich verpflichten, ihre Bevölkerungsentwicklung in überschaubarer Zeit in den Griff zu bekommen. Mit stärkerer Unterstützung der Industrienationen muss das von der Weltbevölkerungskonferenz der UNO1994 in Kairo verabschiedete 20-Jahres-Aktionsprogramm umgesetzt werden.
Wenn es der Menschheit nicht gelingt, die Ressourcen- und Energieeffizienz drastisch zu steigern und die Bevölkerungsentwicklung nachhaltig einzudämmen – man denke nur an die Prognose der UNO, nach der die Bevölkerungsentwicklung erst bei elf bis zwölf Milliarden Menschen am Ende dieses Jahrhunderts zum Stillstand kommt –, dann laufen wir ganz konkret Gefahr, Ökodiktaturen auszubilden. In den Worten von Ernst Ulrich von Weizsäcker: »Die Versuchung für den Staat wird groß sein, die begrenzten Ressourcen zu rationieren, das Wirtschaftsgeschehen im Detail zu lenken und von oben festzulegen, was Bürger um der Umwelt willen tun und lassen müssen. Experten für ›Lebensqualität‹ könnten von oben definieren, was für Bedürfnisse befriedigt werden dürften« (Erdpolitik, 1989).
Es ist an der Zeit
Es ist an der Zeit, dass wir zu einer grundsätzlichen, kritischen Bestandsaufnahme in unseren Köpfen bereit sind. Wir – die Zivilgesellschaften – müssen entscheiden, welche Zukunft wir wollen. Fortschritt und Lebensqualität sind nicht allein abhängig vom jährlichen Zuwachs des Prokopfeinkommens. Zur Befriedigung unserer Bedürfnisse brauchen wir auch keineswegs unaufhaltsam wachsende Gütermengen. Die kurzfristigen Zielsetzungen in unserer Wirtschaft wie Gewinnmaximierung und Kapitalakkumulierung sind eines der Haupthindernisse für eine nachhaltige Entwicklung. Wir sollten unsere Wirtschaft wieder stärker dezentralisieren und den Welthandel im Hinblick auf die mit ihm verbundene Energieverschwendung gezielt zurückfahren. Wenn Ressourcen und Energie die »wahren« Preise widerspiegeln, wird der weltweite Prozess der Rationalisierung und Freisetzung von Arbeitskräften sich umkehren, weil der Kostendruck sich auf die Bereiche Material und Energie verlagert.
Der Weg in die Nachhaltigkeit erfordert gewaltige technologische Innovationen. Aber nicht alles, was technologisch machbar ist, muss auch verwirklicht werden. Die totale Ökonomisierung unserer gesamten Lebensbereiche ist nicht erstrebenswert. Die Verwirklichung von Gerechtigkeit und Fairness für alle Menschen auf unserer Erde ist nicht nur aus moralisch-ethischen Prinzipien erforderlich, sondern auch der wichtigste Beitrag zur langfristigen Friedenssicherung. Daher ist es auch unvermeidlich, das politische Verhältnis zwischen Staaten und Völkern der Erde auf eine neue Basis zu stellen, in der sich alle, nicht nur die Mächtigsten, wiederfinden können. Ohne einvernehmliche Grundsätze »globalen Regierens« lässt sich Nachhaltigkeit in keinem einzigen der in dieser Reihe diskutierten Themenbereiche verwirklichen.
Und letztendlich müssen wir die Frage stellen, ob wir Menschen das Recht haben, uns so stark zu vermehren, dass wir zum Ende dieses Jahrhunderts womöglich eine Bevölkerung von 11 bis 12 Milliarden Menschen erreichen, jeden Quadratzentimeter unserer Erde in Beschlag nehmen und den Lebensraum und die Lebensmöglichkeiten aller übrigen Arten immer mehr einengen und zerstören.
Unsere Zukunft ist nicht determiniert. Wir selbst gestalten sie durch unser Handeln und Tun: Wir können so weitermachen wie bisher, doch dann begeben wir uns schon Mitte dieses Jahrhunderts in die biophysikalische Zwangsjacke der Natur mit möglicherweise katastrophalen politischen Verwicklungen. Wir haben aber auch die Chance, eine gerechtere und lebenswerte Zukunft für uns und die zukünftigen Generationen zu gestalten. Dies erfordert das Engagement aller Menschen auf unserem Planeten.
Danksagung
Mein ganz besonderer Dank gilt den Autorinnen und Autoren dieser zwölfbändigen Reihe, die sich neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit der Mühe unterzogen haben, nicht für wissenschaftliche Kreise, sondern für eine interessierte Zivilgesellschaft das Thema Nachhaltigkeit allgemeinverständlich aufzubereiten. Für meine Hartnäckigkeit, an dieser Vorgabe weitestgehend festzuhalten, bitte ich an dieser Stelle nochmals um Nachsicht. Dankbar bin ich für die vielfältigen und anregenden Diskussionen über Wege in die Nachhaltigkeit. Mich hat sehr beeindruckt, mit welcher Disziplin die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Zeitplan exakt eingehalten haben, innerhalb von zwölf Monaten alle zwölf Bücher fertigzustellen.
Bei der umfangreichen Koordinationsarbeit hat mich von Anfang an ganz maßgeblich Ernst Peter Fischer unterstützt – dafür meinen ganz herzlichen Dank, ebenso Wolfram Huncke, der mich in Sachen Öffentlichkeitsarbeit beraten hat. Für die umfangreichen organisatorischen Arbeiten möchte ich mich ganz herzlich bei Annette Maas bedanken, ebenso bei Ulrike Holler und Eva Köster vom S. Fischer Verlag für die nicht einfache Lektoratsarbeit.
Auch den finanziellen Förderern dieses Großprojektes gebührt mein Dank: allen voran der ASKO EUROPA-STIFTUNG (Saarbrücken) und meiner Familie sowie der Stiftung Europrofession (Saarbrücken), Erwin V. Conradi, Wolfgang Hirsch, Wolf-Dietrich und Sabine Loose.
Seeheim-Jugenheim Sommer 2007
Stiftung Forum für Verantwortung Klaus Wiegandt
Vorwort
Kein Jahr vergeht, ohne dass eine ansteckende Krankheit die Schlagzeilen der Presse beherrscht, gefolgt von hysterischen Aktivitäten, die meist ins Leere laufen. Immer ist es das Unbekannte und Unerwartete, das uns besonders bedrohlich erscheint. Wenn wir die Kürzel BSE, SARS, H5N1 in den Schlagzeilen lesen, könnten wir allerdings annehmen, dass Seuchen eine Sache von gerade mal ein paar 100 Todesfällen sind. Dies ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs, denn Tag für Tag sterben runde 50 000 Menschen an den ansteckenden Krankheiten, ohne dass dies in der Presse Erwähnung finden würde.
Als ich gefragt wurde, ob ich für die Serie »Forum für Verantwortung« ein Buch über die Seuchengefahr schreiben möchte, habe ich nicht spontan ja gesagt. Zu groß schien mir diese Aufgabe neben all meinen anderen Verpflichtungen. Ich habe gezögert und dann doch zugestimmt, da ich glaubte, dass etwas zur Seucheneindämmung geschehen sollte. Im Rückblick hat es mir Spaß gemacht, und ich habe mehr gelernt, als ich gedacht hätte. Dabei wurde mir auch endgültig klar, dass etwas geschehen muss, und zwar bald.
Die ansteckenden Krankheiten greifen in alle Bereiche unseres Lebens. Sie sind Ziel der Forschung, Problem der Medizin, sie prägen Gesellschaft und Kultur, und sie sind ein einschneidender Faktor für Wirtschaft und Politik. In diesem Netzwerk sind übertragbare Krankheiten sowohl Ursache als auch Folge. Was bislang fehlte, ist der Versuch, die verschiedenen Aspekte aus den unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und die komplexen Abhängigkeitsverhältnisse zu entschlüsseln. Mit diesem Buch versuche ich diese Lücke zu schließen, und zwar nicht in der Fachsprache der Wissenschaftler, sondern auf eine Weise, die es möglichst vielen Menschen erlaubt, sich ihre eigene Meinung über die Globalisierung der Seuchen in einer vernetzten Welt zu bilden.
Ich hatte das Glück, dass ich mich auf die wunderbare Unterstützung zuverlässiger und hilfreicher Personen stützen konnte. Dank geht an Frau Dr.Mary Louise Grossman für ihre Recherchen zu diesem Buch, an Frau Diane Schad für die Erstellung der instruktiven Abbildungen, an Frau Souraya Sibaei für ihre unermüdliche Hilfe bei der Abfassung des Manuskripts und die zuverlässigen Recherchen sowie an Frau Susan Schädlich für ihre kompetente, immer wieder stimulierende Mitarbeit. Vonseiten des Fischer Verlags betreute Frau Eva Köster und vonseiten des Forums für Verantwortung Frau Anette Maas das Buch mit großem Engagement. Meinem Kollegen Prof.Dr.Klaus Hahlbrock danke ich, dass er mich mit Geduld davon überzeugte, dieses Buch zu schreiben. Ganz besonders danke ich dem Forum für Verantwortung, insbesondere Herrn Klaus Wiegandt, der mich für dieses Projekt fasziniert und dabei großzügig unterstützt hat. Viele Kollegen haben Teile des Manuskripts gelesen. Insbesondere danke ich Prof.Martin Grobusch, Prof.Frank Kirchhoff, Prof.Peter Kremsner, Prof.Klaus Magdorf, Prof.Kai Matuschewski und Prof.Richard Lucius. Als ich das Buchprojekt angenommen hatte, war mir klar, dass ich es hauptsächlich in meiner Freizeit schreiben würde. Meiner Frau Elke und meinen Söhnen Moritz und Felix danke ich für die Riesengeduld und ihr Verständnis dafür, dass ich anstatt ihnen diesem Buch so viel Zeit widmete. Es war nicht das erste Mal.
1Einleitung
»Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.«
Johann Wolfgang von Goethe
Mikroben haben vor 3 Milliarden Jahren die Erde besiedelt. Heute kreuchen und fleuchen hier eine halbe bis 1 Million verschiedene Bakterienarten und etwa 5000 Virusarten herum. Die meisten davon kennen wir noch gar nicht. Die Mehrzahl ist harmlos und kümmert sich nicht um uns. Wir kennen rund 1500 unterschiedliche Keime, die bislang Infektionskrankheiten bei Menschen verursacht haben. Die meisten sind Raritäten geblieben. Doch heute sind übertragbare Krankheiten für ein Drittel bis ein Viertel aller vorzeitigen Todesfälle verantwortlich. Immer wieder haben sie ganze Landstriche ausgelöscht, Völkerwanderungen ausgelöst und Kriege entschieden.
Noch im Zweiten Weltkrieg verfügten die Menschen kaum über Mittel zur Bekämpfung der Infektionskrankheiten. Zwar gab es bereits die Impfung gegen Pocken, Diphtherie und Tetanus, ansonsten aber musste man sich weitgehend auf Hygiene sowie Desinfektions- und Sterilisationsmaßnahmen verlassen. Die 50er Jahre erlebten die erste Blüte der Antiinfektiva – also der Arzneimittel gegen Infektionen. Es wurden wirksame Impfstoffe gegen die wichtigsten Viruserkrankungen Masern, Mumps, Röteln und Kinderlähmung entwickelt. Der zweite Durchbruch kam mit den Antibiotika, die Bakterien spezifisch angreifen. Zwischen den 50er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde die Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten zur Routine.
Heute sind wir Zeugen einer Rückkehr der übertragbaren Krankheiten – und selbst daran schuld. Wir sind nicht in der Lage, die vorhandenen Impfstoffe und Antibiotika den armen Ländern in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen. Die Erreger entwickeln im Wettlauf mit den Antibiotika immer neue Resistenzen und werden nur schwer oder gar nicht mehr behandelbar. Und schließlich schaffen wir mit unserer Lebensweise beste Voraussetzungen für das Entstehen und Aufblühen neuer Krankheitserreger.
Im Folgenden möchte ich Sie einladen, mehr über die Bedeutung der übertragbaren Krankheiten für unsere Zukunft zu erfahren. Dieses Buch will naturwissenschaftliche, medizinische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Aspekte aufzeigen und den Beweis antreten dafür, dass die ansteckenden Krankheiten nichts von ihrer Bedrohung für die Menschheit verloren haben. Ganz im Gegenteil. Krankheitserreger sind die großen Gewinner der zunehmenden Globalisierung unserer Welt. Schneller als jedes andere Lebewesen passen sich Mikroben an neue Situationen an und können auf Veränderungen reagieren. Die Globalisierung, eine wachsende Kluft zwischen Entwicklungsstaaten und Industriestaaten, die zahlreichen Katastrophen und Krisen und nicht zuletzt die Industrialisierung unserer Ernährung und unsere Besitznahme der letzten Flecken unberührter Natur bieten den Erregern ungeahnte Möglichkeiten. Die Menschheit steht mehr denn je im ständigen Austausch. Ein Erreger, der eine Person befallen hat, kann innerhalb von ein bis zwei Tagen die ganze Welt erreichen. Kurz gesagt: Eine neue Seuche selbst in einem entlegenen Gebiet bedroht heute schnell die ganze Welt.
Auf der anderen Seite verfügt die Menschheit über bessere Möglichkeiten zur Abwehr denn je. Wir verstehen recht genau, wie Erreger entstehen und Krankheiten hervorrufen; wir können Ausbrüche rasch aufdecken, wir haben Diagnostika, Impfstoffe und Chemotherapeutika. Was uns allerdings fehlt, ist der entschiedene Wille zum Einschreiten, zum Einsatz der vorhandenen Möglichkeiten und zur Entwicklung neuer Maßnahmen. Während Sie für die Einleitung bis hierher rund fünf Minuten gebraucht haben, sind 17 Menschen an Tuberkulose gestorben, Malaria hat 10 Kinder getötet und 50 Menschen haben sich mit dem Humanen-Immundefizienz-Virus (HIV) angesteckt. Schöpften wir unsere Möglichkeiten richtig aus, könnten viele davon noch leben.
Ich will versuchen, die Seuchengefahr in einer globalen Welt darzustellen, und Strategien zu ihrer Eindämmung diskutieren. Ich hoffe, dass Sie am Ende des Buches mit mir übereinstimmen, dass Seuchen mehr denn je in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik eingreifen und nicht nur Folge, sondern auch Ursache vieler unserer Probleme sind.
Zuerst wirft dieses Buch einen Blick auf die Erregerstrategien und die Abwehrmöglichkeiten des menschlichen Körpers. Anschließend skizziere ich jene übertragbaren Krankheiten, die uns zurzeit die größten Sorgen bereiten – und die Möglichkeiten, die wir zur Verhinderung und Heilung in der Hand haben. Schließlich steht die Frage: Warum eigentlich bietet die Welt von heute einen so fruchtbaren Nährboden für alte und neue Krankheitserreger? Zum Schluss biete ich Lösungsvorschläge zur Verhinderung neuer Ausbrüche ansteckender Krankheiten und zur Eindämmung bestehender Seuchen.
Eines vorab: Erfolgsmeldungen sind in den letzten Jahrzehnten leider rar geworden. Uns gehen die Möglichkeiten zur Bekämpfung langsam aus. Zu wenig Gewinn bringen die Medikamente und Impfstoffe, als dass der Markt einen ausreichenden Anreiz für ihre Entwicklung und Herstellung böte. Es braucht neue, innovative Wege. Das Wissen und die finanziellen Möglichkeiten zu einem Richtungswechsel haben wir – jetzt ist Handeln gefragt.
2Die Angreifer
»Nach allen vernünftigen und fairen Kriterien sind Bakterien die vorherrschende Lebensform auf der Erde – und sie waren es auch immer.«
Stephen Jay Gould
2.1Einleitung
Die Angst vor Seuchen hat ganz wesentlich damit zu tun, dass sie ansteckend sind. Und die Tatsache, dass wir ein Überspringen nicht verhindern können, trägt wahrscheinlich wesentlich zu dieser Furcht bei. Um von Mensch zu Mensch zu springen, können Krankheitserreger vielerlei Wege gehen: Das Virus der Immunschwächekrankheit AIDS wird hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr übertragen, weshalb Kondome schützen können. Bestimmte Moskitos übertragen Malaria, und imprägnierte Bettnetze sind noch immer die erfolgreichste Präventivmaßnahme. Die Erreger von Bakterienruhr, Cholera und anderer Durchfallerkrankungen gelangen über verunreinigtes Wasser oder kontaminierte Nahrungsmittel von Mensch zu Mensch; durch Abkochen des Trinkwassers, schälen und waschen von Gemüse und Obst kann man hier schon viel erreichen, auch wenn das auf Reisen manchmal lästig sein mag. Keime können auch in Tröpfchen durch die Gegend gewirbelt werden wie bei der Tuberkulose. Davor kann man sich kaum schützen. Solche Aerosole werden nicht nur von hustenden oder schniefenden Kranken versprüht, auch Klimaanlagen können Erreger, die im Kühlwasser-Reservoir vegetieren, verbreiten. So geschehen 1976 beim ersten Ausbruch der Legionärs-Krankheit. Die Krankheit wird von Legionellen-Bakterien ausgelöst und äußert sich als schwere Lungenentzündung mit Fieber. In unseren Breiten macht die Legionärskrankheit vor allem von sich Reden, wenn die Erreger in Schwimmbädern gefunden werden und diese dann zur Desinfektion oft wochenlang gesperrt werden.
In anderen Fällen laufen Infektionen über direkten Hautkontakt (Schmierinfektion), eine Berührung mit infektiösem Material etwa Blut (Bluttransfusionen oder Mehrfachnutzung von Injektionsnadeln bei Drogensüchtigen) oder anderen Körperflüssigkeiten beim Geschlechtsverkehr. Als Überträger kommen auch verunreinigte Abwässer, Nahrungsmittel oder infizierte Haus- und Wildtiere infrage. Tiere können die krankmachenden Erreger auch dann in sich tragen, wenn sie selbst gesund scheinen. Ähnlich tückisch sind sogenannte gesunde Ausscheider unter den Menschen. Diese Personen tragen einen Krankheitskeim und streuen ihn weiter, sind selbst aber nicht krank. Prominent als Verschlepper zahlreicher Seuchen sind schließlich Insekten wie Moskitos, Flöhe oder Zecken, die wir dann als Vektoren bezeichnen.
Den Erregern die Übertragungswege abzuschneiden ist häufig einer der besten Wege zur Vorbeugung oder Eindämmung von ansteckenden Krankheiten.
Verantwortlich für die Seuchen sind mikroskopisch kleine Lebewesen: Bakterien, Viren, Pilze, Einzeller oder größere Parasiten. Seit neuestem wissen wir, dass auch simple Eiweiße, sogenannte Prionen, Krankheiten übertragen können. Diese erst vor wenigen Jahren gefundenen Erreger verursachen eine schwammartige Auflösung des Gehirns, etwa beim Rinderwahn (auch: BSE für Bovine Spongiforme Enzephalopathie), der Traberkrankheit der Schafe oder der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit des Menschen.
Die wichtigsten Erreger und die von ihnen ausgelösten Krankheitsbilder werden später genauer beschrieben. Im Folgenden sollen einige biologische Eigenschaften der kleinsten Lebewesen und deren faszinierende Überlebensstrategien beschrieben werden, die für das Verständnis der Infektionskrankheiten wichtig sind.
2.2Bakterien
Bakterien sind häufig nur ein Bruchteil vom Durchmesser eines menschlichen Haares groß. Escherichia coli als typischer Darmkeim etwa misst gewöhnlich einige Mikrometer und ist damit etwa ein hundertstel kleiner als ein menschliches Haar dick ist. Bakterien kommen in zahlreichen Gestalten vor, die meisten behalten ihre typische Form ein Leben lang bei (siehe Abb. 1). So sind Milzbrand- und Tuberkulose-Erreger Stäbchen; die typischen Eiterbakterien Staphylokokken und Streptokokken sind kugelförmig; der Cholera-Erreger sieht kommaförmig aus. Die Erreger der von Zecken übertragenen Lyme Borreliose (sogenannte Borrelien) und das Syphilis-Bakterium sind wie ein Korkenzieher gedreht.
Das Leben vieler Bakterien hängt von Sauerstoff ab. Sie werden deshalb auch als aerobe Keime bezeichnet. Andere Bakterien können auch ohne Sauerstoff leben, und für einige ist er gar tödlich. Dies sind die fakultativ anaeroben bzw. obligat anaeroben Bakterien. Zu ihnen gehören die meisten Darmbakterien und jene, die sich in tiefen Wunden vermehren wie der Wundstarrkrampf-Erreger.
Bakterienaufbau. Bakterien besitzen eine rigide Zellwand, welche die Plasmamembran umgibt und manchmal von einer Kapsel umhüllt ist. Zellwand und Kapsel schützen die Bakterien vor Umwelteinflüssen und körpereigenen Abwehrmechanismen. Das Erbgut ist in einem DNS-Ring, also nicht in unterschiedlichen Chromosomen festgelegt. Im Zytoplasma finden sich u.a. Einschlüsse und Ribosomen, in denen die RNS in Protein umgeschrieben wird. Bakterien kommen in unterschiedlichen Formen vor, die für einen bestimmten Erreger stabil sind. Die wichtigsten Erscheinungsformen sind die kugelförmigen Kokken, die länglichen Stäbchen sowie die kommaförmigen und die korkerzieherartigen Keime.
Bakterien sind eigenständige Lebewesen. Sie besitzen zwar keinen echten Zellkern. Aber die genetische Information und damit die Grundlage für ihre Überlebensstrategien tragen sie genau wie höhere Lebewesen im Erbmolekül DNS. Bakterien vermehren sich asexuell durch Teilung. Ein genetischer Austausch durch Vermischung eines väterlichen und eines mütterlichen Erbguts findet nicht statt. Vielmehr kopieren Bakterien ihre DNS für eine Teilung und verteilen je eine Abschrift auf die beiden entstandenen Zellen. Die Nachkommen sind mithin genetisch mit der Mutterzelle (oder Vaterzelle) identisch. Forscher sprechen daher bei einer Gruppe solcher Zellen auch von einem Bakterienklon.
Viele Krankheitserreger vermehren sich sehr rasch, innerhalb von einer halben bis einer Stunde. Nur wenige wie der notorisch langsame Tuberkulose-Erreger brauchen deutlich länger, nämlich 12 bis 24 Stunden. Noch langsamer ist der Lepra-Keim, dessen Verdopplung bis zu zwei Wochen dauert. Die rasante Vermehrung bringt einen wichtigen Vorteil: Der Erbgut-Kopierer macht bei seinen schnellen Abschriften immer wieder kleine Fehler. So gleicht letztlich in der Realität doch nicht jeder Bakterienurururenkel seinem Ausgangskeim bis auf den letzten Baustein des Erbgutes. Die Zufalls-Mutationen können praktisch ohne Effekt sein oder sich in winzigen Veränderungen äußern – als Vor- oder Nachteile für das Bakterienleben. Effekt: Varianten, die besser an die Umgebung angepasst sind, setzen sich rasch durch. Und selbst wenn bei einer drastischen Veränderung im Erbgut 99,99 Prozent der Keime absterben, können die überlebenden Keime die Nische schnell wieder auffüllen. Mutation und die beschriebene Selektion sind die entscheidenden Triebfedern der Evolution. Sie ermöglichten es Bakterien, im Laufe von Milliarden Jahren die unterschiedlichsten Plätze der Erde zu besiedeln. Zudem sind diese Mechanismen auch dafür verantwortlich, dass Keime Gegenstrategien etwa zu Antibiotika entwickeln und sich Arzneimittel-resistente Stämme herausbilden.
Trotz fehlender sexueller Vermehrung tauschen auch Bakterien untereinander genetisches Material aus. Dies läuft vor allem auf zwei Wegen. Zum einen übernehmen Viren, die Bakterien befallen, diesen Job. Die sogenannten Bakteriophagen bestehen – wie alle Viren – vor allem aus Erbgut. Wenn sie sich von einem Bakterium ins nächste schleusen, bringen sie häufig bestimmte Eigenschaften wie etwa die Gene für Antibiotikaresistenzen mit. Zudem schwimmen im Innern mancher Bakterien auch zusätzlich zum eigentlichen Erbgut separate DNS-Ringe. Diese Plasmide genannten Strukturen können die Keime untereinander ebenfalls tauschen. Weil dieser Genaustausch innerhalb einer Bakteriengeneration und praktisch zwischen nebeneinander existierenden Keimen stattfindet, sprechen Wissenschaftler auch von horizontalem Genaustausch. Für Infektionskrankheiten ist dieser von besonderer Bedeutung. Denn häufig übertragen Keime auf diesem Weg auf einen Schlag ganze krankmachende Eigenschaften. So erhält mitunter etwa der harmlose Darmbewohner Escherichia coli von Durchfallerregern wie Salmonellen oder Shigellen Informationen, die ihn dann selbst zu einem Durchfallerreger machen. Umgekehrt kann ein harmloser Escherichia coli Keim, der vor langer Zeit antibiotikaresistent wurde, diese Widerstandsfähigkeit auf einen bislang antibiotikaempfindlichen Durchfallkeim übertragen.
Da Bakterien einen eigenständigen Stoffwechsel besitzen, der sich deutlich von unserem eigenen unterscheidet, töten Antibiotika sie spezifisch ab, ohne jedoch in unseren Stoffwechsel einzugreifen. Dieses wertvolle Instrument steht uns erst seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts zur Verfügung und hat bereits Millionen Menschenleben gerettet. Allerdings wird die Waffe langsam stumpf, eben weil sich Mikroorganismen so rasch anpassen und Ausweichstrategien entwickeln, die sie gegen Therapien unempfindlich machen. Den Antibiotika und der Antibiotika-Resistenz ist ein eigenes Kapitel gewidmet.
2.3Viren
»Ein Virus ist ein Stück schlechte Nachricht in einem Eiweiß verpackt.« Mit diesem Satz hat der britische Medizin-Nobelpreisträger Peter Medawar das Wesen von Viren auf den Punkt gebracht.
Viren sind etwa zehnmal kleiner als Bakterien (also etwa 0,1 Mikrometer oder 1000-mal dünner als ein Haar). Und eigentlich sind sie gar keine eigenständigen Lebewesen, sondern typische Schmarotzer. Vereinfacht gesehen bestehen sie aus einer Hülle, in der die Information für ihre Herstellung in Form einen Stückes Erbgut (DNS oder RNS) lagert. Dabei enthalten Viren entweder DNS oder RNS, nie aber beide Informationsträger gleichzeitig. Bei höheren Lebewesen hingegen trägt die DNS die genetische Information. Die RNS fungiert als Bote, der die Blaupause abliest und entsprechend eines Codes in Eiweiße übersetzt. Viren fehlt zumindest ein Teil dieses Synthese-Apparates. Für ihre Vermehrung sind sie auf höhere Zellen angewiesen. Wenn sie eine Zelle kapern, stülpen sie deren Stoffwechsel um und lassen ihn für sich arbeiten (siehe Abb. 2). Die infizierte Zelle vermehrt dann das Virus, platzt schließlich meist und setzt beim Zugrundegehen zahlreiche Virus-Nachkömmlinge frei.
Bei Viren, die RNS statt DNS tragen, ist ein weiterer Zwischenschritt geschaltet: Dann muss die Zelle die RNS vor der Vermehrung noch in DNS umschreiben lassen. Die Methode produziert häufig Lesefehler. Und ähnlich wie bei den Bakterien werden die Fehler für einige Viren zum Vorteil, etwa wenn HIV so immer wieder neue Erscheinungsformen annimmt und der Immunabwehr entweicht.
Virus-Vermehrung. Viren docken über spezifische Rezeptoren an Wirtszellen an, die auch das Wirtsspektrum und die Organspezifität des Virus bestimmen. Nachdem das Virus in die Zelle eingedrungen ist, wird seine Kapsel geöffnet und die Virus-DNS in das Wirtsgenom eingebaut. Bei RNS-Viren muss der Informationsträger erst in DNS umgeschrieben werden. Nun kann das Virus entweder direkt vermehrt werden oder aber es persistiert erst einmal über längere Zeit in einer Art Winterschlaf, bevor es wieder aktiv wird. Auf die Vermehrung des Virus-RNS bzw. DNS folgt der Zusammenbau der Kapsel und gegebenenfalls der Hülle. Nun ist das freie Virus zur Infektion weiterer Zellen bereit.
Weil Viren deutlich kleiner sind als Bakterien, wurde ihre Untersuchung und Darstellung erst richtig möglich mit der Erfindung des Elektronenmikroskops. Auch effektive Therapeutika gegen Viren wurden erst in den 90er Jahren entwickelt. Antibiotika und andere klassische Chemotherapeutika gegen Bakterien versagen bei Viren. So ist auch die häufige Behandlung von nicht-eitrigen Mandelentzündungen mit Antibiotika unnütz. Diese werden nämlich zu einem Großteil von Viren verursacht. Antibiotika sind nur sinnvoll gegen bakterielle Infektionen und gegen die gefährliche Streptokokken-Angina sogar dringend nötig.
2.4Protozoen
Protozoen sind Einzeller, die schon sehr viel Ähnlichkeit mit den höheren Organismen, also auch mit dem Menschen, haben. Die meisten potenziell krankmachenden Einzeller leben in tropischen und subtropischen Gebieten Afrikas, Asiens und Südamerikas. Hierzu gehören die Malaria-Erreger Plasmodien, die Trypanosomen genannten Auslöser der Chagas- und der Schlafkrankheit oder Leishmanien als Erreger der Leishmaniose (Kala-Azar). Andere Protozoen wie die hauptsächlich von Katzen übertragenen Toxoplasmen oder die durchfallerregenden Giardien kommen auch in unseren Breiten vor. Viele der Einzeller werden von Insekten übertragen. Da der Stoffwechsel der Protozoen bereits deutliche Ähnlichkeit mit unserem hat, schädigen wirksame Chemotherapeutika leicht auch Körperzellen. Das Spektrum der Therapeutika ist klein.
2.5Pilze und Würmer
Auch im Reich der Pilze und Würmer finden wir Krankheitserreger. Viele Pilze sind Opportunisten, sie kommen häufig vor und richten bei Gesunden kaum Schaden an. Nach Schwächung des Immunsystems jedoch können Pilze schwerwiegende Krankheiten hervorrufen, die zudem oft nur schlecht behandelbar sind. Dies ist besonders bei AIDS-Patienten ein riesiges Problem.
Wurmerkrankungen wurden in unseren Breiten zwar weitgehend zurückgedrängt. Doch noch immer trägt jeder dritte Mensch auf der Welt mindestens eine Wurmart in seinem Körper. Am häufigsten betroffen sind Schulkinder in den Tropen. Die Bedeutung der Wurmerkrankungen spiegelt sich auch darin wider, dass das Immunsystem zu deren Bekämpfung spezielle Abwehrmechanismen entwickelt hat, die sich von denen gegen Bakterien und Viren deutlich unterscheiden.
2.6Prionen
Prionen sind die kleinsten bekannten Krankheitserreger und bringen seit ein paar Jahren unser ganzes Weltbild durcheinander. Diese falsch geformten Proteine sind nun wirklich keine Lebewesen. Als Auslöser der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung sind sie in der Medizin schon länger bekannt. Mit Ausbruch der Rinderseuche BSE jedoch beherrschten sie Anfang der neunziger Jahre schlagartig die Schlagzeilen. Verantwortlich für den Ausbruch, der letztlich Hunderttausende Rinder das Leben kostete, war der Mensch: Er zwang den reinen Pflanzenfressern Kannibalismus auf, indem er gemahlene Knochen und aufbereitete Fette anderer Tiere verfütterte. Die Sparmaßnahmen der industriellen Tierzucht mündeten in eine wirtschaftliche Katastrophe und verunsicherten den Verbraucher nachhaltig. Die BSE-Krise kostete geschätzte 3,5 Milliarden Euro. Entgegen erster Befürchtungen jedoch blieb die Katastrophe für den Menschen aus. Bis Februar 2007 sind weltweit nur 198 Fälle der neuen Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit bekannt geworden, die als menschliche Form von BSE gilt. Daher werden Prionen in diesem Buch im Weiteren nur selten eine Rolle spielen.
3Die Abwehr
»Blut ist ein ganz besonderer Saft.«
Johann Wolfgang von Goethe
3.1Einleitung
Die Immunantwort gehört zu den am meisten unterschätzten Funktionen des Körpers: Sie kann problemlos Milliarden verschiedene Strukturen unterscheiden. Bildlich gesprochen hätte sie kein Problem damit, jeden einzelnen der 6,5 Milliarden Menschen dieser Erde genau zu erkennen. Und sie kann nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip ebenso viele Strukturen zum Einfangen dieser unzähligen Kontakte bilden. Dabei arbeitet das Immunsystem so effektiv, dass wir meist gar nicht merken, wie sich der Körper täglich mit Tausenden potenzieller Krankheitserreger auseinandersetzt. Die körpereigene Abwehr ist eine äußerst schlagkräftige Waffe, und es ist schwer, bei deren Beschreibung auf kriegerische Begriffe zu verzichten. Ich habe dies immer wieder versucht, bislang aber keine eindrücklichere Alternative gefunden. Die Waffe Immunsystem unterliegt zugleich strenger Kontrolle, um überschießende oder fehlgeleitete Reaktionen zu vermeiden und damit Schäden für den eigenen Körper abzuwenden, wie sie etwa bei Allergien entstehen oder bei Krankheiten, bei denen die Abwehr Gewebe des eigenen Körpers bekämpft.
Die Römer verstanden unter dem Begriff Immunis die Befreiung von der Steuerlast. Heute meinen wir mit Immunität: frei von Infektionskrankheiten. Die wesentlichen Kriterien der Immunität sind ihre Spezifität sowie das exquisite Gedächtnis. Auch ohne tiefe Kenntnis wissen die meisten, dass ein Kind nach einer Mumpserkrankung sich damit nicht ein zweites Mal ansteckt, aber Masern und Röteln durchaus noch bekommen kann. Schon Thukydides hatte erkannt, dass Menschen, die eine Seuche durchgemacht hatten, nicht noch einmal daran erkrankten. Und von König Dionysius wird berichtet, dass er regelmäßig zum Frühstück kleinste Mengen Gift aß, um gegen ein Giftattentat geschützt zu sein. Es ist fraglich, ob er auf diese Art tatsächlich eine Immunantwort stimulierte oder vielmehr seine Leberenzyme so trainierte, dass sie die Gifte schneller abbauen konnten – ganz ähnlich wie jemand mehr Alkohol verträgt, der täglich sein Quantum Wein trinkt.
3.2Eindringen schwergemacht ...
Schauen wir uns an, wie der menschliche Körper verhindert, dass ein Erreger eindringt. Die erste Barriere bilden sogenannte natürliche Resistenzmechanismen: Äußerlich schützt die Haut gegen Eindringlinge (Abb. 3). Die meisten von ihnen können den Körper nur durch Verletzungen entern – oder durch Körperöffnungen, die mit dem größten Organ ausgekleidet sind, der Schleimhaut. Hier jedoch sind weitere Abwehrmechanismen zwischengeschaltet: Die Atemwege sind ausgekleidet mit einer Zellschicht, auf deren Oberfläche winzige Flimmerhärchen sitzen und eindringende Staubkörnchen oder Keime zurück gen Ausgang befördern. Die Darmperistaltik schiebt den Darminhalt mitsamt aller darin schwimmenden Erreger nach draußen – viele Millionen Bakterien scheidet der Mensch bei jedem Stuhlgang aus. Ähnlich schwemmt der Harnfluss kontinuierlich Keime heraus. Zudem siedeln natürlicherweise an vielen Stellen im Körper bestimmte nützliche Bakterien. So verhindert die Normalflora im Darm oder Mund-Rachenraum die Absiedlung von Krankheitserregern. Erreicht ein Eindringling diese Gefilde, betritt er gewissermaßen einen überfüllten Zug, in dem schon alle Sitzplätze und die meisten Stehplätze belegt sind. Es wird ihm schwerfallen, ein einigermaßen gemütliches Plätzchen zu finden, also eine Infektion in Gang zu setzen.
Die ersten Schritte der Infektabwehr. Dringt ein Erreger in den Wirt ein, muss er erst einmal die Barrieren der natürlichen Resistenz überwinden. Die Haut ist recht gut gegen Erreger geschützt, die nur dann die Haut durchdringen können, wenn diese verletzt ist. Die Epithelien der Atemwege sind mit Flimmerhärchen besetzt, die die Keime nach außen befördern können. Die Darmperistaltik sorgt dafür, dass der Darminhalt mitsamt seiner mikrobiellen Bewohner mit dem Stuhlgang wieder ausgeschieden wird. Nach Überwindung der natürlichen Resistenzbarrieren werden die Keime von Zellen und Faktoren der angeborenen Immunantwort bekämpft. Wichtig sind die Fresszellen, also Makrophagen und neutrophile Granulozyten. Erst nach einigen Tagen beginnt die erworbene Immunantwort mit der spezifischen Erregerbekämpfung. Dies sind einmal die von B-Lymphozyten gebildeten Antikörper und die aus Vorläufer-T-Lymphozyten entstehenden T-Helfer-Zellen und T-Killer-Zellen.
So wichtig diese Mechanismen sind, mit der Immunität im engeren Sinne haben sie wenig zu tun. Die eigentliche Abwehr kommt erst ins Spiel, wenn ein Erreger alle äußeren Barrieren überwunden hat.
3.3Hinter den Barrieren ...
Das Immunsystem steht auf zwei Säulen: Ein Pfeiler bildet die angeborene Abwehr, den zweiten das erworbene Immunsystem (Abb. 3). Der angeborene Part erkennt Krankheitserreger nah an deren Eintrittspforte und mobilisiert die ersten Abwehrkräfte. Um im Bild der kriegerischen Auseinandersetzung fortzufahren, sind diese ersten Abwehrkräfte gewissermaßen das Fußvolk, das die Verteidigung ohne hochentwickelte Abwehrwaffen aufnimmt. Fresszellen ziehen los. Die Makrophagen und Granulozyten genannten Truppenteile eliminieren viele Erreger schlicht, indem sie sie auffressen. Abwehrzellen verstärken sich gegenseitig, indem sie lösliche Substanzen ausschütten: Das sogenannte Komplement löst Bakterien auf, Interferone blockieren die Virus-Vermehrung. Mit diesen Strategien ist das angeborene Immunsystem effektiv – aber ungenau. Längerfristig wird ein trickreicher Erreger dieses Fußvolk überrennen.
Doch die angeborene Abwehr hält engen Kontakt zu den nachrückenden Spezialkräften des Körpers, zur erworbenen Abwehr. Das Fußvolk spioniert den Gegner beim ersten Gegenangriff aus: Über wenig differenzierte, aber außerordentlich effektive Mechanismen schätzt es ein, von welchem Typ die Angreifer sind. Sind es Bakterien, die eine akute Infektion auslösen? Sind es Viren, die eine chronische Infektion in Gang setzen? Oder doch Pilze, Protozoen oder Würmer? Die Informationen gibt es an das erworbene Immunsystem weiter. In diesem schätzt eine Art Kommandoebene ab, welche speziellen Abwehr-Batallione mobilisiert werden sollen. Bildhaft gesprochen: soll es die Bodenabwehr, die Luftabwehr oder die Marine sein?
Das erworbene Immunsystem übernimmt die Funktion, die wir normalerweise mit dem Begriff Immunität assoziieren. Es setzt an zum gezielten Gegenschlag, der spezifischen Immunantwort, und besitzt ein Gedächtnis. Getragen wird es von Zellen und Faktoren im Blut, der Lymphe und im entzündeten Gewebe. Weiße Blutzellen, die Lymphozyten, erkennen alle Strukturen, die nicht zum eigenen Körper gehören. Diese heißen Antigene. Um diese abzuwehren, fährt die Spezialeinheit quasi zweigleisig. Zum einen bildet sie zu jedem Eindringling das passende Gegeneiweiß, den spezifischen Antikörper. Zum anderen schickt sie spezialisierte Abwehrzellen in die Spur.
Antikörper sind Y-förmige Eiweiße, die wie ein Schlüssel zum Schloss passen. Sie kleben sich an die Eindringlinge und neutralisieren so Gifte oder stoßen die Abwehr von Bakterien und Viren an. Gebildet werden sie von B-Lymphozyten, kurz B-Zellen.
Fachleute unterscheiden verschiedene Antikörpergruppen, die sie als Immunglobuline bezeichnen und der Einfachheit halber mit Buchstaben benennen. Abgekürzt heißen die Klassen dann IgA, IgD, IgG, IgM oder IgE. Die natürlichen Antikörper der ersten Abwehrfront gehören zur Klasse IgM. Die IgD-Gruppe sitzt auf der Oberfläche der B-Zellen und tastet gewissermaßen die Eindringlinge ab. Als spezifische Gegenschlag-Truppe werden die IgG gebildet, die wichtigsten Abwehrstoffe im Blut. IgE wiederum treten speziell bei Wurminfektionen auf den Plan und vermitteln die Symptome bei Allergien. Schließlich verfügen auch die Schleimhäute von Darm, Mund, Rachen, Lunge, Harnblase und Vagina – als Haupteintrittspforte für Keime – über ihre eigene Antikörperklasse: die IgA.
Gegen Erreger jedoch, die sich in Wirtszellen einnisten, sind Antikörper machtlos. Sie erkennen die Fremdlinge nicht, die sich in der Körperzelle verstecken. Doch infizierte Zellen signalisieren dem Immunsystem den Befall in ihrem Innern, indem sie ihr Äußeres als eine Art Hilferuf mit neuen Antigenen bestücken. Mit diesem Kniff locken sie eine andere Gruppe Abwehrzellen an: Die T-Lymphozyten oder kurz T-Zellen. Diese Zellen können zum Beispiel infizierte Zellen zerstören und so die Virus-Produktion unterbinden. Oder sie aktivieren Fresszellen, sodass diese Erreger, die sich in ihrem Innern versteckt halten, abtöten. Die Aktivierung der Fresszellen übernehmen die sogenannten T-Helferzellen. Zugleich kontrolliert eine andere Gruppe T-Helferzellen die Antikörperproduktion. Die Zerstörung infizierter Zellen bewerkstelligen die T-Killerzellen.
Ähnlich wie das Fußvolk, unsere unspezifische Abwehr, bedienen sich auch T-Helferzellen einiger Botenstoffe, die Zytokine oder Interleukine genannt werden. Mittels dieser hormonähnlichen Eiweiße tauschen die Helferzellen über kurze oder längere Distanz Informationen mit ihren Zielzellen aus. Das Zytokin-Netzwerk ist komplex, und häufig müssen mehrere der Botenstoffe zusammenwirken, um eine bestimmte Funktion zu mobilisieren.
T-Helferzellen vom Typ 1 (sog. Th1-Zellen) aktivieren Fresszellen, die daraufhin Bakterien und Protozoen abtöten. T-Helferzellen vom Typ 2 (sog. Th2-Zellen) stimulieren die Antikörperproduktion und kämpfen gegen Wurminfektionen. Die Th1- und Th2-Zellen aktivieren die unterschiedlichen Funktionen über die Produktion von Botenstoffen. Die wichtigsten Botenstoffe der Th1-Zellen sind das Interferon-γ, der stärkste Aktivator der Fresszellen, und Interleukin-2, welches die T-Killerzellen in Gang setzt. Interleukin-4 und Interleukin-5, die von Th2-Zellen gebildet werden, koordinieren die Antikörperproduktion und die Abwehr von Wurminfektionen (Abb. 4).
Bei manchen Krankheiten wird die Spezialeinheit selbst befallen. AIDS ist ein bekanntes Beispiel. Das tödliche Immunschwächevirus nutzt Erkennungsmerkmale auf der Oberfläche von T-Zellen als Andockstelle. Es bindet gezielt an sogenannte CD-4 Moleküle auf der Oberfläche von T-Helferzellen und schleust sich über diese in die Abwehrkämpfer ein. Andere Zellen tragen verwandte Rezeptoren, T-Killerzellen etwa besitzen CD-8 Moleküle in ihrer Zellmembran. Im Labor machen sich Ärzte diese Moleküle auch diagnostisch zunutzen. So lässt sich anhand des Verhältnisses von CD-4 zu CD-8 auch der Verlauf einer AIDS-Erkrankung diagnostizieren.
Häufig ist sich das erworbene Immunsystem mit seiner hohen Spezialisierung zu fein, die Erreger selbst zu bekämpfen. Vielmehr erstellt es häufig die Strategie und spezifische Direktiven, fordert dann aber erneut das angeborene Immunsystem – sprich die Bodentruppen – zum Angriff auf. Parallel entwickelt die erworbene Abwehr ein immunologisches Gedächtnis. Die Kommandoebene archiviert die wichtigen Details aller Angreifer und kann bei einer zweiten Invasion rascher und mit höherer Präzision eingreifen (Abb. 5).