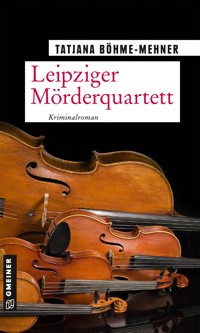Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
22. November 1999: Mein Vater ist tot. Gegen sieben Uhr morgens klingelte das Telefon. Es war die Todesnachricht. Ich wusste schon vorher, dass sie es ist. Nicht, dass ich sie erwartet hätte. Nicht mehr jedenfalls als an irgendeinem anderen Morgen in den letzten Jahren. Obwohl die Nachricht an sich zu erwarten war: Schlecht ging es ihm, seit er sich endgültig aus der Öffentlichkeit verabschiedet hatte. Ein kleines Ende war seither jede unserer Begegnungen gewesen. Im freien Fall von der Lichtgestalt zum enttarnten Spitzel – ich war beiden gegenüber skeptisch. Doch nun ist er tot; und ich frage mich, wer dieser Mensch war. Manfred oder Ibrahim? Dissident oder gemeiner Stasi-Spitzel? Weltflüchter oder Realist? Arbeiter oder Intellektueller? Tragischer Held oder Clown? Ich bin mir nicht sicher. Tatjana Böhme-Mehner schildert in Warten auf den Vater die außergewöhnliche Beziehung zu ihrem Vater Ibrahim (Manfred) Böhme, der 1978 aus der SED ausgeschlossen und mehrere Monate inhaftiert und 1990 zum Vorsitzenden der neu formierten Ost-SPD gewählt wurde. Er galt als aussichtsreicher Bewerber um den Posten des DDR-Ministerpräsidenten. Nach seiner Enttarnung als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi zog sich Böhme aus der Öffentlichkeit zurück. Die Autorin entwickelt anhand realer Erinnerungen das schwierige Verhältnis zu einem irrealen Vater, der immer unterwegs und selten für die Tochter greifbar war; sie entwirft exemplarisch ein faszinierendes Bild vom Alltag in der ostdeutschen Provinz vor und nach der Wende und zeigt, welche tiefen Wunden der radikale Umbruch und die Überwachung durch die Staatssicherheit hinterlassen haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tatjana Böhme-Mehner
Wartenauf den Vater
Erinnerungen an Ibrahim Böhme
Das hier ist ein großer Teil der Geschichte, die mich mit meinem Vater verbindet. Weitgehend habe ich das so erlebt. Trotzdem wurden Namen und Charakteristika Unbeteiligter hin und wieder verändert. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind entsprechend unbeabsichtigt und kompletter Zufall.
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
1. eBook-Ausgabe 2019© 2019 Europa Verlag GmbH & Co. KG,Berlin · München · Zürich · WienUmschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung von Fotos von © ullstein bild –ADN Bildarchiv und © privatLayout & Satz: Danai Afrati & Robert Gigler, München
Konvertierung: BookwireePub-ISBN: 978-3-95890-275-6
Alle Rechte vorbehalten.www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Inhalt
Anstelle eines Vorworts:Todesnachrichten kommen nie zur rechten Zeit
Warten
Zwischen Pioniertuch und Barbie – Großwerden in der DDR-Provinz
Der Cowboy mit der Reisetasche
Alles, bloß kein Alltag
Charme aus anderen Zeiten
Generation Wende
Stasi
Besuch beim Beinahe-Ministerpräsidenten
In die Welt und zurück
Der Mann ohne Vergangenheit
Der Spion in meiner Vita
Sterben ist ein langer Weg
Warten 2.0
ANSTELLE EINES VORWORTS:
Todesnachrichten kommen nie zur rechten Zeit
22. November 1999
Mein Vater ist tot. Gegen sieben Uhr morgens hat das Telefon geklingelt. Es war die Todesnachricht. Ich wusste schon vorher, dass sie es ist. Nicht, dass ich sie erwartet hätte. Nicht mehr jedenfalls als an irgendeinem anderen Morgen in den letzten – wie vielen eigentlich? – Jahren. Obwohl die Nachricht an sich zu erwarten war: Schlecht ging es ihm, seit er sich endgültig aus der Öffentlichkeit verabschiedet hatte. Seit einigen Jahren wunderte ich mich, wie schlecht es einem Menschen gehen konnte, ohne dass er daran tatsächlich starb; wie schlecht es einem gehen musste, bis man daran sterben konnte. Denn eigentlich war es wohl das, was er erreichen wollte, mit dem, was er tat – oder ebenso nicht tat: sterben. Ich fragte mich, wie viel man trinken, rauchen, leiden konnte, ohne dass es das endgültige Ende bedeutet hätte. Ein kleines Ende war seither jede unserer Begegnungen gewesen. Im freien Fall von der Lichtgestalt zum enttarnten Spitzel – ich war beiden gegenüber skeptisch. Doch nun ist er tot; und er ist mein Vater.
Er war mein Vater. Bis ich mich dieser Tatsache ohne Skrupel und mit der nötigen Selbstsicherheit immer und überall stellen kann, dauert es noch mehr als ein Jahrzehnt – zu emotional ist meine Umwelt noch, bezogen auf das Reizwort »Stasi«, bezogen auf die ganze, nie wirklich aufgearbeitete Wendegeschichte, letztlich bezogen auch auf ihn. So viel Verachtung für den Verräter – durchaus nachvollziehbar. Und andererseits ist immer noch eine seltsame Faszination zu spüren, der manch einer seiner alten Freunde nach wie vor anzuhängen scheint. Mit mir hat beides eigentlich nicht viel zu tun, und doch prägt es das, was ich hier erlebe. Angst haben mir beide Seiten gemacht, seit sie in mein Bewusstsein gedrungen sind.
Wirklich greifbar ist mein Vater nie gewesen, auch in den Momenten nicht, in denen ich ihn tatsächlich anfassen konnte. Da vielleicht überhaupt am wenigsten. Zu unsicher bin ich in dieser Zeit – bezogen darauf, was passieren würde, wenn ich die Flucht nach vorn ergriffe, wenn es um den Spitzel Böhme geht, der mein Vater war. Auf Nachfrage verschweige ich ihn nicht; das habe ich nie getan. Doch noch bin ich nicht mutig genug, per se zu sagen, wie das mit meiner Familie ist. Kein Wunder: Ich bin in der DDR groß geworden.
Vielleicht hätte ich viel früher auf mein Gegenüber zumarschieren sollen, offensiv, handschüttelnd: »Guten Tag, ich bin Tatjana Böhme(-Mehner), seit x Jahren schreibe ich vor allem über Musik. Nichtsdestotrotz bin ich die Tochter des berühmt-berüchtigten Stasi-Spitzels Ibrahim Böhme, der beinahe die letzte DDR-Regierung angeführt hätte. Mit mir hat das zwar nichts zu tun, wenn Sie aber dennoch ein Problem damit haben, ist das Ihre Gelegenheit, es kundzutun.«
Im Osten hätte das einige Jahre lang für mehr als nur Verblüffung gesorgt. Aber es ist nicht mein Wesen. Den großen Preis für Diplomatie mag ich nicht verdient haben, aber die Portion des ostdeutschen Konfliktvermeidertums, die ich mitbekommen habe, reicht immer noch aus, um dezent um den heißen Brei herumzureden. In meinem Studium der Journalistik schließlich nimmt das Wissen der anderen, vor allem der Dozenten, gepaart mit meinem Ausweichen manchmal absurde Formen an – vor allem, weil jeder irgendwann einmal das Wort »Informantenschutz« gehört hat. Das kann man übrigens leicht mit »Herrschaftswissen« verwechseln – das wird irgendwann meine Erkenntnis daraus sein.
Väter und Töchter – das ist angeblich etwas ganz Besonderes. Bei den meisten Menschen ist es ziemlich einfach: Entweder haben sie einen Vater oder nicht. So einfach war das bei mir nie. Das sage ich und weiß, dass es völliger Quatsch ist. Weil natürlich jeder Mensch einen Vater hat, genau wie ich auch. Und eigentlich weiß ich das durchaus. Habe es nie geleugnet. Warum auch?
Die Sache ist lediglich die, dass die anderen diesen Vater entweder kennen oder nicht. Und genau das kann ich von mir nicht behaupten. Zwar hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie irgendeinen Zweifel ob der Person meines Vaters. Doch wer genau dieser Mensch war? Manfred oder Ibrahim? Dissident oder gemeiner Stasi-Spitzel? Weltflüchter oder Realist? Arbeiter oder Intellektueller? Tragischer Held oder Clown? Ich bin mir nie so sicher. Auf jeden Fall kein Vater, wie andere ihn hatten oder sich gewünscht hätten. Jetzt jedenfalls ist er tot.
Zwei Phasen gab es in meinem Leben, in denen es nicht unbedingt ratsam erschien, diesen Vater zu haben und beim Namen zu nennen: vor der Wende und dann wieder unmittelbar nach der Wende. Kryptische Antworten täuschen über manches hinweg und sichern Normalität, die für ein Kind so wichtig ist. Man muss nur lernen, diese Antworten früh genug zu geben … Lügen musste ich dafür nie – vielleicht hat mein Vater mich auch deshalb gern ein wenig im Dunkeln tappen lassen, wenn es darum ging, wer er wirklich war. Und nicht nur mich …
Und dann gab es jene Phasen, in denen andere dem Kind die Existenz des Vaters ausreden wollten. Einen Vater, der nie da ist, gibt es wahrscheinlich überhaupt nicht. Gut möglich, dass er meiner blühenden Fantasie entsprungen ist. Kinder können grausam sein. Gerade in der Kleinstadt, wo jeder um die kleinen und großen Fehler aller Übrigen weiß. Das sind Momente, in denen der Vater riesig und konkret wird, während man auf seiner Existenz beharrt – und damit auf der eigenen Normalität. Und es gab die sehr lange Phase, in der er selbst die Familie verleugnete – im Glauben, sie zu schützen. Möglicherweise. Diese Momente waren wohl die schmerzhaftesten. Gewiss nicht für mich allein. Und schließlich gab es jene Phase, in der ich selbst nicht noch mehr auf seine Existenz aufmerksam machen wollte, in der ich ein normaler Teenager sein, er aber Ministerpräsident werden wollte. Schon merkwürdig, wie Realitäten und Illusionen ineinandergreifen …
Als Ministerpräsidentschaftskandidat ist er genauso real wie als der Lokführer oder Cowboy, der er nie war, doch für das Kind vorgab zu sein, oder der Übersetzer und Theatermann, der er wohl irgendwann einmal auch gewesen sein muss und den ich ins Feld führe, wenn es an offizieller Stelle gilt, einen Vater zu haben: im Sprachunterricht, bei Behörden …
Jetzt im Tod jedenfalls ist er verdammt real, schon weil sein Sterben mich unter einen bemerkenswert realen Zugzwang setzt, der vorläufig gar keinen Platz für emotionale Regungen lässt. So irreal seine Existenz gewesen sein mag, ihr Ende holt sie in erstaunlicher Konkretheit ein und bringt sie wieder hinein in mein Leben. Ich bin schwanger zu jener Zeit. Erklärungen, Notare … Das ist lebensweltlicher als das meiste, was mir dieser Vater bisher präsentiert hat. Dennoch hatten unsere Begegnungen durchaus Eindrucksvolleres zu bieten: Schöneres, Dramatischeres, ja, vor allem Witzigeres … Auch wenn viele es nicht glauben: Die Eigenschaft meines Vaters, die ich am meisten geschätzt habe, war sein Witz. Ob ich davon ein wenig geerbt habe? Das hoffe ich, ehrlich gesagt.
Und zu guter Letzt war da noch das entscheidende Problem, dass er selbst niemals der sein wollte, der er war. Warum? Das habe ich mich oft gefragt; und eigentlich weiß ich, dass ich diese Frage wohl nie beantworten werde. Niemand kann das. Ich hätte sie deutlich früher stellen sollen. Und trotzdem sitze ich hier und schreibe. Gerade deshalb. Wahrscheinlich. Ich habe die Frage schlicht nie gestellt. Ob ich andernfalls eine Antwort bekommen hätte? Wer weiß …
Die Situation ist absurd. Doch genau das ist gut so für den Moment. Denn das, was kommt, betäubt jede emotionale Regung. Nicht im pathetischen Sinne. Noch posthum führt er die Hinterbliebenen an der Nase herum: zahllose Testamente von einem, der nichts besaß, nichts besitzen wollte. Im Sinne des Erbschaftsgesetzes. Und wer da was erbte … Dutzende von Seiten quellen aus dem Faxgerät. Die Absurdität ist offensichtlich und wird noch gesteigert durch die Tatsache, dass wir ein Rollenfax besitzen. Zahllose verschiedene Fassungen eines fiktiven Testaments ziehen sich als riesige Papierschlange über den Boden in der gemütlichen kleinen Dachgeschosswohnung, die ich damals in Leipzig bewohne. Das Märchen vom süßen Brei habe ich mir als Kind besonders gern von meiner Omi erzählen lassen. Irgendwie ruft mir der Testamenten-Fax-Bandwurm gerade diese Geschichte in Erinnerung. Die dort verschiedentlich erwähnten Ländereien meiner Ahnen habe ich bis heute nicht gefunden … Die Ahnen auch nicht. Allerdings habe ich sie auch nicht wirklich gesucht. Hätte ich es gern? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Eine Idee, um sich wegzuträumen, wären sie allemal. Aber das habe ich nie wirklich gebraucht. Träume hatte ich mit Sicherheit immer – jenseits dessen.
Doch die Absurdität macht es mit ebensolcher Sicherheit leichter – für den Moment. Ob er sich dessen bewusst war? Vielleicht. Ob er es bewusst eingesetzt hat, um es mir leichter zu machen? Schwer zu sagen … Das würde unterstellen, dass er mich wahrgenommen, dass er an mich gedacht hätte. An mich und mein Gefühl. Eigentlich ist das eine wunderschöne Vorstellung. Doch vor allem ist da gerade die absurde juristische Situation, dass ich jetzt für ihn verantwortlich bin, dem die Verantwortung für mich immer Angst gemacht hat, der sie immer auf andere abgewälzt hat.
Das Erbe habe ich zur Sicherheit ausgeschlagen. Im Sinne des Erbschaftsgesetzes. Ich bin nicht haftbar für seine Fehler – nicht im juristischen Sinne. Wie das moralisch ist? Das wird die Zeit zeigen …
Fürs Erste jedenfalls steht eines fest: Er ist tot – Manfred, alias Ibrahim, Böhme, vermutlich Jahrgang 1944; Mitbegründer der sozialdemokratischen Partei der DDR; Spitzenkandidat der OST-SPD bei den letzten Volkskammerwahlen – also bei der einzigen in unserem demokratischen Sinne freien Parlamentswahl in der DDR – und kurz darauf als einer der perfidesten Stasi-Spitzel enttarnt. Mehr als das ist zu dieser Zeit kaum im allgemeinen Bewusstsein. Wenn überhaupt. Eine Meldung zur Hauptnachrichtenzeit ist sein Tod schließlich trotzdem wert.
Ich habe diese Meldung geschrieben. Ich habe gelernt, solche Meldungen zu schreiben. Als ich gefragt werde, ob ich ein ganzes Journalistikstudium genau für diese Situation absolviert habe, lache ich freundlich. Die Entscheidung, als Ergänzung zur Musikwissenschaft Journalistik zu studieren, war eine Vernunftentscheidung, ein Kompromiss, wie man ihn in meiner Generation eingegangen ist, weil der Markt für Akademiker gerade in den Geisteswissenschaften nach der Wende eigentlich nicht mehr existiert, aber die Medienlandschaft noch ganz in Ordnung ist. Insofern ist mein Lachen ein wenig gezwungen – auch weil ich weiß, dass unter meinen Journalistik-Kommilitonen und -Dozenten hinter vorgehaltener Hand immer mal wieder weitergesagt wird, wessen Tochter ich bin. Ein einziger Dozent hat das Rückgrat, mich darauf anzusprechen … Es war das Musikwissenschaftsstudium, das ich immer gewollt hatte.
Sein Tod verlief seinem Wunsch gemäß mit Tschaikowsky, sagt die Frau, die bei ihm war. Sie hat alles in die Wege geleitet für die stille Bestattung, die er wollte. Bleibt die Öffentlichkeit. Meine Aufgabe …
Die Pressemitteilung besagt: Er ist tot! Nicht viel mehr, aber definitiv auch nicht weniger. Ich verlasse die Wohnung und entgehe dem pausenlosen Klingeln des Telefons, den Fragen, die Journalisten stellen wollen – zu seinem Alkoholkonsum, zu seinem ungewöhnlichen Sterbeort Neustrelitz und dem irgendwie auch verblüffenden Sterbedatum, zu seinen letzten Jahren, von denen ich so viel bzw. so wenig weiß wie von seinem ganzen Leben – zu viele Details und keinen Zusammenhang … Ich bewundere meinen späteren Mann, der jenen erstaunlich hartnäckigen Journalisten, die – auf der Suche nach dem geringsten Vorteil – fragen, vor allem aber in der Hoffnung auf Bestätigung nachhaken, Rede und Antwort steht, und zwar die ganze Zeit, ohne etwas zu sagen. Die Information passt zum Zeitgeist – in Deutschland, ja in ganz Europa hat man gerade zehn Jahre Mauerfall gefeiert, sich erinnert und auch ein wenig aufgearbeitet, was geschah, ein bisschen heroisiert, doch auch ein bisschen ernüchtert am Lack gekratzt. Gerade hier in Leipzig. Mein Vater war da schon nicht mehr dabei. Ob das eigentlich jemandem aufgefallen ist? Doch, doch – in einigen Bildern, auf denen er neben Willy Brandt oder Oskar Lafontaine steht und Wahlkampf betreibt, oder als Mitglied jenes runden Tisches, an dem die politischen Kräfte der Wende zusammenkamen, habe ich ihn in letzter Zeit wieder öfter gesehen. Die Bilder decken sich kaum mit jenen, die ich im Kopf habe, von unseren letzten Begegnungen – mit den Eindrücken des permanent Sterbenden. Von ihm gesprochen hat in dem Zusammenhang kaum einer – bestenfalls erwähnt man die Enttarnung des Spitzels, wenn andere Enttarnte sich über Interviews und Entschuldigungen gerade rehabilitieren. Er hat sich dazu nie geäußert. Und das verzeiht man gemeinhin nicht …
Ich bin 1976 geboren worden. In einem Land, das es 13 Jahre später nicht mehr geben sollte. Das korrekt in einem Personalbogen außerhalb Deutschlands anzugeben ist nach der Wende über einige Jahre ein Problem.
Dieser merkwürdige Verlust zu Beginn der Pubertät, der im Prinzip eine Bereicherung ist, prägt meine Generation – eine Erfahrung, die ich 100-fach mit Freunden und Kollegen in der ganzen Welt diskutiert habe und die mich doch selbst immer wieder erstaunt. Wir haben auf eine sonderbare Weise gelernt, mit Unsicherheit umzugehen.
Als ich geboren werde, glauben in jenem Land weit mehr Menschen daran, den Sozialismus aufbauen zu können, als man heute annimmt, weit mehr zumindest als die wenigen, die das heute noch zugeben würden. Dennoch: Es ist das Jahr der Biermann-Ausbürgerung. Reiner Kunze hat seinen faszinierenden Prosa-Band Die wunderbaren Jahre veröffentlicht, in dem ich später mehr über jene Zeit erfahren werde, in der meine Eltern zusammenkamen, als von diesen selbst. Es rumort im Staate, und das bekomme ich gleich in einem Maße zu spüren, wie das wohl bei Weitem nicht für jedes Kind im Osten der Fall ist. Der Grund: mein Vater.
Als man dem politisch unliebsamen und nicht zuletzt deshalb wahrhaft populären Liedermacher Wolf Biermann nach einer genehmigten Tournee in die BRD die Wiedereinreise in die DDR verweigert und ihm die Staatsbürgerschaft entzieht, bricht ein Sturm los. Nicht nur Künstler und Intellektuelle protestieren in offenen Briefen. Einer der wortmächtigsten kommt von Reiner Kunze. Mein Vater protestiert auch, obwohl er, wie wir heute wissen, einer der eifrigsten Spitzel ist, die den DDR-Geheimdienst über Kunzes Tun und vor allem Denken informieren – in Greiz, dem Ort, in dem meine Eltern einander begegnen, halten junge Intellektuelle diesen ominösen Böhme dennoch für einen der Ihren, machen den eloquenten Redner mit der mystischen Ausstrahlung und geheimnisvollen Vergangenheit zu einer Art Idol. Er war immer ein fantastischer Erzähler.
Reiner Kunze verlässt 1977 freiwillig die DDR. Es ist eine Zeit, in der man glaubt, durch Vertreibung der Kritiker etwas zu erreichen. Das System wird daraus lernen und später nicht mehr so vordergründig Verbote aussprechen. Die Folgen der Biermann-Ausbürgerung und Kunze-Auswanderung werden meine Kindheit dennoch prägen. Irgendwann lese ich, dass es mein Vater war, der Kunze verriet.
Warten
»Warte mal!« – ein merkwürdiges Phänomen, dieser Satz. Würde man ihn wörtlich ins Französische oder Englische übersetzen, käme ein völlig anderer Imperativ heraus. »Kurz mal warten« … Offenbar ein typisch deutsches Paradoxon. Nicht selten, einfach dahingesagt – bestenfalls in der Funktion von »Einen Moment bitte!«, manchmal auch, um eine kommunikative Lücke zu schließen. Mit Warten an sich hat das wenig zu tun. Vielleicht ist Warten auch eigentlich gar keine Tätigkeit, sondern ein Zustand – amorph in seiner zeitlichen Ausdehnung und vor allem schwankend in seiner Intensität. Mir ist Warten unangenehm. Deshalb habe ich in Wartezimmern oder Wartebereichen auch immer etwas zu tun. Laptop auf dem Schoß, Buch in der Tasche. Mich faszinieren Menschen, die richtig warten können – also tatsächlich die Zeit auf den ersehnten oder erfürchteten Moment hin durchleben. Die Zeit an sich. Ich frage mich, ob für sie die Zeit dann irgendwann eine andere Form gewinnt, gegenständlich wird, etwas, das es tatsächlich zu überwinden gilt. Ich kenne Theorien, in denen von der Verräumlichung der Zeit die Rede ist, aber ob dieses Warten tatsächlich so erlebbar ist? Die Menschen, die ich bei diesem Warten-Warten beobachte, wirken so, als frästen sie sich durch irgendeinen Zeithaufen oder -berg, als hätten sie daran wahrhaft gegenständlich zu knabbern.
Solches Warten habe ich meistens vermieden. Wahrscheinlich kann ich das gar nicht. Es ist mir ja bisher auch noch nie gelungen, mich mit mir selbst zu langweilen – ich kann einen Film, eine Komposition oder sogar ein Buch langweilig finden. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich mich deshalb langweilen müsste. Wie sollte ich es also anstellen, Warten an sich zu erleben? Mit dem Erwarten ist das schon etwas anderes. Das ist bewusster. Und vielleicht ist das Warten auf meinen Vater, über das ich nachdenke, auch eher ein Erwarten, ein Etwas-herbei-Warten. So ein »Was-wäre-wenn?«- oder »Wie-wäre-das?«-Warten, ein Warten, bei dem die Fantasie die ganze Zeit in Aktion ist, etwas, das intensiver sein kann als das Erwartete selbst. Ich warte immer erlebnisreich.
Warten kann man angeblich lernen. Zumindest kann man es üben. Und in gewissen Maßen ist das mit Sicherheit auch gut – richtig und wichtig. Warten auf Weihnachten. Auf den Osterhasen. Sich in Geduld üben. Für Kinder sollte Warten zumindest in einem gewissen Maße mit Vorfreude verbunden sein. Doch worauf eigentlich sollte ich mich freuen bei dieser ganzen Warterei? Auf etwas, das für meine Freunde und Spielkameraden immer Alltag ist. Auf meinen Vater. Die Selbstverständlichkeit der anderen Väter ist mir immer relativ egal gewesen. Mir fehlte nichts. Zumindest hätte ich nicht gewusst, was. Andere mögen das anders gesehen haben. Möglicherweise ist da auch tatsächlich irgendetwas, aber das ist keinesfalls konkret genug, um bewusst zu sein.
Meine Eltern führen eine Fernbeziehung. Auch in der DDR ist das eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber diese schon. Es gibt keine Regeln, wann man sich sieht, keine ausgesprochenen Vereinbarungen, auch nicht, wann man sich spricht oder wie oft man sich schreibt. Schon gar nicht bezogen auf irgendeine Verantwortung für mich. Manchmal liegen Monate zwischen den Besuchen. Dann und wann bloß eine einzige Woche. Auf Ankündigungen kann man sich nicht verlassen. Immer besucht er uns – wir ihn ein einziges Mal.
Als ich zwölf bin, sind meine Eltern geschieden. An ihrer Beziehung ändert das nicht merklich etwas.
Wie man mit Wartezeit umgeht, ist das Entscheidende. Wie man sie füllt. Als solche erfahren habe ich sie selten. Höchstens in jenen merkwürdig ritualisierten Stunden am Freitagabend oder Samstagmittag, in denen fahrplanmäßig der Zug aus der Bezirksstadt eintraf, den man nehmen musste, wenn man aus dem Norden zu uns kommen wollte. Der Zug wäre natürlich deutlich öfter gekommen, aber dies waren die Zeitpunkte, die für seine Besuche üblich waren, so als hätte er irgendwo einen regulären Job mit festen Bürozeiten – wohl der einzige konventionelle Moment an der Fernbeziehung meiner Eltern.
Wenige Stunden, in denen wir das Warten am Fenster spielerisch verkürzten. Die Augen auf jene lange Straße geheftet, die die Reisenden entlangmarschierten Richtung Innenstadt. »Ich sehe was, was du nicht siehst …« – bis der Menschenstrom abebbt. Selten wird das Warten durch sein Erscheinen belohnt. Ich mag das Spiel trotzdem – egal, ob ich es mit meiner Mutter spiele oder mit meiner Großmutter. Vielleicht warte ich ein wenig lieber mit meiner Großmutter – sie erzählt nämlich auch Geschichten. Geschichten von früher. Aus einer Welt, die ich mir plastisch vorstelle, obwohl sie bestimmt ganz anders war. Meine Oma kann aus den lapidarsten Erlebnissen die atemberaubendsten Abenteuer machen oder die zwerchfellerschütterndsten Pointen. Alles scheint zum Greifen nah – die gestärkten Taftkleider auf dem Sonntagsausflug und die »Rouladen« genannten Haartollen auf den Kinderköpfen. Ich stelle mir das vor wie bei Nesthäkchen. Das kenne ich aus dem Fernsehen. Nur, dass all das genau hier stattgefunden hat, in der Straße, auf die wir hinabschauen. Ich kichere, weil unten gerade jener Mann vorbeigeht, von dem mir meine Oma beim letzten Mal erzählt hat. Sie ist selbst mit ihm in die Schule gegangen, und er hat sich von einem Mitschüler die Hand einklemmen lassen, in einem Schreibpult, das man damals als Schulbank benutzte, einer Wette wegen. Ich habe noch nie um irgendetwas gewettet. Und auch Schülerstreiche gehen an mir irgendwie meistens vorbei. Wahrscheinlich weil ich rot werde und auffallend still, von einem Fuß auf den anderen trete oder auf der Stuhlkante hin und her rutsche, sodass auch der einfältigste Lehrer oder Mitschüler mitbekäme, dass etwas nicht stimmt.
Nach geraumer Zeit beschließen wir unser Warteritual. Jetzt könnte nicht einmal mehr ein versprengter Eisenbahnpassagier am Horizont auftauchen. Natürlich ist das kein richtiger Horizont. Dafür ist die Straße viel zu kurz. Aber ich mag das Wort. Und ich mag die Vorstellung, dass Menschen einen Begriff für etwas geschaffen haben, von dem sie wissen, dass es schlicht eine Illusion ist. Himmel und Erde berühren sich nicht. Das hat man mir irgendwann einmal am Meer erklärt, und ich gebe die Information auch ungefragt sehr gern weiter.
Vielleicht warten wir von einem gewissen Moment an ohnehin nur des Rituals wegen. Und eigentlich fehlt auch nicht wirklich etwas im Leben jenseits dieser Wartestunden.
Ich glaube nicht, dass mein Vater der Grund dafür ist, dass ich eine pubertäre Leidenschaft für Beckett entwickle. Zumindest nicht allein. Und zumindest nicht einfach so, so im plump übertragenen Sinne. Doch jene Versuchsanordnung, die die Frage nach dem Sinn des Lebens mit der Idee des Wartens auf den schemenhaften Herrn Godot verknüpft, gefällt mir schon sehr gut. Als Erwachsene erwäge ich manchmal, einen Hund mit dem Namen Godot zu versehen. Der Pointe halber, wenn man das Tier ruft. Doch bisher waren unsere Hunde immer Hündinnen, und sie hatten auch immer schon ihren jeweiligen bodenständigen Namen.
Mit Namen ist das so eine Sache. Sie wecken immer irgendwelche Erwartungen, prägen uns, ob wir wollen oder nicht. Man wächst an und mit ihnen, und vielleicht prägt es eben auch unsere Hündinnen, dass ihnen die Tierheimmitarbeiterinnen äußerst schöne menschliche Vornamen mitgegeben haben. Auch mein Vorname hat mich immer wieder auf neue Weise herausgefordert. Auf jeden Fall ist er eindeutig nicht fürs Internetzeitalter gemacht. Was sich die Programmierer von Spamfiltern und Firewalls wohl denken, wenn sie Nachrichten herausfiltern lassen, nur weil sie diesen russischen Vornamen enthalten? Auf jeden Fall denken sie wohl nicht an Puschkin.
Ich heiße Tatjana. Mein Vater soll zu meiner Mutter gesagt haben, dass die Tatjana in »Eugen Onegin« die schönste Frauengestalt der Weltliteratur sei. Ich habe das Poem irgendwann in späterer Kindheit gelesen, hatte Jahre danach – Musikwissenschaftlerin, die ich nun einmal bin – trotzdem mehr mit Tschaikowskys Oper zu tun, die eigentlich gar keine Oper ist, sondern die Tschaikowsky mit »lyrische Szenen« untertitelt hat. Aus gutem Grund. Denn die große theatrale Tragik der richtig großen Oper, wie ich sie in der Pubertät so liebe, verweigert Tschaikowsky genau wie der Dichter. Erst später werde ich die Tragik unter der Oberfläche dieses Wortkunstwerks verstehen, das eine Folge von Seelenzustandsbeschreibungen ist, die aufeinander bezogen sind, aber doch nicht ineinandergreifen. Ich verstehe es spätestens dann, als mich Bücher fesseln, die von so etwas sprechen wie vom »Gleichzeitigen im Ungleichzeitigen«. Dergleichen gibt es auch in menschlichen Beziehungen. Ob sich Gleichzeitigkeit er-warten lässt? Wohl kaum …
Die von Puschkin in Verse gegossene Geschichte: Sie – aus ländlicher Tristesse heraus – sehnt sich nach dem Unerreichbaren an sich, nach einem geheimnisumwobenen Konstrukt, das sie im plötzlich in ihrem Leben auftauchenden Herrn des Nachbarguts verkörpert sehen will. Sie schreibt ihm. Er fühlt sich zur Ehe nicht gemacht. Als er sie später an der Seite eines anderen wiedersieht, bereut er bitter.
Heute sage ich: Dass es ein Puschkin-Poem war, das mein Vater so heraushob aus allem anderen, was geschrieben wurde, ist bezeichnend.
Als meine Mutter mir – der etwa Siebenjährigen – Puschkins Memoiren vorliest, habe ich meinen Spaß an der anekdotischen Darstellung, an der Sprachkunst. Dass die Geschichte des herumgereichten Kindes und des immer deplatzierten Erwachsenen, die ich da voller Spannung höre, irgendetwas mit mir oder jemandem, den ich kenne, zu tun haben könnte, entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Das ist alles so unterhaltsam weit weg. Irgendwann werde ich den rekonstruierten Lebenslauf meines Vaters lesen und erschrecken.
Zwar leben wir im Osten. Und hier ist es nicht unbedingt ein sozialer Makel, kein Auto zu haben oder etwa nicht Auto fahren zu können. Weil es bekanntlich nicht genügend Autos gibt, um die Nachfrage zu befriedigen, und man auch nicht einfach so zur Fahrschule stiefeln kann, um sich für den Lehrgang nächste oder übernächste Woche anzumelden. Hier wie da gilt es zu warten. Irgendwie ist die DDR so eine Art Warteland.
Trotzdem gibt es Autos und Autofahrer. Und zwar eine ganze Menge. Ich kenne einige davon. Triptis ist so weit ländlich geprägt, dass man mit den eigenen vier Rädern klar im Vorteil ist. Mein Opa fährt das Familienauto, einen Wartburg 311. Der hat mit den modernen Wartburgs nicht allzu viel zu tun, die in beachtlicher Stückzahl das Bild des Landes prägen, aber es ist ein fahrbarer Untersatz und erfüllt seinen Zweck. Das ist die pragmatische Seite der Medaille. Die andere ist die, dass sich hier auf dem Lande echte Väter schon irgendwie durch die Fähigkeit des Autofahrens auszeichnen. Mein Vater kann das nicht. Und nicht nur das, er kann es nicht einfach so nicht, wie man es nicht kann, weil man noch auf sein Zeitfenster für die Fahrschule wartet. Er ist dafür nicht einmal angemeldet. Er kann es nicht nur nicht, er will es auch gar nicht können. Und das ist eine ziemlich böse Sache. Während es längst zum Kult geworden ist, dass die Väter meiner Mitschülerinnen zum Ende der Kindergeburtstage alle Gäste nach Hause fahren, und die Position des letzten Gastes hart umkämpft ist, weiß ich, dass mein Vater nie zum glucksenden Vergnügen aller noch eine Ehrenrunde durchs Neubaugebiet drehen wird, weil er vorgeblich die Einfahrt verpasst hat. Einmal rettet mich der Westbesuch mit dem feuerroten VW Passat vor der Peinlichkeit des fehlenden Geburtstagskonvois, der leicht meine ansonsten rundum gelungenen Feiern zerstören könnte. Ansonsten organisiert meine Mutter eine erinnerungswürdige Wanderung entlang der jeweiligen Wohnsitze.
Manchmal träume ich schon davon, dass mein Vater nicht nur Auto fahren kann, sondern auch mit dem Auto käme. Das wäre praktisch. Und irgendwie hänge ich der absurden Vorstellung an, dass ihn das unabhängiger, flexibler in seinem Kommen machen würde – die Vorstellung, dass er in irgendeinem schicken Flitzer mitten in unser Warteritual hineinbrausen könnte, hat zwar etwas, doch eigentlich könnte ich ihn mir eher vorstellen, wie er auf einem Drachen in den Sonnenuntergang reitet, als am Steuer irgendeines Autos. Er wäre doch viel zu ängstlich für den Straßenverkehr. Überhaupt. Nein, am Steuer kann ich ihn mir nicht vorstellen. Da muss man schnell reagieren. Sich an Regeln halten, die man weder selbst geschaffen hat noch selbst auslegen kann. Und das im richtigen Moment. Das könnte er niemals. Ich stelle mir vor, wie er hin- und hergerissen ist, zwischen Sorge, was passieren könnte, und anarchischer Grundhaltung – zwischen der Idee, einfach losfahren zu können, und dem deutlichen Erkennen von Gefahren hinter allen Ecken und Kreuzungen, in sämtlichen Parklücken und wahrscheinlich auch unter allen Gullydeckeln des Landes; Gefahren, auf die man im Autofahrerdasein zwangsläufig gefasst sein muss und vor denen man sich in der Regel mit Ach und Krach schützen kann. Auf jeden Fall, was die Tatsache betrifft, dass in meinem Bewusstsein (und ziemlich sicher nur in diesem) mein Vater der einzige Vater weit und breit ist, der nicht Auto fährt, ist das nach gesundem Abwägen der Vor- und Nachteile, dem Vorstellen potenzieller Folgen und wahrscheinlicher Peinlichkeiten gut so. Lieber warte ich auf die Ankunft des Zuges.
Jahre später, als er Ministerpräsident werden will, fährt er immer noch nicht Auto. Warum auch? Politiker werden gefahren. Noch später steht das eh nicht mehr zur Debatte. Da wäre es Teil einer Normalität, die er für sich längst ausgeschlossen hat. Ob sein Kind von genau solch einer Normalität vielleicht träumen würde, das ist ihm wohl gar nicht in den Sinn gekommen. Eine Konstante in unserer Beziehung.
Als ich später, Jahre nach der Wende in einem längeren Prozess Autofahren lerne, nimmt er lediglich insofern Anteil, als er mich ermutigt, das sei wichtig, es fördere meine Unabhängigkeit. Stimmt! Aber mir ist das nicht neu …
Ich habe mir die Frage nie gestellt, ob er gewusst hat, dass wir warten. Ich glaube schon. Was ich mich allerdings oft gefragt habe, ob er die Wiedersehen ersehnt oder gefürchtet hat, ob sie in seinem Bewusstsein waren, immer dann, wenn wir für ihn nicht tatsächlich präsent gewesen sind.
Zwischen Pioniertuch und Barbie – Großwerden in der DDR-Provinz
Triptis und Greiz – Man könnte die Orte, von denen hier die Rede ist, umtaufen, sie mit einem Kürzel versehen, sie umschreiben – blumig oder drastisch, satirisch oder nüchtern, liebevoll oder rachsüchtig. Doch all das wäre sinnlos. Es ist ein Leichtes herauszubekommen, wovon die Rede ist, solange man weiß, von wem die Rede ist und wer erzählt. Und natürlich würde keine Umschreibung irgendetwas daran ändern, was ich hier erlebt habe – Aufregendes und vor allem auch Austauschbares. Letzteres ist es, was diese Plätze mit Tausenden anderen Städten verbindet, die zur gleichen Zeit auf dem gleichen Breitengrad existieren. Wahrscheinlich würden ähnliche Dinge unter relativ ähnlichen Voraussetzungen an Hunderten anderen Plätzen ziemlich genauso ablaufen. Es sind nicht die Orte, die besonders machen, was ich hier erlebt habe. Was ich hier erlebt habe, macht die Orte für mich besonders. So wie es wohl für die meisten die Plätze sind, die die Erinnerung für sie bewahren, während sie weitergehen. Ich komme gern nach Triptis zurück. Jede Veränderung hier erlebe ich mit Interesse und immer auch mit einer Portion Wehmut.
Heute, drei bis vier Jahrzehnte später, zu Hause im äußersten Süden bzw. Westen des Landes, also etwa 700 Kilometer entfernt vom Handlungsort dieser Erinnerungen, bin ich mir sicher, dass es die immer gleichen menschlichen Verhaltensweisen sind, die das Leben in der Provinz prägen, die politische Implikationen relativieren. Man kann Gleiches fühlen, äußerst Ähnliches erleben – zeitgleich in unterschiedlichen politischen Hemisphären.