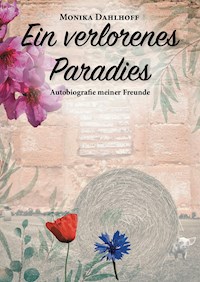Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gefangen, geschlagen, misshandelt. Wie soll aus all diesem Elend eine glückliche Frau werden? Wenn sie von all dem keine Ahnung hat, was sie in der Welt da draußen erwartet. Ihr die Schulbildung aus Krankheitsgründen versagt blieb. Sie Nonne in Kinderheimen mit Freuden werden wollte und auch das versagt blieb. Zwei Sterne am Himmel, Gott und Papa, ihr den richtigen Weg zeigen wollten. Doch leider war die Zeit dafür noch nicht gekommen. Da kamen plötzlich noch die Wege mit den Dornen und den falschen Wegweisern. Alles zog und zerrte an ihrem Körper wie auch an ihrer Seele. Man versuchte ihr das „ich“ zu zerstören, Ihren Körper und Ihre Seele zu missbrauchen. Die Welt mit allen Höhen und Tiefen gab ihr ständig die Hand. Nein sie fragt heute nicht, warum geschah das alles? Denn sie bekommt keine Antwort darauf. Die beiden Sterne am Himmel, Gott und Papa, konnten dieses Elend nicht mehr mitansehen. Es war genug gelitten. Sie führten Sie auf den Weg, zu einem Menschen, der Ihre Hilfe brauchte und dieser Mann durch sie Gottes Wort wieder fand. Nun endlich habe ich mein „Ich“ meine Achtung und meinen Stolz wieder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zur Autorin
Monika Dahlhoff wurde 1940 in Königsberg geboren und als Vierjährige nach Russland verschleppt. Nach dem Krieg kam sie zunächst in ein Kinderheim in der DDR, danach zu Pflegeeltern, bis sie wieder zu ihrer Mutter in Westdeutschland fand. Aber auch hier hörte ihr Martyrium durch den Missbrauch ihres Stiefvaters nicht auf.
Mit 18 Jahren verließ sie ihre Familie, nahm harte und zum Teil auch zwielichtige Jobs an. Um ihre beiden Töchter zu versorgen, ging sie in ihrer zweiten Ehe durch die Hölle. Sie eröffnete eigene Restaurants und gründete Firmen, in ihrer dritten Ehe endlich wurde sie glücklich. Heute pendelt sie zwischen Hamm/Westfalen und Málaga/Andalusien hin und her.
Ihr erstes Buch »Eine Handvoll Leben – Meine Kindheit im Gulag«, erschienen 2012 bei Bastei Lübbe, erregte großes Aufsehen und Resonanz in der Bücherwelt. Auch ihr zweites Buch, die Fortsetzung sozusagen, ist aufwühlend, zeigt ihre Entwicklung vom Opfer zur eigenständigen Frau. Mit diesem Buch schreibt sie sich frei von den Gespenstern ihrer Vergangenheit.
Ihre Homepage: www.eine-handvoll-leben.info
Inhalt
Vorwort
1958: Endlich 18!
Düsseldorf – Stadt der Freiheit?
Die ersten Arbeitsstellen
Erich
Mein Leben sollte sich mal wieder ändern
Bekanntschaften
Hassans Geschenke
Milano
Es sollte ein neues Leben beginnen
Verliebt, verlobt, verheiratet
1967 meine Tochter wird geboren
Die Kämpferin
Eine Autofahrt mit Folgen
Gerüchte über Gerüchte
Das Ende einer Ehe
Im Bierstübchen
Mein wilder Seemann
Ein Bodyguard ist gefragt
Etwas bahnt sich an
Die richtige Entscheidung?
Die ersten Ehejahre
Die Ehe-Hölle beginnt
Unternehmerin in einer Männerwelt
Ich muss für mein Kind kämpfen
Ich arbeite wie wild
Ein neues Domizil
Unser Schweinchen Boris
»Schicksal, nimm deinen Lauf«
Wieder Gerüchte
Missbrauch auch in der nächsten Generation
Das Ende?
Wieder ein neuer Anfang
Ein neues Leben
Vorwort
Eigentlich wollte ich dieses Buch nicht schreiben, doch auf Bitten meiner Leser von »Eine Handvoll Leben – Meine Kindheit im Gulag« ließ ich es dann doch zu und schrieb.
Nein, es sollte eigentlich kein Buch über die Zeit nach meinem 18. Lebensjahr geben, denn die Scham, einzugestehen, was mir angetan wurde, was ich mit mir machen ließ, war zu groß. Doch können Sie, liebe Leser, fühlen, wie es einem Menschen geht, der aufgrund seiner Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg an Körper und Seele krank ist, der nie auf einer Schulbank gesessen hat, nie einen Beruf erlernen konnte? Ich hatte bis zu meinem 18. Lebensjahr nie eine große Stadt gesehen und mein einziges Kapital waren 50 DM und ein unbändiger Lebenswille.
Doch mit der Kraft einer Kämpferin hatte ich mein Ziel stets vor Augen: Nicht untergehen! Aber es tauchten immer wieder Steine und Dornen auf, die mir den Weg versperrten. Dann waren da noch Männer, die mit ihren großen Händen nach mir griffen. Männer, die darauf aus waren, eine Frau zu quälen, sie zu demütigen, seelisch zu vergewaltigen, sie finanziell abhängig zu machen, um sie sich zu unterwerfen, bis an die Grenze ihrer Kraft.
Doch schaffte ich es bis hierher. Nun, mit 75 Jahren, habe ich endlich einen Beruf, zu dem Sie, liebe Leser, mich geführt haben. Ich darf heute »Autorin« zu mir sagen. Ja, im Schreiben und Lesen war ich selbst mein eigener Lehrer. Wenn ich auch nicht vollkommen im Schreiben bin, gibt es doch immer irgendwo Hilfe, denn ich habe eine große Kiste in mir gefüllt mit Worten, Buchstaben und Gefühlen, in der krame ich so lange herum, bis ich meine, das Richtige gefunden zu haben. Doch leider befindet sich in dieser Kiste auch die Schlaflosigkeit, die mich zum Schlafwandler werden lässt, wenn mir wieder etwas einfällt, was ich Ihnen noch erzählen wollte.
Einführung – kurzer Rückblick
Für eine kurze Zeit werden Sie mit mir in meine Vergangenheit zurückgehen, damit Sie wissen, was ich Ihnen in diesem Buch erzählen möchte.
Königsberg, Ostpreußen. 1940 im November: An einem winterlich verschneiten Sonntag bin ich, Monika Charlotte, geboren. Meine Mutter war erst 18 Jahre jung, von Geburt adlig und sehr schön. Mein Vater war 24 Jahre jung, von Beruf Goldschmied, doch im Zweiten Weltkrieg bei der Luftwaffe. Er war für mich der liebste Papa der Welt. Ich bekam sogar noch ein Brüderchen geschenkt, damit hatte ich jemanden zum Spielen. Doch so schön sollte es nicht lange bleiben. Papa wurde mit seinem Flugzeug abgeschossen und für uns begann eine sehr traurige Zeit. Aber da waren noch meine Großeltern, die auf dem Land ein Gut hatten, wo wir sie, so oft es ging, besuchten.
Königsberg brannte, Mama flüchtete mit Peter und mir zu unseren Großeltern. Mama ließ uns bei ihren Eltern auf dem Land, weil sie noch einmal weg musste, hatte sie gesagt. Doch der Frieden hielt hier nicht lange an. Alle Menschen, die auf unserem Gut arbeiteten, auch meine Großeltern, wurden von den Russen erschossen und unser Hof stand in Flammen. Nur die Kinder, wie ich, wurden von den Soldaten in ein russisches Gefangenenlager verschleppt.
Nach vier langen Jahren kamen wir Kinder, die es überlebt hatten, in der DDR in ein Krankenhaus, dann in ein Kinderheim, wo mich schließlich Pflegeeltern fanden. Nach acht Jahren spürte mich ein Bruder meiner Mutter über den Hamburger Suchdienst auf - doch leider, die Liebe zu meiner Mutter, nach der ich mich so lange gesehnt hatte, fand ich nicht. Von meinem neuen Papa wurde ich drei lange Jahre missbraucht. Dann endlich, mit 18 Jahren verließ ich mein Elternhaus wieder. Noch immer unerfahren, - noch nie hatte ich eine große Stadt gesehen,- zog ich hinaus in die weite Welt. Wie sich eine Schulbank anfühlt, hatte ich nie erleben können. Zwar hatte ich in der Gastwirtschaft meiner Eltern gearbeitet, unseren Haushalt geführt und auf meine neuen Geschwister aufgepasst, doch nie einen Beruf erlernt.
Nun, meine Leser, machen Sie sich auf eine fast unendlich schreckliche Geschichte gefasst.
Ich weiß, dass Sie es oft nicht verstehen werden, was ich Ihnen erzähle. Mir ist auch bewusst, dass so manches an meiner Schreibweise Ihnen nicht gefallen wird. Doch mein Leben im Gulag prägte mein weiteres Leben. Liebe Leser, vergessen Sie beim Lesen nicht, in welcher Zeit das alles geschah. Noch jung und dumm, aber nicht schlecht denkend, lief ich oft in mein Unglück, während sich all mein Denken und Handeln nur um meine beiden Mädchen drehte. Es sollte ihnen niemals so ergehen wie mir. Ich wollte ihnen eine gute und liebende Mutter sein.
Auch suchte ich nur nach Liebe, Liebe, die ich im Gulag verloren hatte.
Mein Streben war, nicht unterzugehen, und das um jeden Preis. Der Preis war hoch, oft viel zu hoch. Sogar meinen Stolz verlor ich nicht nur einmal.
Aber ich fand einen Mann, dem ich mein ganzes schlechtes Leben erzählte. Schon viele Jahre schenkt er mir nun die Liebe, nach der ich so lange gesucht hatte.
1958: Endlich 18!
Heute war mein 18. Geburtstag, auf den ich so lange gewartet hatte. Endlich. Tante Marile, die in unserem Restaurant die Kegelbahn führte, hatte mir versprochen, ich dürfte von allen Schnapsflaschen in ihrer Bar einen Schluck zu trinken bekommen, wenn ich 18 Jahre alt sei. Als sie das damals sagte, lachte sie. Nun weiß ich auch, warum.
Nur wenig von einigen Schnäpsen schüttete sie mir zu meinem Geburtstag in ein kleines Gläschen. Nein, kein roter Apfel, wie der, den Oma mir früher auf meinen Geburtstagstisch gelegt hatte, war heute mein Geschenk: Es war Alkohol, den ich so hasste. Denn bis zu diesem Tag hatte ich noch keinen Alkohol getrunken. Als ich es jetzt tat, setzte die Wirkung schon nach ein paar kleinen Schlucken ein. Tante Marile brachte mich nach oben in unsere Restaurantküche, damit mich die Gäste der Kegelbahn in diesem Zustand nicht sahen.
Sie setzte mich an den Küchentisch unseres Restaurants, an dem jetzt Mama und Papa saßen, wo sonst immer im kleinen Kreis mit der Familie und unseren Angestellten gefeiert wurde. Plötzlich sah ich, wie beide über mich lachten, in meinem Kopf drehte sich alles, doch da hörte ich Worte, die ich nicht mehr einordnen konnte. Auch wie ich hier in die Küche gekommen war, wusste ich nicht mehr. Nur eins weiß ich heute noch: dass ich viel geweint hatte und ein Küchenhandtuch vor mein Gesicht hielt. Das tat ich sicher aus Angst, etwas zu erzählen, was immer ein Geheimnis bleiben sollte.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, war mein Kopf schwerer als mein Körper. Als ich dann an mir heruntersah, stellte ich mit Schrecken fest, dass ich nackt war. Ich schämte mich und zog die Bettdecke schnell wieder über mich, doch es half nichts, ich musste zur Arbeit.
Später, als ich in die Restaurantküche ging, begegnete mir als Erster Papa, der mich aber mit einem Grinsen begrüßte. »Wer hat mich in mein Bett gebracht?«, fragte ich vorsichtig. »Ich«, antwortete er, »habe dich nach oben getragen, ausgezogen und in dein Bett gelegt.« Fast flüsternd fragte ich: »Sonst habe ich nichts gemacht?« »Doch«, sagte er, »ich bin noch eine Weile bei dir geblieben.« Als ich bei diesen Worten in sein Gesicht sah, wusste ich, was passiert war. Sofort drehte ich mich um, ging in unser Restaurant, um zu arbeiten. Jedoch stellte ich schnell fest, wie schwer mir heute die Arbeit fiel. Meine Beine gehorchten mir nicht, mein Kopf tat mir weh.
Am späten Nachmittag bekam ich von Mama doch noch ein paar Stunden früher frei und konnte schlafen gehen. Nun hatte ich endlich verstanden, was es bedeutete, wenn von den Gästen jemand sagte: »Ich hatte einen Filmriss.« Mir fehlten einige Stunden der Nacht, die ich jetzt nachholen musste. Aber auf keinen Fall wollte ich vergessen, was ich mir vorgenommen hatte.
Als ich erwachte, war es draußen schon dunkel. Sehnsüchtig wartete ich in meinem Zimmer, bis das Licht und die Musikbox in unserem Restaurant ausgingen. Nur in meinem Kopf, da konnte natürlich nichts ausgeschaltet werden. Mir ging es immer noch nicht gut, aber eines wusste ich genau: Hier musste ich weg. Weg von meinem Stiefvater, weit, weit weg. Dies alles hier musste ein Ende haben. Wenn ich jetzt nicht ginge, würde alles so bleiben, aber das konnte und wollte ich nicht ertragen.
Langsam zog ich mich an, suchte nach meinem kleinen Koffer, den ich unter meinem Bett versteckt hatte, und packte einige meiner Sachen hinein. Es war nicht sehr viel, aber mehr brauchte ich auch nicht. Schnell schob ich den Koffer wieder unter mein Bett, es hätte noch jemand kommen können. Das heißt, Papa hätte noch in mein Zimmer kommen können, sowie er es oft tat, wenn er Mama in ihr Bett brachte, dann aber wieder in die Küche ging, sich an den Küchentisch setzte und ein Bier oder Ähnliches trank. Oft, wenn dann alles ruhig im Haus war, kam er noch zu mir in mein Zimmer. Sollte ich aber die Tür einmal abgeschlossen haben, brachte er es fertig, sie einfach aufzubrechen. Und mich zu nehmen. Und mich danach mit einem Lachen, das mich frieren ließ, zu verlassen.
In solchen Nächten fand ich keinen Schlaf, rollte mich wie ein Igel in meinem Bett zusammen und lauschte zitternd auf alle Geräusche, bis er tatsächlich noch einmal aus der Küche zurückkam: »Lass dir was einfallen, was du morgen wegen der kaputten Tür zu deiner Mutter sagst!« Wann auch immer er diese Sachen mit mir tat, ich stand mit meiner Erklärung vor meiner Mama alleine da, ich verschwieg aus Angst jedes Mal, was passiert war. Ja, er wusste genau, dass Mama immer Schlaftabletten nahm, damit sie den Krach aus dem Restaurant nicht hörte. Und das nutzte er ständig aus. Wie oft es nun schon passiert war, wusste ich nicht mehr, aber es war zu oft. Die Angst, die ich jedes Mal hatte, jemand könnte hören, was er mit mir tat, ließ mich zittern.
Ein seltsames Gefühl schlich sich plötzlich bei mir ein: In den vielen langen Jahren im Gulag hatte ich oft auf meinem Strohlager gelegen und nach Mama geweint, gerufen, gehofft und darum gebetet, sie wiederzusehen. Nun aber würde ich sie verlassen, so wie sie mich jeden Tag verließ, indem sie nicht bemerkte, was mir geschah. Sie hatte mich verlassen: Sie gab mir keine Liebe, auch wenn ich sie in langen, mit Tränen erfüllten Nächten von ihr ersehnt hatte. Sie war nicht die Mama, nach der ich mich gesehnt hatte. Sie hatte ihre Kinder nicht einmal gesucht. Es war ihr Bruder, der die Ungewissheit nicht mehr ertragen konnte und wissen wollte, wo sich ihre Kinder befanden, ob sie noch lebten.
Nun aber würde ich Mama verlassen, verlassen für immer, das hatte ich mir lange genug überlegt und war der Überzeugung, es richtig zu machen. Ich wollte von Papa nicht mehr missbraucht werden, mir fehlte die Kraft, das weiter zu ertragen. Auf meinem Nachttisch brannte eine kleine Kerze. Damit der Schein nicht durch meine Tür zu sehen war, hatte ich einen Schuhkarton davorgestellt. Angespannt, aber schon angezogen saß ich auf meinem Bett, das Radio spielte leise ein Lied, welches mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen ließ. Die Worte waren französisch gesungen, aber ich kannte sie, denn dieses Lied hatte ich schon einmal gehört, damals jedoch nicht mit diesen Gedanken und Gefühlen wie heute: »Rien ne va plus« – »Nichts geht mehr« – heißt dieses Lied, und die sanfte Stimme der Sängerin ließ mich plötzlich frieren.
Endlich hörte ich die Schritte meiner Eltern die Treppe heraufkommen, sie gingen geradewegs ins Schlafzimmer. Zitternd hoffte ich, dass Papa nicht wieder aus dem Schlafzimmer zu mir käme. Aber nach den Schritten, die ich auf der Treppe gehört hatte, musste er wohl sehr betrunken sein. Leise, aber sehr schnell zog ich meinen kleinen gepackten Koffer unter dem Bett hervor und nahm alles Geld, das ich hatte. Es waren genau 50 Mark.
So schnell ich konnte, lief ich den Berg hinunter zum Bahnhof unseres kleinen Dorfes. Da saß ein älterer Mann, der gewöhnlich die Fahrkarten verkaufte, hinter einer Glasscheibe. Erstaunt schaute er mich an, denn um diese Zeit hatte er wohl selten Menschen in seinem Bahnhof gesehen. »Was willst du denn schon so früh hier?«, fragte er mich. In meinem Kopf war plötzlich alles durcheinander. Ich wusste so schnell auf seine Frage keine Antwort, hatte ich mir doch auch vorher keine Gedanken darüber gemacht, wo ich eigentlich hinwollte. Der Mann aber lächelte mich an und sagte: »Na, hast du vergessen, was du hier wolltest, oder hast du vergessen, wo du hinwillst?« »Nein«, sagte ich vorsichtig, »ich soll mit dem nächsten Zug fahren.« Da hörte ich ihn sagen: »Na, dann willst du sicher nach Düsseldorf.« Schnell sagte ich: »Ja!« Mir fiel ein Stein vom Herzen, da alles gut gegangen war. Und ich nahm den erstbesten Zug, wohin, war mir egal. Nur weg, weg von zu Hause, das doch kein Zuhause war.
Völlig außer Atem vom schnellen Laufen und vor Angst, doch noch aufgehalten oder erwischt zu werden, ließ ich mich schnell in einen bequemen Sitz im Zug fallen. Mein Herz wollte sich nicht beruhigen, so aufgeregt war ich, es schlug, als wollte es aus mir herausspringen. Da bemerkte ich, dass ich ganz allein in einem Abteil saß. Als der Zug anfuhr, langsam, ganz langsam, beruhigte ich mich dann doch. Schaute aus dem Fenster meines Abteils und sah, wie die Häuser, die Bäume, die Felder an mir vorbeirasten. Hin und wieder hielt der Zug, Menschen sah ich ein- und aussteigen. Doch ein Schild mit dem Namen der Stadt, für die ich eine Fahrkarte in meiner Jackentasche hatte, war noch nicht zu sehen. Da merkte ich, wie müde ich doch war. Das Licht in dem Abteil war nicht sehr hell. Ich musste aufpassen, dass mir die Augen nicht zufielen. Meinen kleinen Koffer hatte ich vor meinen Sitz gestellt, meine Füße darauf, so konnte ihn mir niemand wegnehmen. Immer noch war die Angst in mir, dass mir etwas weggenommen würde, wenn ich nicht gut aufpasste. Ja, der Gulag ließ mich einfach nicht los, er hatte Spuren hinterlassen, er hielt an mir fest wie ein Gespenst. Diese Jahre konnte ich einfach nicht vergessen, sie verfolgten mich. Zu oft fühlte ich noch die Schmerzen, die Qualen, die ich ertragen hatte.
Als ich so in der Ecke des Abteils saß, schloss ich schließlich doch meine Augen. Aber nicht schlafen, nur nicht einschlafen! Diese Gedanken hielten mich wach. Plötzlich merkte ich, wie warm es mir war, ein kleines Lächeln schlich sich in mein Gesicht. Hatte ich doch mein Leibchen, das mir meine Pflegemutti gestrickt hatte, retten können, als Mama mir damals, als ich von meinen Pflegeeltern kam, alle Kleidung weggenommen hatte. Sie waren ihr nicht schick genug. »So etwas trägt man hier nicht mehr«, hatte sie gesagt. Damals weinte ich, aber es half nichts, denn Mama meinte:
»Diese alten, hässlichen Sachen brauchst du nicht mehr.« Sie schenkte mir dafür schreckliche - neue Dinge: wie Nylonwäsche, Seidenunterhöschen mit Spitze und vieles mehr, sogar rote Schuhe mit Absatz. Die hatte ich jetzt aber zu Hause stehen gelassen. Sie würden mich immer an eine traurige Zeit erinnern, und ich wollte doch nun alles hinter mir lassen. Heute trug ich meine Sportschuhe, die ich sehr gerne mochte, nur ausgerechnet bekam ich sie von meinem Stiefvater geschenkt als wir einmal in die Berge gingen. Das gefiel mir nicht, denn nun würde ich immer an ihn erinnert werden. Erinnert an Vergewaltigungen meines Körpers und meiner Seele. Doch hatte ich das gestrickte Leibchen von damals was mir meine Pflegemutti geschenkt hatte retten können. Die Knöpfe ein wenig versetzt, passte es jetzt noch, denn ich war wie damals sehr schlank. Ich stellte fest, wie mich das Leibchen auch heute noch warmhielt und mir dabei das wunderbare Gefühl gab, die Zeit sei stehengeblieben.
Während ich mit geschlossenen Augen, den Kopf angelehnt an eine Fensterecke saß, hatte ich Zeit, über vieles, was geschehen war, nachzudenken. Über meinen Geburtstag, der ständig von allen vergessen wurde. Über die Geschenke, die ich nie bekam. Doch ich tröstete mich damit, dass es wohl an der vielen Arbeit lag die alle hatten. Dass das nicht stimmte, was ich mir da zurechtlegte, wusste ich genau, aber so war es etwas leichter für mich und tat nicht so weh. Selbst die roten Äpfel, die ich als Kind zum Geburtstag immer von Oma, Opa, auch von Mama bekommen hatte wurden vergessen. Wie schön sie doch ausgesehen hatten als sie in einer Schüssel lagen. Oma hatte sie immer rot poliert. Wie groß war meine Freude jedes Mal. Ja, das konnte, - auch wollte ich es nie vergessen. Und wenn mich später, als ich aus dem Gulag kam, jemand fragte, wann ich Geburtstag hätte, sagte ich immer: »Dann, wenn es rote, polierte Äpfel gibt!« Doch leider verstand mich niemand. Tränen liefen über mein Gesicht wenn ich daran dachte. Ja, für alle war ich immer da, zu jeder Zeit. Wenn meine Geschwister krank waren, sie etwa Keuchhusten hatten, trug ich sie auf meinen Schultern hinauf in die Berge. Wenn Mama etwas brauchte, war ich für sie da und für meinen Stiefvater, war ich zu jeder Zeit griffbereit. Es sollte Liebe sein, aber was er mit mir tat, war für mich die Hölle. Ich suchte so sehr die Liebe und die Hilfe meiner Mama, doch sie schien es nicht einmal zu bemerken.
Aber nun sollte das alles ein Ende haben. Ich wollte mein eigenes Leben beginnen, mein Glück suchen und die Liebe, die ich noch nie erfahren hatte, nun endlich doch noch finden. Jetzt wollte ich allem entfliehen, was mir so wehgetan hatte. Mein Leben sollte nur noch schön werden, jetzt wollte ich selbst bestimmen und entscheiden.
Doch meine Reise war noch nicht zu Ende und die Gedanken ließen mich nicht zur Ruhe kommen. Sie gingen wieder zurück in die Zeit, die ich am liebsten vergessen hätte, in eine Zeit, in der mir sehr wehgetan wurde. Damals, als ich 14 Jahre alt war, war ich fest entschlossen, Nonne zu werden – nach der strengen, christlichen Erziehung durch meine Pflegeeltern. Ich wollte Kindern in Heimen helfen, die ihre Eltern verloren hatten, so wie ich. Sie sollten durch meine Hilfe bald wieder Kinder werden und nicht kleine wilde Tiere oder Monster bleiben, die man in ein unbekanntes Leben zurückwarf. Dann müssten sie auch ihr Essen nicht mehr durch Stehlen besorgen. Ich wollte ihnen Liebe schenken, die wir leider alle nicht mehr kannten. Liebe, die auch ich nicht bekommen hatte. Die Sehnsucht, einmal über den Kopf gestreichelt zu werden, einmal lieben Worten zu lauschen, wollte ich ihnen erfüllen. Etwa so, wie ich es erlebt hatte, wenn ich »mein Engelchen« genannt wurde, von Papa, als ich klein war, bevor er im Himmel beim lieben Gott blieb. Und sein Flugzeug zur Erde fiel. So erzählten es mir immer meine Großeltern. Doch eines vergaß ich nie: Immer, wenn ich nachts aus einem Fenster am Himmel die Sterne leuchten sah, war der hellste Stern mein Papa.
Wenn der Wind oben am Himmel die Wolken verschob, hatte ich das Gefühl, dass Papa mit mir sprach, mir wieder Mut gab weiterzuleben. Damals, als ich noch klein war und Papa im Gulag so vermisste, sah ich ihn mit meinen Kinderaugen und fühlte ihn mir ganz nah, wenn sich dann die Wolken am Himmel bewegten, glaubte ich, dass er mich hörte. Später schenkte mir Mama die einzigen Fotos, die sie noch hatte. Es waren Babybilder von mir und zwei Bilder von meinem Papa, wie er im Krieg Briefe an Mama und mich schrieb. Wie er mich als Baby auf seinem Arm hielt mich an sich drückte und küsste. »Ich gebe sie dir, ich kann sie nicht mehr gebrauchen, aber sicher willst du sie haben«, das waren die Worte von Mama. Und ob ich sie haben wollte! Denn nun bekam mein Stern am Himmel ein Gesicht, es war Papas Gesicht, mir schien als hätte ich ihn immer so gesehen wie auf diesen Bildern.
Noch etwas hatte ich damals, als Mama mir meine Kleider wegnahm, sie durch neue ersetzte retten können, ein kleines Taschentuchtäschchen das meine Pflegemutti selbst gehäkelt hatte. Ich hatte es damals immer um meinen Hals getragen, mit einer langen gehäkelten Schnur; so konnte ich mein Taschentuch nicht verlieren. Jetzt hatte ich es um meine Schultern gelegt, es hing vor meiner Brust, ganz versteckt, damit es niemand sehen konnte. In diesem Täschchen befand sich mein größter Schatz: Es waren die vier Bilder von meinem Papa und mir. Eins wusste ich genau: »Die kann mir hier keiner stehlen!«
Jedoch, wie lange war ich jetzt schon in meinen Gedanken versunken? Ich sah aus dem Fenster, sah Menschen ein- und aussteigen, dann las ich auf einem Schild den Namen einer Stadt, schaute schließlich auf meinen Zettel mit den Namen der Stationen, den mir der Mann am Fahrkartenschalter gegeben hatte. Nun, einige Haltestellen hatte ich noch vor mir, stellte ich fest. Ich lehnte mich wieder zurück an mein Fenster und durch das gleichmäßige Geräusch des Zuges verfiel ich wieder in meine Gedanken.
Damals, als ich 14 Jahre alt war, fand mich endlich ein Onkel Hans. Er war der Bruder meiner Mama er hatte mich und meinen Bruder gesucht. Onkel Hans nahm mich mit nach Nürnberg. Da hörte ich ihn eines Tages mit Mama telefonieren: »Ja, das ist dein Kind«, Mama muss das angezweifelt haben, denn sie sagte: »Wenn dieses Mädchen einen Leberfleck oben zwischen ihren Schamhaaren hat, nur dann ist es mein Kind.« Das war nun eine sehr schwierige Aufgabe für Onkel Hans das festzustellen. Also schickte er die Tante Maria, seine Frau zu mir, sie solle doch einmal nachsehen ob es diesen Leberfleck bei mir wirklich gibt.
Ich wehrte mich unter Tränen, durfte mich doch niemand da anfassen oder mein Höschen runterziehen, wie hätte mein Pflegevater mich dafür geschlagen. Die Tante sah dann aber doch meinen Leberfleck und Onkel Hans war glücklich, er hatte das richtige Kind gefunden. Er erzählte mir, dass meine Mama lebt, dass sie wieder geheiratet hatte, einen bekannten Wintersportler. Aber damit konnte ich jetzt noch nichts anfangen, denn meine Gedanken drehten sich nur um Mama. Auch zwei Halbgeschwister hätte ich, hörte ich ihn noch sagen.
Nun konnte ich mir denken, warum Mama mich und meinen kleinen Bruder nie gesucht hatte. Durch die neue Familie brauchte sie uns beide nicht mehr. Doch ein Gedanke ließ mich nie los: Wollten denn alle, Mama, ihr Bruder auch ihre anderen Geschwister, nicht wissen, was mit ihren Eltern passiert war? Dass man sie neben mir auf unserem Gut erschossen hatte?
Als Mama damals ein kleines Bündel von einem Soldaten überreicht bekam, der ihr mitteilte, Papa sei vom Himmel geschossen worden, brach sie unter Tränen zusammen und bekam mein Brüderchen zu früh. Er wäre durch ihren Sturz fürs ganze Leben behindert geblieben. Was Mama aber nicht wusste, weil sie uns ja nie gesucht hatte, war, dass mein kleiner Bruder auf dem Transport nach Russland in ein Gefangenenlager gestorben war. Ob er krank oder erfroren war, wusste ich nicht, denn ich war viel zu klein, um das selbst festzustellen.
Ob ich mich gefreut hatte, meine Mama damals endlich wiederzusehen? Ja, das kann man sich doch denken, ich war glücklich und sehr, sehr aufgeregt. Die ganzen Jahre im Gulag hatte ich auf Mama gewartet. Es war einer der wichtigsten Gedanken, der mich am Leben hielt, die schweren Hungerwinter, die Jahre bei meinen Pflegeeltern, in denen ich so sehr geschlagen wurde, weil sie wieder einen Menschen aus mir machen wollten. Und nun, wo ich sie wiederhatte, sollte mich endlich meine Mama in ihre Arme nehmen, mir über meinen Kopf streicheln »mein Engelchen« sagen. Die Liebe, auf die ich so viele Jahre gewartet hatte, sollte ich jetzt von ihr nun endlich bekommen. Doch nein. Leider kam alles anders, als ich es mir gewünscht hatte.
Als ich damals nach langer Fahrt in einem kleinen Dorf in Bayern mit meinem Onkel aus dem Zug stieg, sah ich nicht meine Mama auf mich warten, sondern einen fremden Mann, den ich im gelblich schimmernden Licht einer Bahnhofslaterne kaum erkennen konnte. Plötzlich nahm mich der Mann in seine Arme, und mit feuchten Lippen küsste er mich auf den Mund. Ich erschrak, ein Mann, den ich nicht kannte, küsste mich auf meinen Mund! Auf den Mund, der bis jetzt nur mir gehört hatte, den niemand küssen durfte, und schon überhaupt kein Mann. Denn Männer machten mir Angst. Das hatte ich im Gulag gelernt, mit eigenen Augen gesehen: Die Soldaten kamen nachts, holten die Mädchen aus unseren Baracken und vergewaltigten sie; am nächsten Tag lagen sie nackt und tot auf dem Hof. Wenn ich von Männern immer noch keine Berührung ertrug, so fuhr mir jetzt ein eiskalter Schauer durch meinen Körper. Da hörte ich die Worte meines Onkels: »Er ist dein neuer Papa.« Ein gelbes, schwaches Licht aus der Bahnhofslaterne fiel auf das Gesicht meines neuen Papas. Zu gerne hätte ich ihn mir einmal angesehen, doch ich traute mich nicht, denn dieses Gefühl, dass ein Mann mich berührt hatte, steckte noch in mir. Der Fußweg, den wir nun gemeinsam gingen, schien mir nie zu enden. Endlich hatten wir ein Haus erreicht. Als wir die Haustür öffneten sah ich eine lange Treppe, die nach oben führte. Hier sollte ich meine Mama sehen!
Oben angekommen, schob mich Onkel Hans in ein Zimmer. Schnell stellte ich fest, es war ein Schlafzimmer. Da sah ich die blonden Haare, die ich nie vergessen hatte. Mama stand von ihrem Bett auf. Ich konnte sehen, dass sie geweint hatte. Ihre Augen waren rot umrandet, ihre Wangen feucht von ihren Tränen, ihre blauen, großen Augen waren klein geworden vom Weinen.
Ich stand da, als wäre ich festgewachsen, konnte nicht glauben, dass ich nun bei meiner Mama sein sollte. Die Gedanken stürmten durch meinen Kopf, es dröhnte darin, als hörte ich die russischen Schneestürme, wenn sie um unsere Baracken wehten. Mama nahm mich endlich in ihre Arme, nun weinte auch ich. Lange unterhielten wir uns allein in ihrem Schlafzimmer, aber gefragt hat sie mich nicht, was mit mir, Peter und ihren Eltern passiert war. Jetzt war es mir aber auch nicht so wichtig. Ich war überglücklich, sie endlich gefunden zu haben, wartete nur noch auf die Zärtlichkeiten, die ich so sehr vermisst hatte, nach denen ich mich immer noch sehnte.
Die Nacht wurde lang, denn nach einer Weile waren wir in ein Wohnzimmer gegangen, in dem Onkel Hans und Papa saßen und sich angeregt unterhielten. Doch schon am nächsten Morgen geschahen Dinge, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Mama kaufte mir neue Kleidung, sie überschüttete mich geradezu mit Sachen, mit denen ich noch nichts anfangen konnte und auch nicht wollte. Ich war stolz auf die Kleidung, die ich trug. Auch stolz war ich auf meine langen Zöpfe, denn als ich aus Russland kam, hatte ich eine Glatze und den Kopf voller Läuse. Meine Pflegeeltern freuten sich damals, wie schön mein neues Haar wuchs, es sollte nie abgeschnitten werden. Einmal, als gerade niemand im Haus war, schnitt ich mir heimlich ein paar Stirnhaare ab. Es waren nicht mehr als fünf, denn ich hatte Angst, mein Pflegevati würde mich hauen. Ich wollte einmal aussehen wie die anderen Mädchen. Ja, ich bekam Schläge, wurde schrecklich beschimpft, wie ich denn jetzt aussähe. Ich musste diese kurz geschnittenen Haare mit einer Klemme wieder zu den anderen stecken.
So sah ich nun aus, als ich vor meiner Mama stand, mit langen, schönen Zöpfen. Aber das mit den Haaren sollte sich ab sofort ändern. Mama wollte sie einfach abschneiden lassen. Wenn mein Pflegevater das gewusst hätte, hätte er mich mit dem Siebenzagel totgeschlagen. Ich fühlte mich schrecklich. Wie gerne hätte ich die neuen Sachen gegen die schwarz-weiße Kleidung, die damals schon für mich bereit lag, um katholische Schwester im Kinderheim zu werden getauscht. Eine Welt war für mich zusammengebrochen. Eine andere hatte mich aufgenommen, in der ich nicht sein wollte. Alles, was ich bis jetzt erfahren und erlebt hatte, erschien wie ein Traum; nun stand ich in der Wirklichkeit. Doch wenn das die Wirklichkeit, mein neues Leben sein sollte, wusste ich nicht, wie ich mich hier zurechtfinden sollte.
Ich konnte mich nicht wehren und weinte. Kaum hatte ich Mama wiedergefunden, brachte sie mich zu einem Friseur mit dem Auftrag: »Die Zöpfe kommen ab, das trägt man nicht mehr. Und ich habe auch keine Lust«, bei diesen Worten schaute sie mich plötzlich ernst an, »dich jeden Morgen zu kämmen.« Ich erschrak über ihre Worte. Ich sah, wie leid ich der Friseurin tat, aber auch sie war machtlos gegen Mamas Worte. Sie schnitt meine Zöpfe ab. Die abgeschnittenen Zöpfe aber durfte ich mitnehmen. Ich versteckte sie in dem Karton von meinen roten Schuhen.
Damals war für mich eine Welt zusammengebrochen. Aus einem kleinen Wesen, das aus einem Gulag entkommen war, war durch strenge Erziehung ein Mensch gemacht worden – und dann?
Die Gedanken ließen mich nicht zur Ruhe kommen. Die Geräusche des Zuges, die Schatten von Wäldern und Feldern sah ich immer noch vorbeirauschen. Würde ich denn nun Liebe finden? Aber was war denn die Liebe? Hatte ich sie vergessen oder sogar verlernt? Als mich mein Pflegevater nachts oft in die Mitte seines Ehebettes legte, damit er Mutti nicht berühren musste: War das Liebe? Doch da spürte ich jedes Mal die Angst, dass ich im Schlaf zu nah an Vati rutschen könnte oder ihn berühren würde. Mein Zittern, die Angst neben ihm zu liegen ließen mich nicht schlafen. Wie war ich froh, wenn die Nacht zu Ende war und Vati sehr früh aufstand um die Tiere zu füttern. Erst dann schlief ich ein. Ja, Vati hatte mich auch gelehrt, vor Männern Angst zu haben, denn Männer schlagen Kinder und misshandeln sie.
Später, nach all den schweren und traurigen Jahren, bekam ich dann einen neuen Papa, aber der war kein Papa, er benutzte meinen Körper, wann immer er wollte. Er tat mir oft sehr weh, doch ich lernte, dass mein Körper wichtig für ihn war. Aber wo sollte ich die Liebe kennenlernen? Nein, Liebe kannte ich schon lange nicht mehr, nur Gehorchen.
Düsseldorf – Stadt der Freiheit?
Nun habe ich ja mein eigenes Leben, sagte ich mir, als ich aus meinen Gedanken erwachte. Jetzt kann ich selbst bestimmen, was mit mir passiert. Der Gedanke, endlich frei zu sein, brachte mich wieder in mein neues Leben, das nun auf mich wartete. Ich schaute aus dem Fenster des Zuges und erschrak, als ich auf einem näher kommenden Schild das Wort »Düsseldorf« lesen konnte. Ich hatte die Stadt erreicht, in der ich das finden wollte, wonach ich mich immer gesehnt hatte:
Freiheit und Liebe.
Düsseldorf, von dieser Stadt hatte ich schon viel gehört, durch die Gäste, die zu uns ins Lokal kamen. Und in dieser Stadt wollte ich nun mein Glück finden. Doch jetzt beunruhigten mich erst einmal die vielen Menschen, die alle hin und herliefen, aber doch wussten, wohin sie wollten, ganz anders als ich. Mutig nahm ich meinen kleinen Koffer und ging staunend durch eine riesige Bahnhofshalle. Ja, hier war alles viel größer als bei uns auf dem Dorf. Da fühlte ich, wie mich ein leichtes Zittern durchfuhr. Dann ging ich mutig mit meinem kleinen Koffer zu einem Schließfach, denn ich hatte zugesehen, wie es andere Menschen machten. Ich prüfte, ob ich den Koffer gut abgeschlossen hatte, war er doch alles, was ich besaß.
Leider war nicht mehr sehr viel von meinen 50 Mark übrig geblieben. Plötzlich merkte ich deutlich, wie sich mein Magen meldete, ich hatte Hunger. Doch mit meinem wenigen Geld musste ich sparsam umgehen. So ging ich ziellos durch die Straßen dieser großen Stadt. Alles hier war fremd für mich. Noch nie hatte ich eine so große Stadt mit hell erleuchteten Straßen gesehen, aber die vielen fremden Menschen machten mir plötzlich Angst. Bei meinen Pflegeeltern hatte ich auf einem großen Gut hinter hohen Zäunen und Mauern gelebt, war nur selten einmal ins Dorf gekommen. Ich hatte Angst vor fremden Menschen, Angst, sie könnten mich wieder mitnehmen und einsperren. Als ich noch bei meiner Mama wohnte, war ich immer nur in unserem Restaurant, in dem ich arbeiten musste und kam nur selten nach draußen.
Da stand ich nun an einer Straßenecke, eine Seite hell beleuchtet, die andere etwas dunkler. Auf einem Straßenschild las ich »Königsallee«. Die lange Straße mit den hell erleuchteten Schaufenstern versetzte mich in eine andere, nie gesehene Welt. Ich ging von Schaufenster zu Schaufenster und blieb immer öfter stehen. Manchmal drückte ich mein Gesicht so dicht an ein Fenster, dass ich beim Anblick der schönen Sachen die dicke Schaufensterscheibe total übersah und mir den Kopf daran stieß. Es war wie in einem Märchen. Ich vergaß sogar was ich hier eigentlich wollte. Auch meinen knurrenden Magen nahm ich kaum mehr wahr.
Plötzlich, als ich meinen Blick von einem Schaufenster abwandte und nach vorne richtete, sah ich einen gut gekleideten Mann, der aus einem schönen, großen Auto stieg. Ich erschrak. Der Fremde blieb vor einer Haustür stehen, als ob er auf mich wartete. Mit klopfendem Herzen näherte ich mich ihm, weglaufen wollte ich nicht. Dieser Mann sollte nicht gleich wissen, dass ich Angst hatte. Als ich näher kam, sah ich in seiner Hand eine große Tafel Schokolade, die er mir lächelnd entgegenhielt. In der anderen Hand hielt er eine Zigarettenspitze, in der noch eine Zigarette glühte. Da hörte ich plötzlich doch wieder meinen Magen knurren und hoffte, dass der Fremde es nicht hörte. Die Schokolade wäre jetzt genau das Richtige für mich, dachte ich und sah bei diesem Gedanken in ein lächelndes Männergesicht. »Nun nimm schon ein Stück«, sagte er. Als er mein zweifelndes Gesicht bemerkte, fügte er schnell hinzu: »Sie ist nicht vergiftet. Ich bekam sie von einer guten Freundin geschenkt, die will mich auf keinen Fall vergiften.« Ich wusste, man soll von Fremden nichts annehmen, aber ich tat es doch und bedankte mich höflich. Schon wollte ich weitergehen, da kam eine Frage, mit der ich nicht gerechnet hatte: »Wo willst du denn mitten in der Nacht hin?« Er fragte, als wäre ich ein kleines Kind, das nicht weiß, wo es hinwill, aber schon hörte ich ihn sagen: »Oder bist du von zu Hause weggelaufen?« Vor lauter Schreck antwortete ich nicht. »Darf ich dich denn ein Stückchen begleiten auf deinem Weg?«, fragte er weiter. Ich nickte mit dem Kopf, doch wäre ich viel lieber allein gegangen und hätte von der Schokolade gern noch ein bisschen abgebissen. Nun konnte ich mir leider die Schaufenster nur noch vorsichtig ansehen, denn wie hätte es ausgesehen, wenn ich mir immer den Kopf an den Schaufenstern stieß. Dann hätte er auch noch recht gehabt mit dem Gedanken, dass ich ein kleines Mädchen sei.
Mit verstohlenen Blicken schaute ich mir nicht nur die Schaufenster an, sondern auch meinen Begleiter. Ich stellte dabei fest, dass er vom Alter her mein Vater sein könnte, aber trotzdem sehr gut aussah. Ich hörte noch, wie er sagte: »Ich heiße Erich«, sofort kam auch die Frage nach meinem Namen. Kurz ging es mir durch den Kopf, ob man Fremden seinen Namen sagen darf, da kam es schon aus mir heraus: »Monika!« Ich erschrak im selben Moment. Es musste seine ruhige Stimme gewesen sein, die bewirkte, dass ich alle guten Vorsätze vergaß. Bevor er noch etwas sagen konnte, drehte ich mich abrupt zu ihm. »Jetzt muss ich aber gehen«, sagte ich schnell. »Sagst du mir jetzt, wo du hinwillst?«, fragte er hartnäckig. »Ach, das ist eine lange Geschichte«, antwortete ich. »Ich habe viel Zeit«, sagte er schnell, nahm meine Hand und führte mich auf die andere Straßenseite. Warum ließ ich es geschehen, hatte ich so viel Vertrauen zu ihm? Er war doch ein Fremder. Ich fühlte, wie meine Hand in der seinen zitterte. »Hab keine Angst, wir werden uns da drüben auf eine Bank setzen, dann kannst du mir alles erzählen.« Wie kam er nur darauf, dass ich das tun würde? Aber brav trottete ich neben ihm her. Die Bank stand genau unter einer großen Straßenlaterne. »Setz dich aber niemals allein hier auf eine Bank«, sagte Erich, »dann holt dich die Polizei hier weg. Denn hier gehen oft nachts Frauen spazieren, die auf Männer warten.« Ich verstand nicht, was er damit sagen wollte, aber ich hatte Angst bekommen. Erich schien meine Furcht zu spüren, nahm wieder meine Hand und sagte: »Hab doch keine Angst, ich bin bei dir.« Wir unterhielten uns über viele Dinge, doch sagte ich nicht, dass ich von zu Hause weggelaufen war. Auch sonst erzählte ich nicht viel von mir. Ich tat, als wollte ich von ihm nur die Auskunft, wo das Amt für Arbeit sei. Es war nun schon langsam hell geworden und Erich sagte: »Ja, ich weiß, wo das Amt ist.« Er stellte zum Glück auch keine weiteren Fragen. »Komm, lass uns zur Straßenbahn gehen, sonst musst du zu lange alleine stehen und auf die nächste Bahn warten.«
Nun ging alles sehr schnell. Ich sah die Bahn schon kommen. Wie ein Blitz fuhr es durch meinen Kopf: Werde ich das alles schaffen, mit der Bahn zu fahren, zum Amt zu gehen? Ich kam mir verloren vor. Erich sagte mir noch schnell den Straßennamen des Amtes, schon war die Bahn da, wir hatten kaum Zeit, uns noch zu verabschieden.
Ich war so aufgeregt, denn es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Straßenbahn fuhr. Nun hatte ich ein bisschen Zeit, um über das Geschehene nachzudenken. Ich suchte nach einem Taschentuch in meiner Jackentasche. Doch was war das, was ich da in meiner Tasche fühlte? Es musste ein Zettel oder etwas Ähnliches sein. Ich schob es in meiner Hand hin und her, bis ich es dann endlich herausnahm. Es war eine Visitenkarte mit Adresse und Telefonnummer von Erich.
Schnell steckte ich sie wieder in meine Tasche, da hörte ich auch den Namen der Straße, an der ich aussteigen musste. Schon von weitem sah ich das Gebäude, das mir Erich beschrieben hatte.
Die ersten Arbeitsstellen
Tatsächlich, ich bekam eine Anstellung bei einer Zahnarztfamilie als Haushaltshilfe. Bei meiner Ausbildung konnte mir der Mann vom Amt keine andere Arbeit geben. Da fühlte ich zum ersten Mal, wie es ist, wenn man nichts gelernt hat. Ich hatte keine Schulausbildung, denn bei Mama durfte ich nur meine Geschwister versorgen, in ihrem Restaurant Tag und Nacht arbeiten und mich um den Haushalt kümmern. Ich war sehr traurig, als ich das Amt verließ, und bedauerte es sehr, dass ich nichts hatte lernen können. Denn die Kriegsjahre hatte ich in einem russischen Kinderlager verbracht. Als ich wieder nach Deutschland kam und bei Pflegeeltern lebte, war ich so krank, dass ich nur selten eine Schule besuchen und somit auch keinen Beruf erlernen konnte. Traurig kehrte ich zur Straßenbahn zurück, schaute mich nach allen Seiten um, damit die Menschen denen ich begegnete meine Tränen nicht sahen.
Doch nun fuhr ich mit der Adresse der Zahnarztfamilie zum Hauptbahnhof, um meinen kleinen Koffer aus dem Schließfach zu holen. Das Haus der Familie wo ich nun arbeiten sollte fand ich indem ich die Menschen die mir begegneten nach der Straße fragte. Das Arbeiten war ich ja gewohnt, aber was ich hier antraf, gefiel mir nicht besonders. Die Hausherrin ließ sich mit »Frau Doktor« ansprechen, weil ihr Mann Zahnarzt war. Na ja, dachte ich, wenn sie es so möchte, werde ich sie auch so ansprechen. Mir blieb nichts anderes übrig, als brav und dankbar zu sein, denn ich hatte eine Arbeit gefunden. Sie bestand darin, morgens um fünf Uhr aufzustehen, vom Vorabend alles aufzuräumen, das Esszimmer zu putzen, die Küche sauber zu machen und für alle aus der Familie das Frühstück zubereiten. Es gab auch noch zwei große Söhne die morgens pünktlich aus dem Haus mussten. Jeden Morgen nahmen sie Brote mit, die ich Ihnen auch machte. Das Frühstück, das Mittag und auch das Abendessen wurden immer im Esszimmer eingenommen, nur ich musste alleine in der Küche essen.
So ist es wohl bei feinen Leuten, dachte ich. Es machte mir nichts aus, alleine zu essen, da schaute mir jedenfalls niemand zu. Ich hatte nun für eine Weile Ruhe. Aber kaum hatten alle gegessen, hörte ich schon die Stimme der Frau Doktor: »Monika, Sie können alles wegräumen!« Das hörte ich von nun an jeden Tag und konnte fast die Uhr danach stellen. Der Herr Doktor war ein ruhiger, netter Mann, er hatte immer einen freundlichen Gruß parat. Doch bald stellte ich fest, wer hier das Sagen hatte. Es war natürlich die kleine, freche Frau Doktor, sie beherrschte die ganze Familie mit ihrem Kommandoton. Und mich konnte sie nun nach ihren Wünschen herumkommandieren, ich musste tun, was sie sagte, sonst würde sie mich hinauswerfen. Aber was sollte ich dann tun? Sie ließ mir ein kleines Zimmer in ihrem Haus. Es war so groß wie eine Besenkammer, mit nicht mehr als einem Bett und einem kleinen Schrank. Dass in den Schrank nur wenig hineinpasste, störte mich nicht, denn in meinem kleinen Koffer war nicht viel, ich hätte sogar noch Platz gehabt. Aber dass das Fenster nur eine Dachluke war, stimmte mich immer traurig: Um nun mit meinem Papa im Himmel zu sprechen, musste ich auf das Bett steigen, welches sehr wackelig war. Dabei hatte ich das Gefühl, eines Tages würde ich vom Bett herunterfallen.
Um fünf Uhr morgens war die Nacht für mich zu Ende und meine Aufgaben fingen an. Einen Schrubber zum Wischen gab es für mich nicht, ich musste alles auf meinen Knien putzen, auch das schien bei feinen Leuten so zu sein. Ich werde mich daran gewöhnen müssen, sagte ich mir. Auf Knien kroch ich durch die ganze erste Etage.
Wenn es manchmal abends spät geworden war, weil meine Herrschaft noch Besuch hatte und ich helfen musste, war ich am nächsten Morgen noch sehr müde. Doch mein Wecker war erbarmungslos pünktlich, er machte Krach. Damit ich mit dem Klingeln meines Weckers nicht alle aufweckte, sprang ich gleich aus dem Bett, um ihn abzustellen.
Das Wohnzimmer putzte ich immer zuletzt. Wenn ich nämlich meine Müdigkeit nicht mehr beherrschen konnte, setzte ich mich hinter einen der großen Sessel und schlief ein. Irgendwann kippte ich dann um, was mich wieder aufweckte, und ich ging erneut an meine Arbeit. Beim Mittagessen auch beim Abendessen war es immer dasselbe: Ich aß alleine in der Küche, die Herrschaft im Wohnzimmer. Den ganzen Tag war ich beschäftigt, musste die Herrschaften bedienen.
Es war ein älteres Haus, in dem ich nun lebte, hier gab es auch einen Ofen, den man mit Briketts heizen musste damit das Feuer in der Nacht nicht ausging. Die Briketts musste ich immer aus dem Keller holen. Mit aller Kraft kämpfte ich gegen meine Angst vor Kellern an, hatte mich doch mein Pflegevater oft in einen dunklen Keller zwischen Kohlen, Kartoffeln, Spinnen und Mäusen eingeschlossen und mich darin oft vergessen. Nur wenn ich abends beim Abendessen nicht da war, fiel es ihm wieder ein.
Eines Tages ergab es sich, dass einer der Söhne mir helfen wollte die Kohlen nach oben zu bringen. Plötzlich ertönte eine laute Stimme auf der Treppe, es war Frau Doktor: »Stell sofort die Kohlen wieder ab, Hans, das ist die Aufgabe vom Personal!« Sofort stellte ihr Sohn die Briketts auf die Stufe, auf der wir uns gerade befanden. Die Söhne durften mir nicht dabei helfen, sie durften noch nicht einmal mit mir sprechen, außer wenn sie einen Wunsch hatten. Na ja, dachte ich, das ist wohl bei feinen Leuten so, und trug brav meine schweren Briketts wie immer nach oben.
Ich weinte viel in dieser Zeit wenn ich alleine in meinem kleinen Zimmer war. Nachts sprach ich wieder mit meinem Papa, der seinen Stern für mich hell erleuchten ließ, ich bat ihn mir doch zu helfen. Oft dachte ich darüber nach dass ich nichts gelernt hatte. Das machte mich jedes Mal traurig. Von wem hätte ich auch etwas lernen können? Aber ich wusste, dass es etwas geben musste, was ich noch lernen könnte, ich war doch noch so jung. Es vergingen Tage und Nächte, ich wusste nicht wie lange ich hier noch Magd bleiben sollte.
Dann kam der Tag, an dem sich alles änderte. Ich war wieder einmal in meine Gedanken versunken, das war ich sehr oft, denn mit mir sprach keiner ein privates Wort auch Fragen wurden nicht gestellt. Aber plötzlich wurde ich durch laute Stimmen aus meinen Gedanken gerissen. »Monika! Komm mal herunter«, hörte ich Frau Doktor rufen, »hier ist die Polizei!« Sehr langsam und ängstlich ging ich die lange Treppe nach unten, stellte mich neben Frau Doktor die schroff zu mir sagte: »Hole deine Sachen deine Eltern lassen dich von der Polizei suchen, du sollst sofort nach Hause kommen.«
Mit 50 Mark Lohn und meinem kleinen Koffer begab ich mich wieder einmal zum Bahnhof und fuhr zurück nach Hause. Es blieb mir nichts anderes übrig. Mit großer Freude wurde ich nicht empfangen, aber ich wurde wie immer gebraucht.
Im Restaurant meiner Eltern gab es viel zu tun, und meine kleinen Geschwister brauchten mich sehr. Sie hatten mich sehr lieb, hielten mich fest und fragten: »Du gehst doch nicht wieder weg und bleibst jetzt immer bei uns?« Als ich dann aber auf Papa traf, strafte er mich nicht nur mit Blicken, sondern auch mit Worten. Plötzlich, ich konnte es nicht glauben, hörte ich Folgendes von ihm: »Du gehörst mir, du darfst mich nie wieder verlassen.« Dabei drückte er meine Hand sehr fest, sodass ich nicht wagte ihm zu widersprechen. Mamas Begrüßung war nicht wirklich eine Begrüßung, stattdessen teilte sie mir sofort Arbeiten zu. Ich dachte: Na ja, es ist immer noch besser hier als bei Frau Doktor, hier bin ich zu Hause. Aber war ich denn wirklich zu Hause?