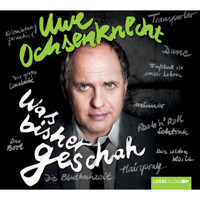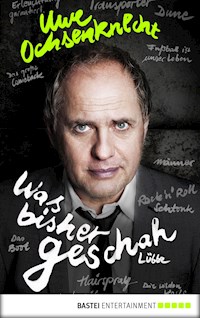
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Uwe Ochsenknecht ist ein Phänomen. Seit über vierzig Jahren ist er auf der Bühne, im Fernsehen und auf der Leinwand präsent. Die Menschen mögen ihn, weil er so ist wie sie: bodenständig, geradeheraus und ein wenig eigensinnig. In seiner Autobiographie schildert der beliebte Schauspieler und Sänger erstmals ausführlich sein Leben. Sehr persönlich und offen erzählt er von einer kargen Kindheit und mehrfachen Schulabbrüchen, von ersten Bühnenauftritten und dem ganz großen Durchbruch, von seiner Liebe zur Musik, dem harten Showbusiness und seiner ungewöhnlichen Familie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
INHALT
TitelImpressumWidmungZitatPrologTeil 1. In the BeginningKaba & Nutella – Erste KindheitserinnerungenViel zu viel und viel zu wenig – Meine ElternBier & Schläge – »Papa was a drunken Stone«Adam & Eva – Nicht immer das ParadiesLöwenzahn im Asphalt – KuckuckskindMusik – Meine erste grosse LiebeDer Bauklotz-Trick – Wunderbare MädchenNeue Wohnung – Mannheim-VogelstangWahlfamilie – Die Welt des TheatersKörperspiele – Nudel-Contest und Schlafsack-ÄngsteTeil 2. Coming of AgeRocker & An 1 – Ferien von den ElternMutter München und die Pension Olive – Mein erster FilmTschüss Schule! – Aufbruch ins LebenTschüss Brille! – Sonya, die erste Beziehung»Ich fachte, mir platzt das Hirn« – Das erste MalLieben und Lernen – Auf der Schauspielschule»Ich freu mich auf Morgen früh!« – Ein ganz normales LebenUntauglich – Der Anti-Einberufungs-EiweisstrickKrisenfest – Sonyas AffäreDie hohe Kunst des Schauspiels – Was einen guten Darsteller ausmachtTeil 3. Wild TimesNach der Schauspielschule – Erste Film- und TheaterrollenDas Ding – London, Vilma und eine abenteuerliche FahrtIbiza 79 – Sonne, Strand und Partys mit Richy Müller Kiffen, Koks, Konversation – In AmsterdamDas Boot – Ein WelterfolgGesiebte Luft – Wegen Koks im KnastDie verhasste Leo-Unterhose – Männer»Du musst dich doof stellen« – SchauspielkunstRosana & Rocco – Familie zum ErstenButterbrot im Teamtheater – Back to the RootsHollywood? – »Nee, besser doch nicht!«Teil 4. Films & FamilyNatascha – Eine Frau fürs Leben?Wilson und Jimi – Warum sie nicht Klaus und Detlef heissen»Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an« – In den ChartsSchtonk! Oder Stunk? – Die Oscar-FarceBis dass der Tod uns scheidet – Unsere Hochzeit 40 Jahre – Mehr als 120 FilmeVersöhnung – Mit Cheyenne als SahnehäubchenFilme fürs Leben – Leben für den FilmMeine wilden Kerle – Ein gefährlicher VersuchMit Wilson und Jimi auf den Spuren von Hendrix – Marokko Revisited»Schlaf gut, Inge« – Der Tod meiner MutterMinus Achtzehn – Trennung von NataschaKids – Das Projekt »Familie«Teil 5. Taday & TomorrowKiki – nicht gesucht und doch gefundenMagic Moments – Über Beziehungen und LiebeDie verkorkste Crème Brûlée – Wie Tim Mälzer und Ich Freunde wurdenÜber den Tellerrand schauen – Gedanken und Einsichten»Ich hab noch dreissig Sommer!« – AussichtenAbspannBildtafelteilUwe Ochsenknecht mit Claudia Thesenfitz
WAS BISHERGESCHAH
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Ramona Jäger
Textredaktion: Dr. Matthias Auer, Bodman-Ludwigshafen
Copyright © Fotos Bildtafelteil: API; Bastei Lübbe AG; ddp images; Jim Rakete; ullsteinbild. Alle übrigen Bilder entstammen dem Privatarchiv des Autors.
Umschlaggestaltung: Pauline Schimmelpenninck Büro für Gestaltung, Berlin
Umschlagmotiv: © KRAUS & PERINO, München
E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-8387-4512-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Kiki, Rocco, Wilson, Jimi und Cheyenne
»Wenn du glücklich sein willst – dann sei es!«
Tolstoi
PROLOG
Nationaltheater Mannheim, November 1970, 15.20 Uhr
»Ach deswegen hast du so einen doofen Anzug an«, sage ich zu Emil, der eben mit dem Zug aus seiner Heimatstadt im großen Berlin eingetroffen ist.
»Nimm das sofort zurück! Sonst kleb ich dir eine, dass du scheintot hinfällst«, antwortet der und funkelt mich kampfeslustig an.
Ich bin vierzehn und spiele meine erste große Theaterrolle – die des Gustav in der Bühnenfassung von Erich Kästners berühmtem Kinderroman Emil und die Detektive. Tagelang habe ich meinen Text geübt, ihn mit meinen Kumpeln durchgespielt und versucht, mich in den Berliner Jungen einzufühlen. Was ist das für ein Kerl, der mit einer Hupe durch die Hauptstadt läuft und durch sein simples Getröte in Sekundenschnelle eine ganze Kinder-Gang versammeln kann? Er trötet, und sie kommen aus allen Ecken. Kenne ich Jungs, die so sind wie er? Das Kostüm – eine zu kurze Hose mit Hosenträgern und ein zerschlissenes Hemd – sowie meine zerwühlten Haare helfen mir, mich in die Situation des Berliner Straßenjungen hineinzudenken.
Im Stück haben Emil und ich uns gerade kennengelernt, nun sitzen wir nebeneinander auf einer Bank.
»Ich beobachte einen Dieb«, sagt Emil geheimnisvoll zu mir.
»Was? Wen hat er denn beklaut?«
»Mich!«, erwidert er.
Ich gucke ihn verblüfft an und spiele an der Hupe, die aus meiner Hosentasche hängt. »Hundertvierzig Mark hat er mir gestohlen, und jetzt sitzt er da drüben im Café und lässt sich’s gutgehen!«
»Das ist ja wie im Kino«, rufe ich begeistert und starre wie gebannt auf die andere Seite der Bühne in ein Café, das es gar nicht gibt.
Der alte Bühnenscheinwerfer oben an der Decke strahlt mich an, und mit jeder Minute, die ich spiele, versetze ich mich mehr in die Figur hinein. Die Sätze kommen mir ohne Stocken über die Lippen. Ich bin jetzt Gustav, der »Junge mit der Hupe«, und die Tröte gehört zu mir wie ein drittes Bein.
Im Zuschauerraum ist es dunkel, ich sehe nur die Gesichter in den ersten Reihen, und die Leute schauen mich gebannt an, wenn ich spreche. Ich spüre ihre Aufmerksamkeit und ihre Blicke, die mir folgen. Das fühlt sich phantastisch an. Ich höre meine eigene Stimme, während über hundert Menschen im Saal ganz still sind und mir zuhören. Mein Herz klopft mir bis zum Hals vor Freude. Es ist wie ein Rausch, wie Musikhören, wie Tanzen, wie Biertrinken – wie küssen! Und mir geht es nicht alleine so: Auch den anderen merke ich den Spaß beim Spielen an. Wir machen hier etwas Großes – und schaukeln uns gegenseitig hoch. Eine euphorisierende Dynamik entsteht zwischen uns. So etwas Tolles habe ich noch nie erlebt. Das ist spannender als jeder Film, den ich bisher gesehen habe, das ist intensiver als jede Mutprobe, die ich bisher bestehen musste.
An den dramatischen Stellen wird es ganz still im Saal, und bei überraschenden Wendungen ruft ab und an ein Kind erschrocken »Oh« im Zuschauerraum. Wir scheinen also überzeugend zu spielen. Plötzlich – viel zu schnell – ist das Stück dann zu Ende.
Der Vorhang fällt. Lauter Applaus brandet auf. Bravo-Rufe ertönen. Ein völlig neues Glücksgefühl durchströmt mich. Der Beifall prasselt wie eine warme Dusche auf mich nieder. Wir laufen einzeln vor den Vorhang und verbeugen uns vor dem Publikum. Bei jedem von uns wird das anhaltende Klatschen wieder lauter. Ich fühle mich phantastisch. Zum ersten Mal werde ich wirklich gesehen, anerkannt, geliebt …
Ist das hier meine Zukunft?
KABA & NUTELLA – ERSTE KINDHEITSERINNERUNGEN
Ich mache die Augen auf. Alles ist verschwommen, wie von Weichzeichner vernebelt. Vor dem Fenster schweben Schneeflocken. Leise, gedämpfte Welt – ich krieche tiefer unter meine warme Decke. Aus der Küche dringen Frühstücksgeräusche an mein Ohr: Geschirr klappert, jemand schaufelt Kohlen, Schranktüren werden geöffnet und geschlossen. Vor einer Stunde schon hat meine Mutter den riesigen Kohlenherd angefeuert, damit wir es zum Frühstück schön warm haben. Eine Heizung, die man einfach aufdreht, oder fließend warmes Wasser gibt es nicht. Die Küche ist morgens der einzig warme Raum unserer winzigen 42-Quadratmeter-Wohnung.
Erst wenn mein Vater nachmittags um halb vier von der Arbeit kommt, wird der kleine Eisenofen im Wohnzimmer aktiviert, der nach und nach dann die ganze Wohnung in eine wohlige Wärme hüllt. Nur das Schlafzimmer wird nie beheizt, weil es auch noch als großer Kühlschrank dient, in dem die verderblichen Lebensmittel lagern.
»Uwe! Aufstehen!« Nachdem meine Mutter mich zum dritten Mal aus der Küche ruft, schäle ich mich aus meinem warmen Bett, tripple in meinem hellblauen Nachthemd mit hochgezogenen Schultern barfuß über den kalten Linoleumboden und kauere mich mit meiner Decke auf die rote Eckbank aus Plastikleder. Das Feuer knistert, es riecht nach Kaffee und frischem Brot, und meine Mutter stellt mir wie jeden Morgen einen dampfenden Becher heißen Kaba vor die Nase. Dazu gibt es eine dickbeschmierte Nutella-Schnitte.
In diesen Momenten kann ich mir keinen schöneren Ort auf der Welt vorstellen als unsere Küche. Vorausgesetzt der Kaba hat keine »Haut« …
Mein Dasein auf diesem Planeten begann bescheiden: Sowohl meine Schwester Beate als auch ich wurden im Haus von Freunden geboren, in dem meine Eltern einige Zeit wohnten. Als meine Mutter 1951 mit meiner Schwester Beate schwanger war und langsam klar wurde, dass die sowjetische Besatzungszone den Übergang in die BRD einschränken würde, hatten sich meine Eltern aus Saalfeld in Thüringen bei Nacht und Nebel aus dem Staub gemacht – richtig dramatisch soll das gewesen sein, verfolgt von Suchscheinwerfern krabbelten sie unter Stacheldraht in den Westen. Es gelang ihnen die Flucht, und sie kamen dann bei einem Ehepaar in der Jahnstraße im hessischen Biblis unter, das sie freundlicherweise aufnahm und in deren Haus wir Kinder das Licht der Welt erblickten.
Sowohl Beates als auch meine Hausgeburt ging unkompliziert über die Bühne, ohne Arzt, nur mit Hilfe von warmem Wasser und einer Hebamme. Und dank der Willenskraft und Vitalität meiner Mutter selbstverständlich. Ich kam am 7. Januar 1956 zur Welt, einem kalten Wintermorgen, um 4.15 Uhr. Sternzeichen Steinbock, Aszendent Skorpion.
Mein Vater hielt seine kleine Schar zunächst mit einer Arbeit als Tagelöhner auf Bauernhöfen über Wasser. Als er bei Mercedes-Benz eine Stelle als Feinmechaniker angeboten bekam, griff er sofort zu, und wir zogen nach Mannheim. Dort waren wir nicht schlecht gelandet: Die geografische Lage ist klimatisch sehr begünstigt – und die Landschaft herrlich. Heidelberg, für viele die schönste Stadt Deutschlands, liegt gleich nebenan, und die Ufer von Rhein und Neckar sind ja nicht weniger berühmt. Die südliche Lage sorgt außerdem für gutes Wetter: heiße Sommer, weiße Winter und wenig Regen.
Das Beste an der neuen Umgebung waren aber, wie sich später für mich herausstellen sollte, die umliegenden Kasernen der US-Army beziehungsweise der Lifestyle der amerikanischen GIs. Die Amerikaner hatten eine extrem lässige Art, geile Autos, Kaugummis, und vor allem: Die Schwarzen hörten die coolste Musik, konnten fantastisch tanzen und brachten Leben und gute Laune in die ansonsten so unendlich miefigen Nachkriegs- und Wirtschaftswunderjahre.
Waldhof, wohin es uns verschlagen hatte, ist ein Vorstadtbezirk von Mannheim im Rhein-Neckar-Dreieck und als traditionelles Arbeiterviertel bekannt. Im Süden Waldhofs liegt das Mercedes-Benz-Werk der Daimler AG, in dem die Mannheimer Arbeit fanden – und einer davon war damals auch mein Vater.
Das Leben auf dem Waldhof, wie man sagt, war recht dörflich geprägt und beschaulich: vierstöckige, gelb oder grau verputzte Wohnblocks, dazwischen jede Menge Bäume, Spielplätze, ein »Konsum«, ein Bäcker, die Gaststätte »Zum deutschen Michel«, der Hühnerzuchtverein »Die Goggelrobber« und ein paar Kneipen mit depressiv-düsterer Eichen-Einrichtung und Kunstblumen vor den nikotingelben Gardinen. Die Sehnsucht nach Geborgenheit und heiler Welt manifestierte sich in Spießertum, Persil und den ersten Schwarz-Weiß-Fernsehapparaten. Jeder kannte jeden – und beobachtete jeden.
Sonntags wurde Waldhof zur Geisterstadt, und schon um elf roch es überall nach Mittagessen: Kohl, Frikadellen, Kartoffeln. Als Kind habe ich diese Sonntage gehasst. Ich wollte spielen, wollte Action, aber draußen war es so leer und öde, als wäre gerade die Pest ausgebrochen. Das Schlimmste jedoch war mein unbequemes, sperriges Outfit: Sonntags zog man gute Sachen an – das war ein unverrückbares »Anständige Leute«-Gesetz. Die Sonntagskleidung, in die mich meine Mutter schon morgens zwängte, bestand aus einer Hose mit Schlag und Bügelfalten, den »guten« Schuhen und einem Nylon-Hemd. Die Klamotten waren grauenhaft beengend: Alles klemmte, und ich schwitzte darin wie in der Sauna. Auf diese Weise kleidungstechnisch gegeißelt, traf ich mich trotzdem mit meinen Freunden auf dem Spielplatz, was nicht besonders viel Spaß brachte, weil keiner von uns seine Sachen schmutzig machen durfte.
Unsere erste Wohnung war spartanisch eingerichtet. Es gab weder eine Badewanne noch eine Dusche, kein warmes Wasser und keine Heizung. Samstags war Waschtag, dafür wurden auf dem Kohlenherd in der Küche mehrere Kannen Wasser erhitzt und in eine große Zinkwanne gegossen. In der wurden erst meine Schwester und danach ich mit einem Frotteelappen abgeschrubbt – im selben Wasser!
Die Wohnung umfasste zwei Räume – Wohn- und Schlafzimmer –, die ineinander übergingen, plus eine Küche, einen winzigen Flur und eine ebenso winzige Toilette. Im Wohnzimmer standen eine Klappcouch und ein Schrankklappbett, die abends für meine Schwester und mich zurechtgemacht wurden. Mich legte man zum Schlafen allerdings erst mal ins Schlafzimmer meiner Eltern, weil die »Erwachsenen« (und dazu zählte zu meinem großen Ärger auch meine fünf Jahre ältere Schwester) im Wohnzimmer noch Fernsehen guckten, spielten oder redeten. Wenn meine Eltern dann ins Bett gingen, trugen sie mich rüber ins Wohnzimmer. Im Winter war der Raum so kalt, dass sich am Fenster Eisblumen bildeten und ich meine kleinen Füße an die Bettflasche aus Zink drückte, die die einzige Wärmequelle darstellte.
Geschlafen habe ich in meinem »Du musst früher ins Bett«-Exil natürlich selten sofort. Es war viel zu spannend herauszufinden, was die Erwachsenen machten und redeten. Fernsehen war damals ja sowieso noch ein Weltwunder. Meine Eltern konnten sich erst ziemlich spät ein eigenes Gerät leisten und hatten sich bis dahin von den Nachbarn ab und an zu einem Fernsehabend einladen lassen. Erst seit kurzem besaßen wir nun selbst einen mit Schwarz-Weiß-Bildschirm – und wenn ich es geschickt anstellte, konnte ich, mich auf der Frisiertoilette meiner Mutter abstützend, durch den Türspalt vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer auf den Bildschirm gucken.
Die Kunst bestand darin, die Tür so vorsichtig, leise und zudem nur so wenig aufzumachen, dass es keiner mitbekam. Und sie rechtzeitig wieder zu schließen, sobald mein Vater sagte: »So, der Tag ist vorbei.« Auf diese Weise schaffte ich es tatsächlich oft, TV-Sendungen mit anzusehen. Der Preis dafür waren jedoch nicht nur tiefe Augenringe, sondern auch dauerrote Augen, weil es durch den Türspalt immer so zog.
Unsere Wohnung war zwar klein, aber ich fand sie immer total gemütlich: Nachts, im Bett meiner Eltern, lauschte ich den Zügen im naheliegenden Bahnhof und habe mir vorgestellt, wohin die wohl alle fuhren. In die große, weite Welt? Die Kirchturmglocke wiederum besaß für mich damals schon immer etwas Unheimliches und Bedrohliches. Sie erinnerte mich in der Stille der Nacht daran, wie spät es schon geworden war. Im Sommer, wenn es in der Wohnung sehr heiß wurde und deshalb das Fenster zum Schlafen aufgelassen werden durfte, konnte ich die blühenden Linden und Kastanien riechen, in den Sternenhimmel schauen und mich ins All träumen.
Unser Waldhof war ja eigentlich nur ein größeres Dorf, aber trotzdem gab es viel zu entdecken: Meine Kumpel und ich stromerten herum und suchten überall Abenteuer. Das gigantisch große Fabrikgelände von Zellstoff Waldhof in der Altrheinstraße zum Beispiel bot jede Menge Spannendes. Wir kletterten über den brüchigen Fabrikzaun und erforschten die verrosteten Container, deren Türen sich leicht aufstemmen ließen. In einem fanden wir einmal eine Riesenladung tischtennisballgroßer weißer Kugeln. Sie waren allerdings um einiges schwerer als die kleinen Sportgeräte, und wenn man sie in die Hand nahm, hinterließen sie einen schleimigen, pulvrigen Film, den man erst durch mühseliges Schrubben mit Kernseife wieder loswurde. Aus welchem eventuell hochgradig giftigen Material sie waren, hat uns damals wenig interessiert.
Erstaunlicherweise wurde mir erst vierzig Jahre später klar, dass die »Zewa Wisch & Weg«-Haushaltstücher, die jeder kennt, von eben dieser Fabrik produziert wurden.
Auf einem anderen Teil des Geländes gab es einen Sandplatz mit zwei kleinen Toren. Ich habe mich oft gefragt, wer die da wohl hingestellt hatte – und vor allem für wen, mitten auf einem verwilderten Industriegelände. Ihr Zweck war es sicher nicht, den Mitarbeitern der Zellstofffabrik einen Mittagspausen-Kick zu ermöglichen … Das Rätsel blieb für immer ungelöst, aber dafür trugen wir dort mit den älteren Jungs leidenschaftliche Fußball-Matches aus, die so spannend waren, dass ich oft stinksauer wurde, wenn ich mitten in der heißesten Phase des Spiels heimmusste, weil es schon fast sechs Uhr war, also Abendbrotzeit.
Und dann gab es da noch einen etwa fünf Meter hohen Berg aus Matratzen, von denen allerdings nur noch das Gerippe, nämlich die von der Witterung verrosteten Matratzenfedern, übrig war. Aus irgendeinem Grund hieß das Gebilde bei uns »die Kina«. In der Abendsonne erinnerte »die Kina« manchmal an das sakrale Monument einer Kultstätte aus längst vergangenen Zeiten, aber auch Joseph Beuys hätte sich an ihrem Anblick bestimmt erfreut.
»Was mache man heid?«, hieß es oft, wenn wir uns trafen.
»Gehma uff die Kina?«
»Eijo, mache ma!«
»Auf die Kina gehen« bedeutete, wettkampfmäßig auf den fünf Meter hohen Turm zu klettern (wer ist als Erster oben?), dort herumzuhüpfen wie auf einem Trampolin oder sich an der phänomenalen Aussicht zu ergötzen. Die Jungs, die schon oben waren, lachten sich schlapp, wenn die anderen beim Hoch- oder Runterklettern abstürzten oder sich die Hosen zerrissen.
Wenn wir einen ganz mutigen Tag hatten, wagten wir es, den endlos langen Weg an der Zellstofffabrik vorbei zum Rheinufer zu gehen. Der Altrhein ist ein Seitenarm des Hauptstroms, und eigentlich durften wir da nicht hin. Der Fußmarsch dauerte ewig, aber es war toll, am Ufer Steine ins Wasser zu werfen und die Schiffe zu beobachten. Manchmal haben wir auch angeschwemmte tote Fische gefunden (die BASF war ja nicht weit entfernt), die wir dann in Einzelteile zerlegten und untersuchten. Die waren bestimmt genauso ungiftig wie die Zewa-Tischtennisbälle …
Mittwochs hatte ich immer Training im Fußballverein SV Waldhof, dem Jugendclub des legendären Otto »Holz« Siffling. Der Waldhofer Fußballgott hatte den kleinen Verein in den Dreißigerjahren berühmt gemacht, weil er sich bis in die deutsche Nationalmannschaft hochgespielt und mit ihr bei der Weltmeisterschaft 1934 die Bronzemedaille gewonnen hatte. Zu seinem Gedenken wurde die Kornstraße, in der wir wohnten, im Juni 1977 in Otto-Siffling-Straße umbenannt.
Da ein neues Fußballoutfit für meine Eltern unerschwinglich war, schenkten mir Freunde meiner Eltern die abgelegten Sachen ihres Sohnes. Alles war komplett outdated: Das Trikot entpuppte sich als zwei Nummern zu groß und musste an der Brust geschnürt werden, die Hose war viel zu weit und reichte mir bis über die Knie, und die Schuhe waren abgelaufen. Ich kassierte von meinen Mannschaftskumpeln manchen blöden Spruch für meine altmodischen Trainings-Klamotten, aber letztlich gewöhnten sich alle (einschließlich mir) an meinen Look. Außerdem war mein Können als Stürmer und später als Torwart nicht schlecht: Ich hatte ein ganz passables Ballgefühl, konnte gut dribbeln und war sprintstark.
Meine Fähigkeiten auf dem Platz bewirkten, dass mir während des Spiels der Respekt wieder gezollt wurde, den mich meine Sportklamotten zuvor gekostet hatten.
Ich selbst allerdings fand, dass ich noch weit von den Fähigkeiten eines Siffling entfernt war, und auch meine Anfahrt zum Verein erschien mir noch optimierungsbedürftig: Meist fuhr ich mit dem dunkelblauen Drahtesel meiner Schwester vor, einem Mädchenfahrrad ohne Stange und deshalb imagemäßig eine Katastrophe. Ich schämte mich, aber für ein eigenes Fahrrad hatten wir kein Geld. Später immerhin konnte ich den Auftritt etwas verbessern: Da kam ich mit meinem eigenen grasgrünen Roller.
Die Väter der anderen Jungs aus meiner Mannschaft standen öfter am Spielfeldrand und feuerten ihre Söhne an, freuten oder ärgerten sich mit ihnen, fieberten mit, diskutierten die Taktik und nahmen ihren Nachwuchs nach dem Spiel in den Arm. Mein Vater dagegen war nur selten da. Ich wünschte mir sehnlichst, dass er öfter die Spiele an den Samstagen besuchen und sich für mich und mein eventuelles Talent interessieren würde. Irgendwann aber gab ich die Hoffnung auf, zwischen den wenigen Zuschauern meinen Vater zu finden, und konzentrierte mich stattdessen ganz aufs Spiel.
Mein Kinderleben war in materieller Hinsicht also bescheiden, aber dafür geregelt. Und diese Routine vermittelte mir ein Gefühl der Geborgenheit: Der Tag begann mit dem Frühstück in der behaglichen Küche, danach ging es in die Schule. Wenn ich nach Hause kam, stand das dampfende Essen bereits auf dem Tisch. Nachmittags spielte ich draußen mit den Freunden – und um sechs gab’s Abendbrot. Danach höchstens noch eine Stunde raus, und dann ab ins Bett.
VIEL ZU VIEL UND VIEL ZU WENIG – MEINE ELTERN
Der Fehler war vielleicht, dass meine Eltern Sex hatten. Obwohl ich später nie irgendeine körperliche Anziehungskraft zwischen ihnen spürte und selten eine zärtliche Geste sah, muss es eine Zeit gegeben haben, in der sie miteinander schliefen. Damals gab es die Pille noch nicht, Kondome waren teuer beziehungsweise schwer zu beschaffen – und Kinder deshalb eine kaum vermeidbare Nebenwirkung der Lust. Die Verzweiflung angesichts der Blagen, die versorgt werden mussten und die die Eltern vom Glücklichsein, von ihren eigentlichen Lebensträumen, abhielten, äußerte sich in Frustration, Ablehnung oder Gefühlskälte und entlud sich leider auch manchmal in Gewaltausbrüchen.
Kindern zuzuhören, die sogenannte antiautoritäre Erziehung, ein feinfühliges Eingehen auf kindliche Bedürfnisse und Respekt vor deren empfindsamen, unschuldigen Seelen waren damals noch nicht Praxis – nicht nur bei uns zu Hause. Ich empfand mich nie als geliebten kleinen Menschen, über dessen Existenz man sich einfach freute. Ganz im Gegenteil, schon sehr früh hatte ich das Gefühl, dass wir Kinder nicht wirklich gewollt waren, sondern nur geduldet. Bei uns galt: funktionieren, nicht laut sein, nicht schwierig, nicht kompliziert. »Spuren um jeden Preis« lautete die Devise. Wir hatten im Wesentlichen nicht auf- und nicht zur Last zu fallen, am besten unsichtbar zu sein und eigene Bedürfnisse weder zu haben noch – um Himmels willen – zu artikulieren. Manchmal fragte ich mich allen Ernstes, ob wir vielleicht adoptiert waren.
»Ihr wart eigentlich nicht geplant«, dieser Satz rutschte meiner Mutter nach ein paar Gläsern Wein dann mal versehentlich tatsächlich heraus. »Wolltet ihr uns denn gar nicht?«, fragte ich damals entsetzt. Sie daraufhin, abschwächend: »Ach, nach dem Krieg war das halt so. Da gründete man eben eine Familie …«
Ich habe mich oft auch gefragt, ob meine Eltern zusammengeblieben wären, wenn es mich und meine Schwester nicht gegeben hätte. Ob mein Vater dann doch noch Opernsänger oder Friseur geworden wäre – und meine Mutter vielleicht Rot-Kreuz-Chefin. Auch sie hatten ja ihre Träume gehabt, als sie jung waren …
Werner Ochsenknecht war ein gutaussehender Mann. Nicht besonders groß, aber drahtig, und mit einem feingeschnittenen Gesicht. Er kam aus einer strengen preußischen Familie, deren Erziehungsmethode hauptsächlich in Prügelstrafe und Stubenarrest bestand, was mit Blick auf sein eigenes Verhalten später einiges erklärte. Bei besonders schlimmen Vergehen wurde er an die Heizung gekettet. Und dabei einmal so heftig geschlagen, dass er drei Tage nicht reden konnte. Oder wollte. Er selbst hatte nie davon gesprochen. Das haben wir von unserer Mutter erfahren.
Ein anderer Junge hätte diese Härte vielleicht irgendwie weggesteckt. Mein Vater aber hatte eine ganz weiche, künstlerische Seite. Da er eine musische Ader besaß, wollte er Opernsänger werden – oder noch lieber Friseur. Sein Pech war, dass er dafür ein paar Jahrzehnte zu früh auf diesem Planeten gelandet war – und in der falschen Familie. Sein Vater, ein strenger Beamter, stufte die Haarschneiderei abfällig als »Beruf für Schwule« ein. Friseur sei was für »warme Brüder«. Und Opernsänger? »Damit kann man doch kein Geld verdienen, Junge!«
Mit achtzehn meldete sich mein Vater dann freiwillig als Kampfflieger bei der Reichsluftwaffe. Ob es Verzweiflung war oder ein Akt der Coolness – ich weiß es nicht. Flieger zu sein war damals Rock ’n‘ Roll. Und Fliegerjacke und Uniform zu tragen so sexy, wie sich später Jeans und Brando-Lederjacke überzustreifen.
Er wurde Bordfunker in Sturzkampfflugzeugen, klapprige Blechbüchsen, deren Räder kleiner waren als die an Kinderwagen. Die berühmt-berüchtigten Stukas waren einmotorige Kampfflugzeuge, die in tollkühnen Aktionen unter Sirenengeheul im Sturzflug aus mehreren tausend Metern Höhe auf ihre Ziele zuschossen. Direkt über dem Ziel wurde dann die Bombenladung abgeworfen, die Maschine erst etwa 500 Meter über dem Boden abgefangen und anschließend im 90-Grad-Winkel wieder nach oben gezogen. Die Beschleunigungskräfte dabei waren so enorm, dass manche Piloten sekundenlang in Ohnmacht fielen. Um die Organe an ihrem Platz zu halten, sollten sich die Piloten anschnallen. Aber anschnallen war uncool. Mein Vater hat den Gurt so gut wie nie benutzt – und sich so seinen Magen ruiniert.
An der Ostfront wurde er mehrfach beschossen, stürzte zweimal ab und geriet schließlich in britische Gefangenschaft …
Ingeborg Hegner, meine Mutter, machte mit achtzehn eine Ausbildung zur Schwesternhelferin beim Roten Kreuz in Meinigen. Danach meldete sie sich freiwillig zum Kriegseinsatz, weil sie »etwas fürs Vaterland tun« wollte. Im Sommer 1941 – da war sie gerade mal einundzwanzig – wurde sie an die Ostfront versetzt und reiste über Polen bis tief in den Kaukasus. Schreckliche Bilder und Szenen muss sie dort gesehen haben: schlimme Verletzungen, herumhumpelnde junge Kerle, schmerzheisere Schreie. Miterleben zu müssen, dass viele Soldaten und Offiziere, die fit und gesund an die Frontlinie geschickt wurden, ohne Arme, Beine oder mit schlimmen Gesichts- oder Kopfblessuren wieder zurückkamen, war mit Sicherheit eine schmerzhafte und traumatisierende Erfahrung für meine Mutter. Trotz dieser Situation, oder vielleicht gerade deswegen, hatte man in den Lazaretts aber auch viel Lust am Leben: Um den täglichen Tränen, dem Tod und der Verzweiflung etwas entgegenzusetzen, feierten die Ärzte und Schwestern ab und an spontane Partys mit reichlich Alkohol. So mancher Arzt bediente sich dabei auch am Giftschrank, um sich den täglichen Horror mit etwas Morphium weichzuzeichnen. Himmel und Hölle – ganz dicht beieinander. Die Psyche meiner Mutter muss davon ziemlich heftig beeinflusst worden sein …
Ihre Erinnerungen, die sie damals schon in ihrem Kriegstagebuch notierte, hat sie sich 2004 in einem umfassenden Buch von der Seele geschrieben: Als ob der Schnee alles zudeckte stellt ein eindrucksvolles Zeitdokument dar und wurde nicht zuletzt deshalb zu einem großen Überraschungserfolg.
Als Hitler endlich kapitulierte und sich erschoss, war meine Mutter fünfundzwanzig, mein Vater ein Jahr jünger. Der Krieg hatte beiden die Jugend geklaut, und sie mussten sich in den Trümmern ganz neu orientieren. Zudem sahen sie sich mit der bitteren Erkenntnis konfrontiert, einem Unrechtsstaat gedient zu haben: Sie hatten ihre Seelen und ihre vielleicht besten Jahre an ein Horrorsystem unter einem verrückten Diktator verkauft.
Wegen seiner immer schmerzhafter werdenden Magenprobleme musste mein Vater nach dem Krieg operiert werden. Und er landete just in dem Krankenhaus, in dem meine Mutter arbeitete. Man entfernte ihm die Hälfte seines Magens – und sie betreute ihn und pflegte ihn gesund. So lernten die beiden sich kennen. In ihrem Buch beschreibt meine Mutter die Begegnung folgendermaßen: »Ich arbeitete im Krankenhaus in Saalfeld und lernte dort einen Patienten näher kennen, der eine Magenoperation hinter sich hatte. Im Krieg war er Bordfunker gewesen, zwei Mal war er mit dem Flugzeug abgestürzt und hatte es beide Male überlebt. Nach der englischen Gefangenschaft war er nach Thüringen gekommen, um nach seiner Mutter und seiner Schwester zu suchen, und fand mich. Oder sollte ich lieber sagen, dass wir einander fanden? Mit diesem schweigsamen Mann, mit meinem Werner, der mir zwei wunderbare Kinder schenkte, floh ich dann in den Westen.«
Im Nachkriegsdeutschland und aufkeimenden Wirtschaftswunderland hatte man nach den schlimmen, chaotischen Jahren ein großes Verlangen nach einem »geregelten« Leben. Und wie bei allen anderen Paaren jener Zeit nahm dieses auch bei meinen Eltern seinen Gang: Man heiratete, arbeitete, zog in eine kleine Wohnung und gründete eine Familie. Das Kinderkriegen zugunsten einer irgendwie gearteten Selbstverwirklichung zu hinterfragen war undenkbar. Kinder bekam man genauso selbstverständlich, wie man am 24. Dezember Weihnachten feierte. In unserem Fall hieß das: Erst kam meine Schwester Beate und fünf Jahre später ich zur Welt.
Doch während mein Vater mit Kindern überhaupt nichts anfangen konnte und uns das auch zeigte, versuchte meine Mutter, seine emotionale Kargheit mit umso mehr Liebe zu kompensieren. Aber ihre zur Schau gestellte Zuneigung war oft aufdringlich und übertrieben, für mein Empfinden resultierte sie aus einem schlechten Gewissen und kam nie wirklich in meinem Herzen an. Es fehlte echtes, spürbares Interesse an mir als Individuum, warme, aufmerksame Zuwendung. Wenn ich ihr etwas erzählte, hörte sie mir nie richtig zu. Zugegeben, Kleine-Jungs-Erlebnisse sind für Erwachsene auch nicht besonders fesselnd, aber ich wurde auch sonst nie für irgendetwas gelobt, nie gefordert oder gefördert. Sie schmuste zwar mit mir, streichelte mich und gab mir dadurch körperliche Zuwendung, aber an Sätze wie »Ich hab dich lieb« oder »Das hast du toll gemacht!« kann ich mich nicht erinnern.
Viel zu viel Liebe und viel zu wenig – beides war nicht gut. Und es gab noch ein zweites Problem: Ich hatte keine Privatsphäre. Das heißt, ich besaß noch nicht einmal eine eigene Schublade oder ein Fach in einem Schrank, in dem ich irgendetwas hätte verstauen oder verstecken können. Meine Mutter ist an alle meine Sachen und Pappschachteln gegangen. Ich durfte keine Geheimnisse besitzen, wurde komplett durchleuchtet. Wenn ich zum Beispiel von der Schule kam, hatte sie meine Sachen oft neu und anders eingeräumt. Und an meinen selbstgebastelten Flugzeugen – etwa der nachgebauten Stuka meines Vaters – fielen beim Hochnehmen Teile ab, die beim Putzen abgebrochen und von meiner Mutter gleichgültig einfach wieder drangelegt worden waren. Regte ich mich darüber auf, und das tat ich immer, antwortete sie scheinheilig: »Wieso? Ich wollte doch nur sauber machen!« Es war furchtbar. Ich fühlte mich völlig kontrolliert.
Weil ich kein eigenes Zimmer hatte, bastelte ich mir eines unter dem Wohnzimmertisch: Geschützt durch die Tischdecke besaß ich dort einen Rückzugsort, einen Bereich für mich, und damit die Chance, mal alleine zu sein – bis meine Mutter mit dem Staubsauger anrückte …
Mein Vater duldete keine fremden Menschen in der Wohnung, deshalb gab es nie Geburtstagsfeiern für meine Schwester und mich. Wenn sich trotzdem mal ein Schulfreund von mir nachmittags zu uns verirrte, was äußerst selten vorkam, betrachtete meine Mutter das als Riesen-Event. Als ich nach unserem Umzug ins Neubaugebiet Vogelstang endlich ein eigenes Zimmer besaß, das ich mit meiner Schwester teilte, und mich mit meinem Besuch dorthin zurückzog, kam sie alle fünf Minuten rein. Ohne anzuklopfen. Anklopfen gab es bei uns generell nicht. Also schloss ich die Tür ab, wenn ich Besuch hatte.
»Wieso schließt du zu, Uwe?«, fragte meine Mutter sofort durch die Tür hindurch. »Was besprecht ihr denn da? Habt ihr Geheimnisse?«
»Nein, Mama. Wir wollen nur mal unter uns sein!«
Um ihre Störaktionen zu beenden und ihr Misstrauen zu zerstreuen, schloss ich die Tür wieder auf. Fünf Minuten später stand sie im Zimmer:
»Möchtest du deinem Freund nicht mal was zu trinken anbieten, Uwe?«
»Mama, wir holen uns das schon!«
»Ja, ich mein ja nur …«
Drei Minuten später stand sie erneut in der Tür: »Und wie geht’s deiner Mutter, Bernd?«
Kurz darauf kam sie, um »die Heizung zu kontrollieren« oder »die Gardine zurechtzurücken«.
»Mama, was machst du hier?«
»Ich darf ja wohl kurz mal hier reinkommen, oder?«
»Ja, aber warum?«
»Ich dachte, die Heizung sei vielleicht zu hoch gedreht …«
»Ist sie aber nicht.«
Es war im Winter sowieso immer arschkalt in unseren Zimmern. An den Heizkörpern war von der Hausverwaltung ein kleiner Behälter mit einer Flüssigkeit angebracht, die den Verbrauch nach Strichen anzeigte, der von meinem Vater peinlichst genau kontrolliert wurde: »Ihr habt diese Woche schon zwei Striche verbraucht. Das ist zu viel!« Es wurde nach Strichen geheizt und nicht nach Temperatur. Wann das Monatslimit an Strichen für meinen Vater erreicht war, weiß ich allerdings nicht mehr. Und ehrlich gesagt war es mir schon damals egal. Denn ich wollte einfach nur ’ne warme Bude!
Diese ganzen respektlosen Unterbrechungen machten mich wütend.
»Kannst du uns jetzt endlich in Ruhe lassen, Mama?«, fragte ich schließlich ungeduldig.
Worauf sie mit Blick auf meinen Freund antwortete: »Bist du auch so frech zu deiner Mutter, Bernd?«
Ich fand ihr Verhalten nervig, penetrant und blöd. Um meinen Freunden ihre Auftritte zu ersparen, hörte ich irgendwann auf, sie zu mir nach Hause einzuladen. Stattdessen versuchte ich, bei ihnen zu Gast zu sein – gerne auch über Nacht. Das führte zu einem anderen Problem, denn meine Mutter wurde bei Einladungen dieser Art sehr eifersüchtig: »Gefällt es dir bei denen besser als bei uns?«, fragte sie aufgebracht.
»Nein, Mama«, versuchte ich sie verzweifelt zu beruhigen.
»Ja, dann musst du da doch auch nicht übernachten und den Leuten zur Last fallen!«
Besonders gern blieb ich bei meinem besten Kumpel Thomas Buchleiter über Nacht. Jedes Mal wenn ich ihn besuchte und der Zeitpunkt näher rückte, an dem ich nach Hause gehen musste, begann der Kampf mit meiner Mutter. Kam ich mit meinen Überredungskünsten am Telefon nicht weiter (und das war fast immer der Fall), bat ich Thomas’ Ma, mit meiner Mutter zu reden. Sie sollte ihr klarmachen, dass nichts dabei wäre, wenn ich bei ihr und ihrem Sohn schliefe. Manchmal klappte es, aber noch viel öfter leider nicht.
Blieb meine Mutter hart, trieb es mir vor Wut die Tränen in die Augen. Denn ich fühlte mich bei Buchleiters immer extrem wohl. Der Vater von Thomas arbeitete, allerdings in gehobener Stellung, ebenfalls bei Mercedes-Benz und spielte hobbymäßig Jazz. Wenn ich nachmittags zu Thomas kam, übte sein Vater klassische Gitarre. Das fand ich total cool und hochinteressant. An Samstagen waren oft andere Musiker zu Besuch, und Thomas und ich durften dabeisitzen und ihren Gesprächen lauschen. Ich fand diese Fachsimpeleien riesig, was öfter dazu führte, dass Thomas stocksauer war, wenn er in sein Zimmer gehen, ich aber nicht mitkommen wollte.
Vielleicht war er auch unterschwellig eifersüchtig, weil er spürte, dass ich mich ein wenig in seine Mutter Marga verguckt hatte, eine Jugendschwärmerei. Sie war sehr hübsch, lustig, und sie hatte die Wohnung – als gelernte Dekorateurin – beeindruckend geschmackvoll gestylt. Ganz anders, als ich es von uns zu Hause her kannte, und natürlich viel cooler.
Als ich mich später von meiner Familie räumlich und emotional löste, begann ich über mein Zuhause nachzudenken und mir Fragen zu stellen: Warum war es bei uns immer so gefühlskalt? Nach vielen langen Gesprächen, die ich mit meiner Mutter führte, habe ich es schließlich verstanden.
Ich begriff, dass die beiden damals auch nicht aus ihrer Haut konnten. Sie hatten es durch ihre eigene Erziehung nicht anders erfahren – wo sollten sie emotionale Wärme, die sie selbst nicht kennengelernt hatten, und vollkommen neue Erziehungsmethoden herhaben? Kinder zu kriegen und mit harter Hand aufzuziehen, gehörte damals zu einer »ordentlichen« Ehe einfach dazu. Und genauso wenig, wie man auf die Idee gekommen wäre, die Psyche des Wohnzimmersessels verstehen zu wollen, haben sich Eltern damals große Gedanken über die Befindlichkeiten ihrer Brut gemacht. Natürlich gab es durchaus auch Momente der Nähe, aber die waren halt extrem selten – und das finde ich heute noch sehr schade!
Ich gebe meinen Eltern trotzdem keine Schuld mehr: Sie haben uns sicher nach bestem Wissen und Gewissen erzogen, aber sie waren jung und wussten oft einfach nicht, was wir Kinder brauchten. Es war ganz sicher kein böser Wille – und vielleicht für mich letztlich ja auch ganz gut so, denn gerade das fehlende Interesse an meiner Person, an meinen Gefühlen, Träumen und Gedanken, die mangelnde Zuwendung haben mich für meinen späteren Beruf prädestiniert: Wenn ich auf der Bühne stehe, werde ich wahrgenommen. Das Publikum verfolgt jede meiner Handlungen, jeden mimischen oder gestischen Ausdruck ganz genau. Diese Aufmerksamkeit war zu Anfang ein völlig neues, aber unglaublich schönes Gefühl. Dass es mir so viel bedeutete, mich so glücklich machte, habe ich letztlich der Erfahrung mit meinen Eltern zu verdanken.
BIER & SCHLÄGE – »PAPA WAS A DRUNKEN STONE«
»Uwe, mich hat gerade ein Mann angerufen, der alles Mögliche über deinen Vater wissen wollte!« Die Stimme meiner Mutter klang atemlos. Sie war aufgeregt.
»Was wollte er denn genau?«, fragte ich sie misstrauisch. Es kam in letzter Zeit öfter vor, dass irgendwelche Presse-Heinis anriefen, um meiner Mutter Details aus meinem Privatleben zu entlocken. Da sie ihre Nummer partout nicht aus dem Telefonbuch streichen lassen wollte, hatte ich sie instruiert, keine Auskünfte zu geben und stattdessen den Namen und die Nummer des Anrufers zu notieren. Manchmal befolgte sie die Order sogar – so wie heute: »Ich weiß auch nicht! Ich geb dir mal die Nummer. Ruf du doch da mal an!«
Ich wählte die Nummer und wurde mit einem Mitarbeiter der »Arbeitsgruppe für Vermisstenforschung« verbunden, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen wieder zusammenzuführen, die sich im Zweiten Weltkrieg verloren haben. Wird irgendwo ein ausgebranntes Panzergerippe gefunden, ein Schiffsteil oder ein Flugzeugwrack entdeckt, versucht der Verein, die jeweiligen Besatzungsmitglieder zu identifizieren, und forscht nach, ob die Soldaten gestorben oder »nur« verschollen sind.
Der Grund für den Anruf bei meiner Mutter war ein Flugzeug-Wrackteil, das im Zuge von Renaturierungsmaßnahmen auf einem Acker zwischen Worms und Biblis entdeckt worden war. Mit Hilfe des Typen-Schildes, der Vereinsunterlagen, des Logbuchs und der Fluglisten hatte man die Insassen des Fliegers ermittelt – einer davon war mein Vater! An einem Julimorgen im Jahr 1944 war er mit seinem Piloten Siegfried Seiffert, genannt Jonny, vom Flughafen Biblis aus zu einem Schulungsflug gestartet. Die Maschine – so die Ermittlungen – war mit einer anderen kollidiert und abgestürzt. Mein Vater konnte sich mit dem Fallschirm retten, Jonny leider nicht. Ich erinnerte mich an die Besuche von Jonnys Grab auf dem Ehrenfriedhof in Biblis, bei denen ich meinen Vater begleitet und in deren Zusammenhang er mir die Geschichte des Absturzes erzählt hatte.
Die Vergangenheit wurde plötzlich wieder lebendig.
Ein paar Tage später besichtigte ich den Fundort. Auf einem Acker zu stehen, auf dem mein Vater sechzig Jahre zuvor fast ums Leben gekommen wäre, war ein Gänsehaut verursachendes Gefühl. In dem morastigen Gebiet war das Flugzeug damals etliche Meter tief in die Erde geschossen – und die nun entdeckten Bruchstücke konnten deshalb zum Teil noch sehr gut erhalten geborgen werden. Dichtungsringe, Sitz-Federn – sogar das Rotorblatt war noch vorhanden. Ein Teil davon wurde mir übergeben. Für mich waren diese Stücke emotional so berührend, dass ich einen Freund eine Skulptur daraus fertigen ließ. Es ist eben nicht alles aus Gold, was wertvoll ist. Manches ist auch aus rostigem Metall – oder aus einem verschmorten Dichtungsring …
Werner Ochsenknecht wollte nie, dass man ihm ansah, dass er »nur« ein Arbeiter war. Deshalb trug er stets Anzüge, war sehr gepflegt und achtete peinlichst auf saubere Hände und Fingernägel. Um die Maschinenschmiere und das schwarze Öl wieder von seinen Händen zu kriegen, hatte er zu Hause »extra grobe« Seife deponiert. Die roch und fühlte sich an wie körniges Marzipan und war ein Fleckenwunder. Mit dem Zeug bekam man auch die hartnäckigste Schmiere wieder von den Fingern.
Als junger Kerl hatte er hobbymäßig geboxt, und er interessierte sich auch später noch brennend für jeden Kampf. Als wir uns damals einen Fernseher leisten konnten, durfte ich mit ihm die Live-Übertragungen sehen. Die legendären Fights von Karl Mildenberger, Sonny Liston und Cassius Clay liefen bei uns, wenn in Übersee gekämpft wurde, wegen der Zeitverschiebung oft erst um drei Uhr morgens. Papa weckte mich dann aus dem Tiefschlaf, ich durfte neben ihm auf dem Sofa sitzen, und er erklärte mir die Taktik und die Schläge der Boxer, während ich krampfhaft versuchte, die Augen offen zu halten. Diese Momente einer seltenen und seltsamen Zuwendung habe ich, mit dem Schlaf kämpfend und morgens mit Augenringen versehen, immer sehr genossen. Ich nahm, was ich kriegen konnte.
Mein Vater war ein sehr verschlossener, extrem introvertierter Mann. Gefühle konnte er nicht zeigen und mit seinen Kindern, wie schon gesagt, nicht viel anfangen. Weil er jung eine Familie hatte, Geld ranschaffen musste und deshalb nicht als Opernsänger, sondern als Feinmechaniker arbeitete, durfte er seine Leidenschaft für die Musik nur im Theater, in seinem Gesangverein oder zu Hause ausleben. Andauernd hörte er Arien von Richard Tauber und Schlager von Gerhard Wendland, die schrecklichen Rudolf Schock-Operetten oder die noch schrecklicheren Schnulzen seiner geliebten Sängerin Lolita und schmetterte sie aus voller Brust mit. Ich habe das laute Singen immer gehasst.
Vermutlich war seine Frustration über diese nicht-verwirklichte Facette seiner selbst die Ursache für seine regelmäßigen cholerischen Anfälle. Wenn er mir mal wieder eine Tracht Prügel verpasste und laut brüllend auf mich eindrosch, konnte er seine aufgestaute Wut entladen. Er kannte es nicht anders. So war er ja schließlich auch »erzogen« worden. Es nervte mich immer total, wenn auch noch meine Mutter dazwischenging und schrie: »Nicht auf den Kopf, Werner! Bloß nicht auf den Kopf!«
»Jetzt fang du nicht auch noch an«, flehte ich sie an, weil ihre Versuche, mir zu Hilfe zu kommen, meistens die gegenteilige Wirkung hatten.
»So sprichst du nicht mit deiner Mutter«, schrie mein Vater dann und intensivierte seine Erziehungsmaßnahmen.
Meine Mutter hatte immer Angst, dass ich durch seine Schläge einen Hirnschaden erleiden könnte – der Schaden an meiner Kinderseele interessierte sie dabei leider weniger.
Ich hatte furchtbare Angst vor der körperlichen Gewalt meines Vaters und hasste ihn abgrundtief dafür. So sehr, dass ich ihm einmal Nadeln ins Bett legte, in der Hoffnung, dass sie ihm ähnliche Schmerzen zufügten, wie ich sie dauernd erleiden musste. Vielleicht würde er dann ja mal was kapieren und aufhören, mich zu schlagen …
Trotz allem ist aber wohl das emotionale Band zwischen einem Sohn und seinem Vater so stark, dass selbst solche Situationen mich nicht davon abhielten, ihn zu lieben. Wahrscheinlich in der Erwartung, dass irgendwann ein Moment der Nähe käme, ertrug ich seine Attacken. Ich wünschte mir, dass er sich eines vielleicht fernen Tages doch noch als der Papa entpuppte, den ich mir so sehnlichst wünschte. Ein Vater, der einen bei der Hand nimmt und sagt: »Komm, mein Sohn. Wir gehen spazieren, und ich erzähle dir etwas über das Leben!« Als Kumpel, so unter Männern.
Im Grunde war mein Vater jedoch nicht mehr als ein fremder, selten gut gelaunter Mann, der mit uns in einer Wohnung lebte. Jeden Morgen stand er um fünf Uhr auf und musste in das ihm so verhasste Mercedes-Benz-Werk. In einem lichten Moment sagte er einmal zu mir: »Ich wünsche dir, dass du nie jeden Morgen aufstehen musst, um in eine Fabrik zu gehen.« Das kam aus tiefstem Herzen, und er schaute mich dabei mit seinen graugrünen Augen eindringlich an.
Ich ziehe heute mit großem Respekt den Hut davor, dass er diesen morgendlichen Gang zur so ungeliebten Arbeit für seine Familie vierzig Jahre lang auf sich genommen hat!
Weil er die Arbeitswoche aber nur mit Müh und Not ertrug, feierte er am Wochenende dann seinen Frust weg. Freitagabends war »Singstunde« im Gesangverein MGV Sängerlust Waldhof, dem er angehörte. Für ihn hieß das, die Fabrik zu vergessen und ein bisschen Spaß zu haben – für uns hieß es: wahrscheinlich wieder ein langer Freitag! »Aber heute kommst du nicht erst wieder um vier nach Hause«, rief meine Mutter ihm im Treppenhaus nach. »Nö, aber vielleicht um fünf«, kam als Antwort prompt zurück.
Freitagabend ließ mein Vater alles raus: singen, trinken und feiern mit den Kumpeln war angesagt, erst im Vereinslokal und danach meistens noch auf etliche Absacker zu Hause bei einem der Sangeskollegen. Heute kann ich sein Verhalten, sein Bedürfnis, endlich ein bisschen Spaß zu haben und sich frei zu fühlen, gut nachvollziehen, aber damals lief für uns Daheimgebliebene dann folgender Film ab: Ab Mitternacht stampfte meine Mutter zwischen Wohn- und Schlafzimmer hin und her und hielt an den Fenstern Ausschau nach ihm. Da mein Schrankwandbett zwischen den beiden Zimmern stand, war es mit dem Einschlafen deshalb nicht so einfach. Doch das wurde noch getoppt durch ihre immer hysterischer werdenden Flüche. Ich war genervt, denn samstags war Schule, ich musste früh aufstehen und brauchte meinen Schlaf. Darauf konnte sie in diesen langen Nächten aber wohl wenig Rücksicht nehmen.