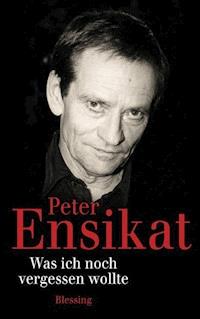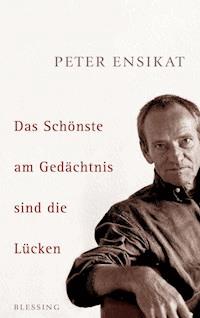Inhaltsverzeichnis
WAS ICH NOCH VERGESSEN WOLLTE
ANGEKOMMEN
WIE LANGE GIBT ES NOCH DEN OSTEN?
SPURENSUCHE
Copyright
WAS ICH NOCH VERGESSEN WOLLTE
Nun muss er endlich mal gezogen werden, dieser Schlussstrich unter eine Vergangenheit, die auch dem Unschuldigsten - und unschuldig sind wie ja irgendwie alle - so peinlich ist. Nach mehr als zehn Jahren Demokratie sollte man diese vierzig Jahre Diktatur doch endlich mal vergessen dürfen! Mein Gott, so schön ist die Demokratie ja auch nicht. Und ob die Diktatur wirklich eine war, das ist heute schon gar nicht mehr so sicher. Ja, man fragt sich längst, ob diese Demokratie denn wirklich eine ist. Im Lichte der Schattenseiten von heute erscheint die Vergangenheit, so finster sie auch gewesen sein mag, schon längst wieder besonnt. Es war nicht alles schlecht - das sagten wir zwar nicht sofort, aber schon ziemlich bald nach jener Wende, in der wir uns am liebsten selbst weggeworfen hätten, nur um nicht dabei gewesen zu sein, als Ulbricht und Honecker uns regierten. Und heute fragt der eine oder andere bereits: Was war denn eigentlich schlecht?
Der in der DDR propagierte Weg »Vom Ich zum Wir« scheint zumindest so weit gelungen, als wir auch heute noch lieber »wir« sagen als »ich«. Besonders wenn wir von einer eventuellen Mitschuld reden an einer Vergangenheit, die wir nicht mehr ändern, nicht mal so richtig vergessen können. Was wir alle getan haben oder eben nicht getan haben, kann gar nicht so schlimm sein, sonst hätten es ja nicht fast alle mitgemacht. Lieber eine sozialistische Kollektivschuld als die schnöde Verantwortung des Einzelnen. Auch eine Kollektivschuld kann Nestwärme produzieren.
Seit ich von Egon Krenz gehört habe, mit ihm sei die ganze DDR-Bevölkerung stellvertretend mitverurteilt worden, weiß ich, wie ein Märtyrer aussieht. Das ist einer, der jetzt für uns alle einsitzen muss, nachdem er vorher für uns alle hatte vorsitzen müssen, eben einer für alle. Keiner führt das Wort vom Rechtsstaat so oft im Munde wie die, die allen anderen einst den Mund verbieten durften, weil sie sich die führende Rolle ihrer Partei selbst in die Verfassung geschrieben hatten. Was damals in der Verfassung stand, kann heute doch kein Unrecht sein. Oder?
Schließlich standen in jener Verfassung auch Dinge, die uns - zumindest in der Erinnerung - allen zugute kamen. Da war zum Beispiel das Recht auf Arbeit, ein wunderbares Recht, denn es war nicht verbunden mit der Pflicht, auf dieser Arbeit auch zu arbeiten. Wer im Dienst war, gehörte zur arbeitenden, also herrschenden Klasse. In der Diktatur bestimmte die Sekretärin, wann diktiert wurde. Insofern war die DDR wirklich eine Diktatur der werktätigen, also Dienst habenden Klasse. Und weil jeder mal im Dienst war, konnte sich auch jeder mal rächen für die in der Freizeit erlittenen Demütigungen. Das schuf bei aller fehlenden Freiheit doch wenigstens ein Gefühl von Gleichheit und Brüderlichkeit. Je weiter diese DDR zurückliegt, desto schöner wird sie. Ihr geht es fast schon wie dem Kaiserreich - sie taucht ab ins Reich der guten alten Zeit oder der Friedenszeit, wie wir im hungernden Nachkriegsosten sagten. Damit war die Zeit gemeint, da es noch gute Butter gab und Bohnenkaffee, echte Seide und Wollstoffe, die nicht knitterten. Vorkriegsqualität oder Friedensware nannten wir das damals. Heute sind es die Brötchen für fünf und die Straßenbahnfahrt für zwanzig Pfennige, die billige Miete und das oben erwähnte Recht auf Arbeit. Dass wir damals alle mit fast allem unzufrieden waren, kann uns heute nicht hindern, noch viel unzufriedener zu sein. Unterm Kaiser war alles besser. Hitler hat die Autobahnen gebaut. Und es war nicht alles schlecht in der DDR. Was stimmt nun an diesen drei Sätzen, die zu unterschiedlichen Zeiten aus gar nicht so unterschiedlichen Gründen immer wiederholt wurden? Nicht von, sondern unter Hitler wurden die Autobahnen gebaut, auf denen wir im Osten teilweise noch bis zur Wende fuhren. Dass unterm Kaiser alles besser gewesen sein sollte, das ist so schön unwahrscheinlich, wie der Satz, es war nicht alles schlecht in der DDR, in so wunderbarer Verallgemeinerung unbestreitbar ist. Ich war in meinem Leben zweimal für längere Zeit in Äthiopien - immer zu Zeiten schwerster Hungersnöte, unvorstellbaren Elends.
Aber das Wetter war nicht schlecht.
Das deutsche Wetter ist uns zwar unter allen Systemen erhalten geblieben. Aber als ich Kind war, lag zu Weihnachten doch fast immer Schnee. Daran werden sich wohl die meisten von uns noch erinnern, und kein hundertjähriger Kalender kann uns die Erinnerung an diese allweihnachtlichen Schneeballschlachten rauben. Unsere Erinnerung ist die einzige Sicherheit, die wir haben, wenn wir von früher reden. Und die guten Erinnerungen lassen wir uns nicht rauben. Die bösen aber verfolgen uns bis in den Schlaf, also bis dorthin, wo wir uns nicht mehr wehren können.
Manchmal träume ich uralte Geschichten noch mal, unter die ich längst einen Schlussstrich gezogen zu haben glaubte. Auch auf das Vergessen ist eben beim Menschen kein Verlass. Kein Schlussstrich schützt den, der ihn gezogen hat, vor sich selbst und diesem ganz und gar unberechenbaren Gedächtnis, das keiner Gedenkstätte bedarf. Vor dem schlechten Gewissen sind auch die Besten unter uns nicht sicher, während das ganz und gar gute Gewissen wohl nur bei denen anzutreffen ist, die mit der Gnade des frühen Vergessens gesegnet sind. Ich weiß, dass ich nichts weiß oder wenigstens nichts wusste. Das heißt zumindest, dass ich weiß, was ich zu vergessen habe.
Da ich das schlechte Gewissen auch den Besten zugestanden habe, kann ich jetzt ruhig sagen: Ich habe kein gutes Gewissen. Schließlich habe ich fast sechzig Jahre gelebt, und wer danach so gar kein schlechtes Gewissen hat, der hat entweder nicht gelebt, oder er hat vergessen, dass er gelebt hat. »Ich bekenne, ich habe gelebt.« So hat Pablo Neruda - das zitiere ich gern - seine Erinnerungen überschrieben, und ich beginne gerade zu begreifen, dass das viel mehr als nur ein Buchtitel ist. Brecht hat dasselbe gesagt, nur eben deutscher: »Mögen andere von ihrer Schande reden, ich rede von der meinen.« Beide übrigens, Neruda wie Brecht, kommen bei sich selbst gar nicht so schlecht weg, wie man nach solchen Bekenntnissen vermuten sollte. Ich fürchte, mir wird es nicht anders gehen. Die folgenden Wahrheiten sind meine Wahrheiten, also nur halbe. Denn wer die ganze Wahrheit wüsste, der wäre kein Mensch, sondern ein höheres, allerdings auch nicht zu beneidendes Wesen.
Der Einzige, der einen wirklichen Schlussstrich ziehen könnte, das ist - jedenfalls für einen unverbesserlichen Atheisten wie mich - der Tod. Und selbst der zieht seinen Schlussstrich nicht unter die Vergangenheit, sondern vor eine Zukunft, mit der ich absolut nichts zu tun haben werde. Die Vergangenheit gibt es auch dann noch, wenn ich und mein schlechtes Gewissen längst nichts mehr voneinander wissen. Was aber aus einer Zukunft ohne mich wird, das kann ich guten Gewissens heute schon vergessen.
ANGEKOMMEN
Immer wieder wird unsereins gefragt, ob er denn nun endlich angekommen sei in dieser Bundesrepublik, als hätte ich mich erst auf den Weg zu ihr machen müssen. Dabei ist sie doch über mich gekommen, ohne dass ich selbst auch nur einen Schritt aus dem Haus tun musste. Mir ist die Bundesrepublik vom Himmel direkt auf die Füsse gefallen. Auch als die DDR über mich gekommen war, hatte mich keiner persönlich gefragt, ob ich sie wollte oder nicht. Aber schon diese DDR verlangte von ihren Bürgern solche Bekenntnisse. Damals sollte man sich zum Sozialismus bekennen wie heute zur Demokratie. Ich gebe zu, mich hier und da zum Sozialismus bekannt zu haben, ohne immer gleich hinzugefügt zu haben, dass für mich diese DDR mit Sozialismus gar nichts zu tun hätte. Natürlich könnte ich mich heute und hier genauso gut zur Demokratie bekennen, umso leichter, da ich diese Demokratie, anders als jenen Sozialismus, ganz und gar ungefährdet kritisieren darf. Manchmal allerdings habe ich den Verdacht, ich darf sagen, was ich will, weil es sowieso egal ist, was ich sage. Die Kritik, die ich seinerzeit trotz aller beamteten Zensur im stillen DDR-Kabarettkämmerlein übte, war zwar auch nicht gerade lebensgefährlich, aber man wurde doch wenigstens hier und da verboten. Ein Verbot war so etwas wie ein Beweis dafür, dass man nicht umsonst gearbeitet hatte. Die heutigen Erfolgserlebnisse sind keine Verbote mehr. Aber dass der eine oder andere Text hier und da nicht gedruckt oder gesendet wird, das passiert schon noch mal. Also ganz ohne Hoffnung bin ich denn doch nicht.
Ich weiß nicht, ob man sich bei Erscheinen dieses Buches noch an den CDU-Spendenskandal erinnern wird. Aber seit ich weiß, mit wie wenig Schmier- und Schwarzgeld ein Kanzler sechzehn Jahre Demokratie spielen lassen konnte, antworte ich auf die Frage, ob ich denn nun endlich in der Bundesrepublik angekommen sei, ganz klar: Ja, ich bin es. Ich mache mir keine Illusionen mehr. Auch diese Demokratie hat ihre Ideale gefressen und ist auf dem Weg, eine real-existierende Demokratie zu werden.
Die DDR musste erst zusammenbrechen, damit man die ganze - oder sagen wir besser: die eine oder andere - Wahrheit über sie erfuhr. Die Bundesrepublik erlebte endlich mal wieder so ein richtig fetziges Medienspektakel wie weiland während der Flick-Affäre und wird sich danach von den Medien auf die Schulter klopfen lassen, weil sie so ein freies Medienspektakel geduldet hat. Dass sie das zuließ, wird als Beweis dafür angeführt werden, wie demokratisch diese Demokratie doch im Grunde ist. Dass hier sechzehn Jahre lang Demokratie gespielt werden konnte, wie in der DDR vierzig Jahre lang Sozialismus gespielt wurde, daran wird man sich vielleicht mit ungläubigem Kopfschütteln manchmal noch erinnern. Aber im Großen und Ganzen wird alles so weitergehen bis zum nächsten Medienspektakel. Das liegt nicht an den Medien. Das liegt daran, dass dieses System eben immer wie geschmiert läuft.
So wie es mich damals zutiefst verwunderte, für wie wenig Geld die Stasi-Spitzel ihr Gewissen verkauften, so hat mich übrigens bei dem Millionendeal der CDU gewundert, dass es hier nicht um Milliarden ging. Ein Bundeskanzler, dachte ich immer, sei billiger nicht zu haben. Und außerdem schleppt man sein Bestechungsgeld doch nicht im Koffer oder in der Aldi-Tüte herum!
Willst große Korruption du sehn, dann musst du in die Wirtschaft gehn. Da gehen ganze Milliarden noch als Peanuts weg. Kurt Tucholsky hat einmal beschrieben, wie seinerzeit französische Journalisten von ihren Politikern bestochen werden mussten, damit sie günstig über sie berichteten. Dann hat er hinzugefügt, deutsche Journalisten müsse man nicht bestechen. Es genüge, sie zum Abendessen einzuladen. Bei den ja auch recht zahlreichen Skandalen unserer SPD-Politiker handelt es sich bisher weitgehend um solche Abendbroteinladungen. Und - das macht sie mir zwar nicht verlässlicher, aber doch zumindest sympathischer - sie treten für jeden geschenkten Appel und jedes spendierte Ei, das man ihnen nachweisen kann, auch schnell mal zurück. Ist es ein Wunder, dass die Personaldecke bei ihnen so dünn ist, während die jungen Wilden bei der CDU warten mussten, bis sich herausstellte, dass sie das eine nicht mehr sind und das andere nie waren? Der Zentralrat der Freien Deutschen Jugend in der DDR war von ähnlicher Jugend und Wildheit. Einer der letzten obersten jungen Wilden des Ostens, ein gewisser Egon Krenz, war ähnlich lange Kronprinz in jener ganz anderen deutschen Monarchie, wie es dann Wolfgang Schäuble in dieser war. König Kohl hatte Prinz Schäuble vor unser aller Fernsehaugen persönlich zu seinem Nachfolger ernannt.
Gleich nach der Frage nach dem Angekommensein in der Bundesrepublik folgt bei jeder unbefriedigenden Antwort der Vorwurf der Undankbarkeit beziehungsweise der Verdacht, man wisse die Demokratie, die ganze neue Freiheit, nicht zu schätzen. Demokratieunfähigkeit heißt das Totschlagwort des zivilen deutschen Feuilletons. Nun weiß ich nicht so recht, worin oder woraus Demokratiefähigkeit bestehen könnte. Sollte Toleranz dazugehören, also die Fähigkeit, den anderen nicht nur zu dulden, sondern als anderen zu akzeptieren, dann kann ich kaum einen westlichen Toleranzvorsprung erkennen. Allenfalls hier und da einen höflicheren Umgangston.
Die herablassende Duldung oder das alles verzeihende Lächeln - beides bekomme ich als Ostdeutscher immer wieder mal zu spüren - haben nichts mit Toleranz zu tun, eher mit Gleichgültigkeit. Schlimmer als ausgelacht ist es ausgelächelt zu werden. Den Hass vieler Ostdeutscher auf die Westdeutschen allerdings rechtfertigt das noch lange nicht. Und den immer öfter geäußerten Wunsch, die Mauer wieder haben zu wollen, kann ich mir auf ostdeutscher Seite nur mit der erwähnten Gnade des frühen Vergessens erklären. Ein paar Wochen Nachsitzen in jener heute so verklärten DDR würden genügen, um den Traum wieder zum Albtraum werden zu lassen.
In der ganzen - auf beiden Seiten lächerlichen - Ost-West-Auseinandersetzung sollten wir Ostdeutschen eigentlich die Klügeren sein. Schließlich kennen wir beide Systeme aus eigener Anschauung. Da der Klügere im deutschen Sprachgebrauch aber immer nachgibt, bleiben die Dummen so oft Sieger. Da der liebe Gott aber ein gerechter Gott sein soll, hat er zumindest eines gerecht verteilt: die Dummheit. Mag das Kapital sich auch noch weitgehend in westlicher Hand befinden, in der Dummheit stimmt das Verhältnis. Auch in dem, was wir einander vorwerfen, zum Beispiel: typisch deutsch zu sein. Beim einen ist es die typisch deutsche Besserwisserei, beim andern die nicht weniger typisch deutsche Jammerei der Zukurz- oder Zuspätgekommenen. Typisch deutsch dürfte übrigens auch sein, dass man immer wieder fragt, was denn nun eigentlich typisch deutsch ist. Und wenn man am anderen, also am Ost- oder Westdeutschen, etwas unsympathisch findet, dann findet man das gern typisch deutsch.Typisch deutsch sind in Deutschland nämlich immer die anderen. Man selbst - also ich zum Beispiel - bin weder typisch noch so richtig deutsch. Ich bin irgendwie doch was Besseres. Und gerade das dürfte typisch deutsch sein.
WIE LANGE GIBT ES NOCH DEN OSTEN?
Anfang 1991 habe ich kühn behauptet, die DDR werde es noch so lange geben, bis der letzte DDR-Bürger gestorben sei. Das klang damals wie ein Witz. Und so richtig glauben wollte ich es selber nicht. Man möchte aber doch so gern auch mal übertreiben. Und nun merke ich an mir selber und an vielen Freunden: Die DDR ist aus uns nicht rauszukriegen. DDR hat man lebenslang. Mag einem diese DDR mit wachsendem Abstand auch immer unerklärlicher werden - wie konnte so was überhaupt so lange existieren? -, man kriegt sie nicht aus den Kleidern, auch wenn das jetzt alles Westklamotten sind. Da wo ich wohne, für meine Westberliner Freunde ist das immer noch der ferne Osten, mitleidige Seelen sprechen auch vom »ehemaligen Osten«, kann man diese DDR auch wirklich noch mit Händen greifen. Die meisten Häuser sind zwar inzwischen neu angemalt, modernisiert oder neu gebaut, und es riecht auch besser, seit die Braunkohlenheizungen durch Fern- oder Gasheizungen ersetzt worden sind. Jetzt wird diese bessere Luft nur noch von unser aller Westwagen verpestet. Statt der wenigen überfüllten Kneipen und Restaurants ist jetzt an jeder Ecke ein Grieche, Türke, Italiener oder Chinese, und das eine oder andere Lokal mit deutscher Küche gibt es auch wieder oder wieder nicht mehr. Alle paar Wochen öffnet so eine neue Kneipe, während eine alte wieder schließt. Eine Konsum-Kneipe in der DDR konnte noch so mies sein, schließen musste sie deshalb noch lange nicht. Aber eines hat sich in Hohenschönhausen nicht verändert: Wirklich gut essen kann man - wie zu DDR-Zeiten - nur zu Hause.
Außer den wenigen Ausländern, die hinzugekommen sind, wohnen hier fast nur Leute, die schon früher hier wohnten. Darunter viele ehemalige Stasi-Mitarbeiter. Hier befand sich nicht nur eines der bekanntesten Stasi-Gefängnisse Berlins, hier wohnten auch Stasi-Generäle und ihr Fußvolk. Schließlich ist die Gegend ganz schön. Drei Seen gibt es in der näheren Umgebung, sogar ein kleines Naturschutzgebiet. Wo es schön ist - sagten wir in der DDR -, da ist die Stasi nicht weit. Wie nahe sie war, das erfuhr ich, kurz nachdem ich hergezogen war, und es hat mich anfangs sehr beschäftigt.
Wie sehr sich die Stasi mit mir beschäftigt hat, das erfuhr ich erst nach der Wende und ganz ohne Akteneinsicht. Was der Stasi die Beschäftigung mit mir eingebracht hat, weiß ich nicht, ich will auch nach wie vor meine Akte nicht sehen. Schließlich hatte ich auch - so weit ich das übersehen kann - durch die Stasi keinen direkten Schaden. Mal abgesehen von den Kosten für die Abhöranlage in meinem Haus. Solche Anlagen hatte der DDR-Steuerzahler zu finanzieren, ohne zu ahnen, dass es sie überhaupt gab.
Als Steuerzahler habe ich auch heute für Dinge zu zahlen, die ich - wenn ich nur wüsste, worum es sich handelt - freiwillig nie bezahlen würde. Aus den Medien erfuhr ich zu Wendezeiten, wer so alles in meiner Nachbarschaft gewohnt hatte. Im November/Dezember 1989 bekamen diese Kämpfer der »unsichtbaren Front« auf diese Weise plötzlich Gesichter. Ein paar von ihnen habe ich mir gemerkt. Wenn ich sie jetzt wieder sehe, beim Bäcker oder im Gemüseladen, fällt es mir schwer zu glauben, dass diese alten Herren - Opas hätten wir früher gesagt - einmal über so viel Macht verfügt hatten. Vor denen hat man sich mal gefürchtet, und vor ihnen sollte man sich auch fürchten! Angst zu verbreiten gehörte zu den Aufgaben der Stasi. Wenn ich heute höre oder lese, was Gaucks Behörde - sie wird wohl, solange sie existiert, mit diesem Namen verbunden bleiben - über die Tätigkeit meiner Nachbarn aus ihren Akten in Erfahrung gebracht hat, dann frage ich mich schon manchmal: Hast du wirklich nicht gewusst, was sie da machen? Oder hast du es nicht wissen wollen? Oder hast du inzwischen lieber vergessen, was du damals eigentlich wusstest, nur um heute nicht so mitschuldig in der Ostecke stehen zu müssen? Und wie habe ich in dieser Nachbarschaft überhaupt so ruhig leben können? Ich finde keine Antwort, die jeder Nachfrage standhielte.
Wieso betrachte ich heute die vier alten Stasi-Oberen mit spöttischer Gelassenheit, wenn sie an meinem Gartenzaun stehen bleiben, die politische Lage diskutieren und sich über die aktuellen Wahlergebnisse im Osten freuen? Ihre Posten haben sie verloren und damit auch ihre Pensionsansprüche. Geblieben ist ihnen eine Mindestrente und das, was in der DDR mal Klassenstandpunkt hieß. Der bestand eigentlich nur aus einem Satz: Die Partei, die Partei hat immer Recht! Und das scheint sie für meine Opas von der ehemals unsichtbaren Front auch heute noch zu haben, obwohl es sie gar nicht mehr gibt, diese Partei des unbegrenzten Rechthabens. Gegen einen starken Glauben kommt keine Wirklichkeit an. Das beweisen eben auch Atheisten der verschiedensten Glaubensrichtungen. Immer mal wieder überkommt mich der Gedanke, wie es denn hier aussähe, wenn es anders gekommen wäre. Wie wären sie und ihre Genossen mit den Klassenfeinden umgegangen, hätten nicht die, sondern sie selbst den Kalten Krieg gewonnen. Und dann bin ich - anders als viele andere hier - eher froh darüber, wie unvollkommen so ein Rechtsstaat ist im Umgang mit Schuld und Sühne. Die Erkenntnis, dass die Justiz der Bundesrepublik unfähig ist, mit Diktatoren abzurechnen, regt mich nicht auf. Sie beruhigt mich eher. Bei Karl Kraus steht der Satz: Ein bisschen Ungerechtigkeit muss sein, sonst wird man nie fertig. Dieser Satz klingt so leichtfertig, wie er weise ist.
Dass von meinen vier höheren Stasi-Nachbarn, von denen ich weiß, dass sie es waren, noch einmal eine Gefahr ausgehen könnte, vermag ich nicht zu erkennen. Wenn ich sie an meinem Gartenzaun diskutieren höre oder neben ihnen am Käseregal im Supermarkt stehe, wünsche ich manchmal allen Diktatoren und ihren Generälen dieses Schicksal - mit mir am Käsestand stehen zu müssen und nur das kaufen zu können, was sie von ihrer Mindestrente bezahlen können. Mindestrente kann auch Rache sein und erfüllt meinen Bedarf an Schadenfreude voll und ganz.
Dass ich als freischaffender Kindertheater- und Kabarettautor in der DDR kaum mehr als so eine Mindestrente zu erwarten habe, muss ich dabei gar nicht verdrängen. Schließlich hatte ich nie Pensionsansprüche, wie sie für einen Stasi-General selbstverständlich waren. Und der Verlust nie besessenen Reichtums, nie gehabter Sicherheit ist leichter zu verschmerzen als der plötzliche Verlust sicher geglaubter Besitzansprüche. Keine Macht zu haben schützt übrigens nicht nur vor Missbrauch, sondern auch vor ihrem Verlust. Wer aber Macht und Besitz verloren hat, für den kann Mindestrente eine harte Strafe sein.
Dass die Vergangenheit in meinem Dorf nicht vergehen will, liegt aber nicht nur an der fast täglichen Begegnung mit diesen Rentner gewordenen Gespenstern unserer Vergangenheit.
»Die Umwelt formt den Menschen.« Das hat jeder DDR-Schüler tausendmal vorgebetet bekommen, und nun können wir es getrost auch nachbeten. Die DDR-Umwelt hat uns geformt, ob wir diese Umwelt nun geliebt, gehasst oder gleichgültig ertragen haben. Anorak und Kittelschürze haben wir ausgezogen, aus unserer Haut kommen wir nicht raus. Ich bin auf Lesereisen in der ganzen Bundesrepublik herumgekommen. Auch im fernsten Rheinland noch oder im tiefsten Bayern, überall wo ich meinen östlichen Landsleuten heute begegne, erkenne ich sie meist ziemlich schnell, ohne genau sagen zu können, woran. Wir riechen einander, und es ist ein ganz unnötiger Vertrauensbeweis, vom anderen gesagt zu bekommen: »Ich komme auch von drüben.« Nach drei, vier Sätzen hätte ich es ohnehin gemerkt.
Nicht dass wir einander mehr lieben oder hassen als andere Leute. Unsere Gefühle füreinander sind so ambivalent, wie sie zwischen Menschen eben sind. Unser Verhältnis zur DDR-Vergangenheit mag noch so entgegengesetzt sein, unsere Erfahrungen mit jenem real-Gott-sei-Dank-nicht-mehr-existierenden Sozialismus noch so verschieden. Spätestens wenn uns einer, der die Toskana, Mallorca und die Kanaren schon lange kennt und also Bescheid weiß, wie die Welt beschaffen ist, zu erklären beginnt, wie diese DDR beschaffen war, spätestens dann eint uns eine Gewissheit: So war diese DDR nicht. Dabei wissen wir doch selber kaum noch, wie sie wirklich war. Und erklären kann man sie auch keinem, der sie gar nicht oder nur besuchsweise erlebt hat. Das aber kann man dem gerade nicht erklären. Denn der kennt schließlich die Welt. Könnte es sein, dass die DDR einfach nicht von dieser Welt gewesen ist?
Ich habe ihr noch keine Minute nachgetrauert. Aber vergessen kann ich sie nicht, selbst wenn ich das wollte. Dabei haben wir Ostberliner, als wir noch Bewohner der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik waren, tausendmal in tausend Zusammenhängen gesagt:
DDR? Kannste verjessen.
SPURENSUCHE
Ich wohne fast noch im Grünen. Da aber immer mehr Leute im Grünen leben wollen, werden hier immer mehr Häuser hingestellt mit der Folge, dass das Grüne langsam hinter den bunten Häusern verschwindet. Mein Haus, es stammt aus der Kaiserzeit, ist noch von jenem Grau, das einst das Bild der DDR geprägt hatte. Trotzdem finde ich mein Haus viel schöner als die meisten neuen bunten Fertighäuser ringsherum. Da die Leute, die das Haus vor mir besaßen, zu DDR-Zeiten nicht genug Geld hatten, um es zu modernisieren, sieht man ihm nicht nur sein schönes Alter, sondern auch seine alte Schönheit noch an. Verfall muss nicht immer so endgültig sein wie Sanierung. Der westliche Reichtum, scheint mir, hat im westlichen Nachkriegsdeutschland kaum weniger zerstört, als die östliche Armut hier hat verfallen lassen.
Für die Häuser jedenfalls kamen die neuen Besitzverhältnisse, so weit sie denn geklärt sind, gerade noch zurecht. Für die Menschen war es ein bisschen schnell. Ich hatte Glück: An meinem Haus gibt es keine ungeklärten Besitzverhältnisse. Ich hatte es, wenn auch zu DDR-Zeiten, so doch auch nach heutigem Rechtsverständnis ganz legal gekauft. So gut geht es nicht jedem.
Wenn ich aus meinem alten Dorf auf neuen Straßenbahnund S-Bahn-Gleisen ins Zentrum fahre - in die Stadt, sagen wir hier -, fahre ich an vielen dieser Plattenbauten vorbei, denen man mit neuer Farbe ein wenig von ihrer alten Hässlichkeit zu nehmen versucht hat. Die große Straße, die in die Stadt führt, hieß einmal Leninallee. Jetzt heißt sie wieder Landsberger Allee, und der Leninplatz, an dem einst das riesige Lenindenkmal stand, heißt jetzt Platz der Vereinten Nationen. Da, wo einst das Denkmal stand, liegen - irgendwie verloren - ein paar große Feld- oder Granitsteine. Der erbitterte Streit um den Abriss des gewaltigen Lenin ist längst vergessen. Aber auch wer den Platz nie mit dem Denkmal gesehen hat, dürfte merken, dass hier ein Loch ist in der Plattenbaulandschaft. Ein wesentlich hässlicheres Denkmal von Ernst Thälmann, nur ein paar hundert Meter entfernt, steht noch. Offizielle Begründung: Thälmann war zwar auch Kommunist, aber doch wenigstens ein Deutscher. Nein, wir kriegen die Vergangenheit nicht aus den Köpfen, auch die nicht, die viel weiter zurückliegt als die DDR. Der Russe gehört nicht in unser Straßenbild, auch wenn er - oder gerade weil er - dieses Bild hier so lange geprägt hat.
Wenn ich dann am Bahnhof Friedrichstraße aussteige, bin ich endlich da angekommen, wo es aussieht, als wäre hier schon immer Bundesrepublik gewesen. Dabei fällt mir gerade hier immer wieder ein, wie es zu Mauerzeiten ausgesehen hat. Letzte Spur - die hässliche Abfertigungshalle an der Grenze steht noch. Da, wo man sich von seinem Westbesuch trennen musste, und wo ich nicht nur fremde Tränen sah, gibt es heute unterhaltsame, manchmal auch kabarettistische Veranstaltungen. Was damals der Volksmund »Tränenpalast« nannte, heißt jetzt offiziell so. Ich habe inzwischen mehrmals da gesessen, wo einst die »Grenzkontrollorgane der DDR« die Reisenden das Fürchten lehrten. Wenn hier noch Tränen fließen, dann sind das höchstens Lachtränen.
Von den »DDR-Grenzsicherungsanlagen« ist auf dem Bahnhof nichts mehr zu spüren. Die verschiedenen Ein- und Ausgänge für »Bürger der BRD, Bürger aus Westberlin und anderen Staaten« sind nicht mehr zu erkennen. Die verschlossenen Türen sind verschwunden. Man kann allenfalls vermuten, wo man einmal gewartet hat auf die Ost-Oma, den West-Freund, auf Freunde und Kollegen aus Frankreich, Belgien, Schweden, den Westbesuch eben … Die kurze Begrüßung - meist etwas verlegen unter den Augen der anderen Wartenden und der uniformierten Grenzer - und das schnelle Nur-weg-hier, schließlich die stereotype Frage: Wie war’s denn diesmal? Damit war natürlich die allzeit willkürliche Grenz- beziehungsweise Zollkontrolle gemeint. Irgendwie fühlte sich unsereins mitverantwortlich für die Schikanen und alle an der Grenze versammelten Unfreundlichkeiten, mit denen der Staat DDR seine Gäste willkommen zu heißen pflegte.
Jetzt kann man da, wo achtundzwanzig Jahre lang alles verschlossen und vernagelt war, einfach durchgehen, durchsehen. Man kann sogar Kaffee trinken gehen in einem der jetzt zahlreichen Cafés. Wie früher, bevor die Grenze zu jenem »antifaschistischen Schutzwall« wurde, auch Mauer genannt. Und trotzdem ist hier nichts mehr so, wie ich es als Kind noch gekannt hatte, als ich mit meinem Onkel Erich über die »offene Grenze« schleppte, was uns den Westen so wertvoll machte - abgelegte Kleidung, Schokolade und allerlei Haushaltsgeräte von der Neuköllner Verwandtschaft. Dass wir den riesigen Umweg über die Friedrichstraße machten, um von Neukölln zurück nach Schöneweide zu kommen, das hatte sich mein im offenen Grenzübergang erfahrener Onkel Erich ausgedacht. Am Bahnhof Friedrichstraße hatte man - zumindest im Berufsverkehr - den DDR-Zoll nicht zu fürchten. Hier war einfach zu viel Betrieb, um uns auf die Schmugglerspuren zu kommen.
Dann kam die Mauer. Aus dem ehemaligen »Westbahnsteig« wurde Endstation für alle S-Bahnen, die aus Königswusterhausen, Schönefeld oder Bernau kamen. Eine schmutzige, undurchsichtige Glaswand trennte diesen Bahnsteig jetzt von den beiden anderen, die nur noch Ostrentner oder Westgäste betreten durften. Der ganze Bahnhof war eine einzige Grenzanlage mit Spürhunden und den allgegenwärtigen uniformierten und zivilen Grenzschützern. Das ist Gott sei Dank vorbei. Statt der Grenzanlagen ist jetzt hier so was wie eine Ladenstraße mit Gleisanschluss entstanden. Täuscht mich mein Eindruck, dass heutzutage aus allem, was unsere Architekten um- oder neubauen, zum Schluss immer Ladenstraßen werden? Und alles sieht aus wie Legoland - bunt, glatt, spurlos. Wer nicht weiß, dass der Bahnhof Friedrichstraße mal Grenzbahnhof war, eines der bestbewachten Löcher im Eisernen Vorhang, der wird es auch nirgendwo erkennen. Wenn ich nicht wüsste, dass sich hier einmal sehr traurige Menschengeschichten abgespielt haben, weil sich anonyme Weltpolitik zwischen ganz und gar nicht anonyme Menschen gedrängt hatte, ich würde nichts davon ahnen.
Der Ostberliner Schriftsteller Heinz Knobloch hat, als er nach Spuren jüdischen Lebens in Berlin und nach den Spuren von der Vernichtung dieses Lebens suchte, den Satz geprägt: »Misstraut den Grünanlagen!« Deutscher Umgang mit der Vergangenheit scheint seit jeher in der Beseitigung ihrer Spuren zu bestehen. In der DDR ließ man - in des Wortes doppelter Bedeutung - Gras drüber wachsen. Jetzt wird Beton drauf gegossen. Und wenn die Spuren dann alle beseitigt sind, merkt man manchmal, dass etwas fehlt. Und dann baut man sich ein Mahnmal gegen das schlechte Gewissen. Da können aus gegebenem Anlass Blumen und Kränze niedergelegt, Reden gegen das Vergessen gehalten und im Übrigen einfach dran vorbeigegangen werden.
Nachdem man in Berlin die Mauer abgerissen, in ihre Einzelteile zerlegt und diese in alle Welt verkauft hatte, wollten die Leute - darunter viele Touristen aus aller Welt - plötzlich wieder wissen, wo diese Mauer überhaupt gestanden hatte. Da Berlin die Touristen als »Wirtschaftsfaktor« braucht, machten sich ein paar höher beamtete Spaßmacher der Stadt daran, den Verlauf dieser Mauer auf Flächen, die noch nicht zugebaut waren, mit einem roten Strich zu markieren. Nun kann man also mit seinen Berlin-Besuchern auf diesem roten Strich entlanggehen, sofern auf dem verschwundenen Todesstreifen nicht gerade Autos parken. Aber damit nicht genug der Mahnung! In der Bernauer Straße hat man einen bescheidenen Mauerrest mit einem riesigen Mahnmal zugebaut. Durch kleine Löcher kann man dort das rührend kleine Stückchen Mauer mit dazugehörigem Todesstreifen besichtigen. Das wirkt so harmlos, wie das Mahnmal selbst in seiner hässlichen Belanglosigkeit erschüttert.
Wir Deutschen haben es in unserer Geschichte nicht nur zu den größten Verbrechen gebracht, wir errichten, nachdem alles vorbei ist und wir die Spuren verwischt haben, auch die größten Mahn- und Gedenkstätten. Diese wiederum dienen sowohl der repräsentativen Mahnung als auch der volkstümlich gebliebenen Schändung. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann brauchen wir bald denselben effektiven Wachschutz für unsere Mahnmale wie für unsere Asylbewerberheime.
In Brandenburg vergeht inzwischen kaum ein Tag, an dem nicht ein Denkmal oder so ein Heim beschmiert oder angezündet wird. Das hat sowohl mit deutscher Vergangenheit als auch mit unserer Gegenwart zu tun. Dass solcher Vandalismus im Osten noch häufiger ist als im Westen unseres toleranten Vaterlandes, gibt dem aufgeklärten Westdeutschen die schöne Gewissheit, der ganze Rechtsradikalismus sei ein Resultat des im Osten einst verordneten Antifaschismus und dieser ganzen vorzivilisatorischen Sozialisierung der Ostmenschen. Dass diese Jugendlichen inzwischen schon mehr als die Hälfte ihres bewussten Lebens in der Bundesrepublik verbracht haben und dass ihre schwarz-braunen Weisheiten zum großen Teil aus München oder Düsseldorf stammen, hindert nicht, die Schuld da zu suchen, wo man selbst ganz und gar unschuldig war - in jenen vierzig DDR-Jahren. Und das kommt einem, der diese vierzig Jahre DDR miterlebt hat, zumindest bekannt vor.
In der DDR erklärte man kurzerhand jede Art von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus, eigentlich die Kriminalität überhaupt, am liebsten mit den bösen Einflüssen, die da aus dem Westen bei uns eindrangen. In der Bundesrepublik hatte man schließlich nicht so schöne Lehren aus der Vergangenheit gezogen wie im konsequent antifaschistischen Osten. Heute führt dieselbe Spur zurück in die böse DDR-Kinderkrippe, wo schon das zwangsgetöpfte Baby Beweis genug sein kann für eine später zwangsläufige Neigung zu Gewaltbereitschaft und Fremdenfeindlichkeit. Damals diente solche Art vergleichender Wissenschaft der Ideologie, heute wohl nur noch der Unterhaltung. Und je mehr sich der Ostdeutsche über seinen westdeutschen Analytiker aufregt, desto größer die Chance für diesen, berühmt zu werden. Denn wo die Wissenschaft dem Stammtisch Argumente liefert, wird sie auch volkstümlich. Massenwirksam nannte man das früher bei uns.
Dass Ost- und Westdeutsch zwei Sprachen einer Nation sind oder zumindest waren, habe ich auch schon herausgefunden, bevor Sprachwissenschaftler aus Mannheim das wissenschaftlich untermauerten. Die Tatsache, dass manche Spuren ostdeutschen Sprachgebrauchs einfach nicht verschwinden wollen, scheint sie tief zu beunruhigen. Ja, sie sprechen sogar von einer innerdeutschen Sprachmauer und von »Gruppen, die eine sprachliche Besinnung auf die alte Ostidentität instrumentalisieren.« Ich gebe zu, selbst hier und da auf meiner Ostidentität sitzen geblieben zu sein, ohne dass mich das im Geringsten beunruhigt. Wo und warum sollte ich eine Westidentität nach so langer Ostexistenz auch suchen? Was die Sprache betrifft, so glaube ich nicht, dass Westdeutsch weniger heruntergekommen ist als Ostdeutsch. Zugegeben, Nullwachstum, Kollateralschäden oder Nachvorneverteidigung klingen nicht halb so komisch wie die ostdeutsche Sättigungsbeilage, der Getränkestützpunkt oder die wundersame Komplexannahmestelle. Dort übrigens wurden uns auch zu Zeiten ihrer Existenz lediglich kaputte Toaströster oder Regenschirme zur Reparatur abgenommen. Unsere Minderwertigkeitskomplexe hat uns auch damals keiner abgenommen. Schon deshalb begann der Ossi, gleich nachdem er mit seiner friedlichen kleinen Zweiwochenrevolution fertig war und die ganze Ost-Regierung in einem Feierabendeinsatz gestürzt hatte, ganz schnell Westdeutsch zu lernen, um seine Demokratiefähigkeit zu beweisen.
Anfangs schien ihm das auch ganz gut zu gelingen. Er trennte sich von Ausdrücken wie Plaste und Elaste aus Zschkopau und erfreute sich an der schönen bunten Plastik, die rein sprachlich von der gleichnamigen Skulptur gar nicht zu unterscheiden ist. Auch die tristeste Ostkaufhalle wurde über Nacht zum Supermarkt ernannt. Selbst tiefrote PDS-Abgeordnete ließen im Bundestag vom Führungsanspruch ihres Parteichinesisch ab und erlernten das von Gerhard Schröder so perfekt beherrschte Demokratendeutsch. Das heißt, sie lassen jetzt auch außen vor, was keinen Sinn macht. Oder sie hängen alles auch schon mal ein bisschen tiefer. Also sie sagen inzwischen nicht nur das, was man im Bundestag so sagt. Sie sagen es auch schon so, wie man das da so sagt. Die Umwelt formte eben nicht nur den Menschen von früher, sie formt auch seinen Sprachgebrauch von heute.
Ich übrigens sage heute noch oder wieder Kaufhalle zu
Umwelthinweis:Dieses Buch und der Schutzumschlag wurden auf chlorfreiem Papier gedruckt. Die Einschrumpffolie (zum Schutz vor Verschmutzung) ist aus umweltschonender und recyclingfähiger PE-Folie.
Der Karl Blessing Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Bertelsmann.
1. Auflage
© Copyright 2000 by Karl Blessing Verlag GmbH, München
Printed in Austria
eISBN : 978-3-641-01021-8
www.blessing-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de