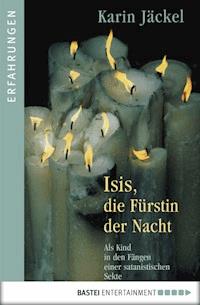4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Thomas mit neun Jahren erfährt, dass ein katholischer Priester, Direktor der örtlichen Klosterschule, sein Vater ist, fällt es ihm schwer, mit dem Geheimnis zu leben. Nach Jahren des Versteckspiels bekennt sich der Geistliche endlich zu seiner Familie. Aber das Zusammenleben ist so konfliktreich, dass Thomas schwer erkrankt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumVorwort… weil mein Vater Priester istNachwortÜber dieses Buch
Als Thomas mit neun Jahren erfährt, dass ein katholischer Priester, Direktor der örtlichen Klosterschule, sein Vater ist, fällt es ihm schwer, mit dem Geheimnis zu leben. Nach Jahren des Versteckspiels bekennt sich der Geistliche endlich zu seiner Familie. Aber das Zusammenleben ist so konfliktreich, dass Thomas schwer erkrankt …
Über die Autorin
Dr. phil. Karin Jäckel, geboren 1948 in Rerik, Mecklenburg. Aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und im Saarland. Studium Kunstgeschichte, Germanistik, Sprecherziehung mit Promotion (1975) über Leben und Werk des Rokoko-Bildhauers Joachim Günter.
Verheiratet seit 1971, drei Söhne. Wohnhaft in Oberkirch (Ortenau, Schwarzwald). Zahlreiche Buchpublikationen für alle Altersgruppen in namhaften Verlagen sowie Rundfeatures, TV- und Print-Reportagen, Essays und Kommentare, Vorträge, Referate und Gastbeiträge in TV- und Radio-Talkshows, Podiumsdiskussionen etc.
Politisches und soziales Engagement für die Respektierung der Gleichwertigkeit der Geschlechter und das Recht des Kindes auf Unversehrbarkeit sowie auf gelebte Bindung an Mutter und Vater.
Karin Jäckel
… weil mein Vater Priester ist
Thomas wusste nicht, wer sein Vater ist. Jetzt erfährt er die Wahrheit
BASTEI ENTERTAINMENT
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung eines Motives © shutterstock: goodmoments
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-4826-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort
Viele Leserinnen und Leser, die dieses Buch zur Hand nehmen, mögen sich fragen: Warum ein Buch über den Sohn eines römisch-katholischen Priesters? Was kann so bemerkenswert anders an dem Leben eines Priesterkindes sein als an dem Leben eines jeden beliebigen Kindes? Gibt es in unserer Gesellschaft, in der die großen Kirchen zusehends unglaubwürdiger werden und täglich deutlicher an Macht und Einfluss verlieren, überhaupt noch einen Grund, an der Vaterschaft eines Priesters Anstoß zu nehmen?
Mit Sicherheit – werden Sie vielleicht denken – gibt es heutzutage kaum noch einen vernunftbegabten Menschen, der darin eine Sünde sieht. Warum dann also so viel Aufhebens um etwas so Alltägliches wie ein unehelich geborenes Kind, das das Schicksal so vieler anderer teilt, die ohne Vater bei ihren alleinerziehenden Müttern aufwachsen?
Lassen Sie mich Ihnen versichern, liebe Leserin, lieber Leser – es nehmen auch heute noch Massen geradezu erbittert daran Anstoß, wenn ein Priester ein Kind bekommt.
Als ich 1992 nach mehrjähriger Recherche erstmals ein Sachbuch mit dem Titel »Sag keinem, wer dein Vater ist« über das Schicksal von Priesterkindern veröffentlichte, erreichte mich eine Flut von Leser/innenbriefen.
Sehr viele waren darunter, in denen mein Buch ein »notwendiges und hoffentlich Not wendendes« genannt wurde. Die meisten Briefschreiber waren Klostergeistliche oder Priester im Pfarrdienst, Lehrberuf, Militärdienst, Pfarrhaushälterinnen mit heimlicher Beziehung zu ihrem Pfarrer sowie Menschen aus einer verwaisten Pfarrei, deren Pfarrer wegen eines Verstoßes gegen den Zölibat suspendiert worden war.
Weit mehr Zuschriften aber kamen von Leuten, die nicht etwa hauptsächlich über die Tatsache empört sind, dass eine erschreckend große Zahl römisch-katholischer Priester ein Doppelleben führt und heimlich Frau und Kinder hat. Die Mehrheit aller Zuschriften beschimpfte mich vielmehr, weil ich mit diesem Buch Gotteslästerung beginge, indem ich »die Sünde eines gottgeweihten Priesters« laut zu nennen wage. Von manchen Leserinnen wurde ich dafür verflucht. Einige Morddrohungen waren auch dabei. Angehörige meiner Familie wurden stellvertretend für mich auf der Straße gescholten.
Wegen des wüsten Stroms der Beschimpfungen am Telefon schaffte ich mir in dieser Zeit einen Anrufbeantworter und eine Trillerpfeife an. Eine Buchhändlerin in Recklinghausen, die mein Buch einem jungen Kaplan empfahl, sah diesen entsetzt zurückweichen und abwehren: Nein, nein, da sei Gott vor, dass er ein solches Teufelsmachwerk lese. Und einmal erfuhr ich, dass der Pfarrer einer meinem Wohnort benachbarten Gemeinde mein Buch und mich von der Kanzel herunter und sogar in seinem Gemeindebrief verurteilt habe.
Verglichen mit den Belastungen, denen ein Priester und seine Frau ausgesetzt sind, sobald ihre meist jahrelang strikt geheim gehaltene Liebesbeziehung publik wird, ist der Terror, den ich aufgrund meines Buches erfuhr, allerdings nicht mehr als ein Spiel und nur ein Lächeln wert.
Daher möchte ich Ihnen nun schwerpunktmäßig verdeutlichen, warum und inwiefern sich das Leben eines Priesterkindes und seiner Eltern tatsächlich nachhaltig von dem eines beliebigen Kindes und Elternpaares unterscheidet.
Die beiden alles bestimmenden Hauptunterschiede liegen darin begründet, dass die Selbstorganisation des Kirchenstaates per eigenem Gesetz vom weltlichen Staat geduldet wird, sodass beide Systeme gültig sind.
Daraus ergeben sich folgende Widersprüche: Der weltlich orientierte Vater eines beliebigen Kindes will aus ganz freiwilligen, privaten, absolut persönlichen Gründen möglicherweise kein Kind zeugen und kein Vater sein, der kirchlich orientierte Vater eines Priesterkindes aber darf aus rein kirchenarbeitsrechtlichen Gründen kein Vater werden und sein.
Die Zeugung eines beliebigen Kindes im Sinne der Kirche ist eine heilige Handlung, die Zeugung eines Priesterkindes im Sinne der Kirche aber eine verbrecherische Handlung, die, mit den Worten eines Kirchenrechtlers, einem »Bankraub« vergleichbar ist und entsprechender (kirchlicher) Strafe unterliegt.
Wer sich – meist schon in jugendlichen Jahren – dazu entschließt, den Beruf des Priesters zu ergreifen, kann nur dazu geweiht werden, wenn er die Grundbedingung erfüllt, die Gesetze seiner Kirche anzuerkennen und sich diesen in absolutem Gehorsam zu unterwerfen.
Eines dieser Gesetze wurde weithin als der sogenannte Zölibat bekannt und zum besseren Verständnis als »Opfer um des Himmelreiches willen« übersetzt. Der Zölibat besagt, dass nur derjenige Priester werden darf, der bis zum Lebensende zölibatär, das heißt in vollkommener sexueller Enthaltsamkeit und Keuschheit, leben will und diesen Entschluss zum Beweis der Endgültigkeit mit einem ewigen Versprechen besiegelt.
Sinn des Zölibates ist, das fleischliche Verlangen zu unterdrücken und alle körperliche Energie auf das geistige Ziel der göttlichen Liebe und Nähe zu konzentrieren. Durch den Verzicht auf die Liebe zu einem einzigen Menschen soll der Priester von einer gottähnlichen Vaterliebe für alle Menschen durchströmt und in die unmittelbare Gefolgschaft Jesu berufen werden, dem er vom Zeitpunkt der Weihe an mit Haut und Haar, mit Leib und Seele gehört.
Befürworter des Zölibates sehen in diesem Versprechen eine direkte Parallele zu dem lebenslänglich angelegten Treueversprechen, das Eheleute sich vor dem Traualtar geben, obwohl auch sie nicht in die Zukunft schauen können.
Gegner wenden ein, wer den Zölibat und die Ehe miteinander vergleiche, sei bestenfalls ein Theoretiker mit Kopfwissen, aber kein Praktiker. Zwar setze die Ehe ein Treueversprechen voraus, doch sei dieses nicht wie im Zölibat mit dem Verzicht auf einen letztlich unverzichtbaren Teil des menschlichen Wesens verbunden und daher quasi uneinlösbar. Im Gegensatz zur Ehe komme der Zölibat einer von Gott nie gewollten Selbstverstümmelung gleich.
Ganz gleich, wie umstritten der Zölibat seit seiner Einführung im Mittelalter ist – fest steht, dass die potente Sexualität eines Mannes, der sich zum römisch-katholischen Priester berufen fühlt, nicht automatisch mit der kirchlichen Weihe erlischt. Es erlischt auch sein natürliches Verlangen nach der Liebe einer Frau nicht. Ja, es erlischt nicht einmal sein Augenlicht, sodass er blind würde für die ihm verbotenen Reize, nach denen er sich allen Versprechungen zum Trotz immer wieder sehnt. Folglich muss der Schmerz des Verzichtes und das Opfer der ganzheitlichen Liebe und Hingabe an eine Lebensgefährtin von jedem Priester ständig neu »um des Himmelreiches willen« erbracht werden.
Die meisten jungen Priester bringen dieses Opfer im Eifer für ihr gesellschaftlich exponiertes Amt und ihre außerordentliche Aufgabe als Diener Gottes trotz aller damit verbundenen Nöte über Jahre hinweg in hart erkämpfter Festigkeit.
Wer schwankt, den stärkt und trägt oft die Angst. Erstens die Angst, in Sünde zu geraten und zur Strafe die Gnade Gottes zu verlieren, sodass man nicht mehr zu den wenigen auf geheimnisvolle Weise von ihm Auserwählten und Berufenen gehören darf, sondern in die ewige Verdammnis gestürzt wird. Zweitens die Angst, bereits auf Erden von Papst und Kirche in Scham und Schande verstoßen zu werden.
Aller Moderne und Aufklärung zum Trotz verleiht die Angst vor dem in Ewigkeit Rache nehmenden, strafenden Gott und seinen irdischen Stellvertretern dem Zölibatsgesetz der Kirche bis heute Nachdruck.
Wer das Zeitgeschehen aufmerksam mitverfolgt, weiß, dass die Kirche sich als Konstante im raschen Wandel der Zeitgeschichte versteht. Gott und seine Gebote gelten ewig, und so haben Moderne und Aufklärung kaum Bedeutung.
Erst vor wenigen Monaten schüttelte die Kirche zum Beispiel den Staub des Mittelalters ab. Sie erkannte an, dass sich die Erde tatsächlich um die Sonne dreht, und sprach Galileo Galilei, den Verfechter dieser Theorie, von dem Vorwurf der Gotteslästerung frei.
Von vielen Menschen wird bezweifelt, ob die Kirche jemals realisiert hat, dass der Mensch nicht um der Kirche willen geschaffen wurde, sondern die Kirche um der Menschen willen, und dass der Mensch zwar den Naturgesetzen des Schöpfers unterliegt, nicht aber zwingend den von Menschen gemachten Gesetzen der Kirche. Sollte dies einmal erfasst werden, so wird es nach Meinung von Kirchenkritikern vermutlich im Zeitlupentakt der Ewigkeit geschehen. Und bis dahin bricht wohl das vom Menschen gemachte Gesetz der Einsamkeit im Zölibat das vom Schöpfer gemachte Gesetz der Zweisamkeit in Liebe immer wieder.
Wie schwerwiegend der Eingriff des Zölibates in die Persönlichkeit eines Menschen ist, wird sehr vielen Priestern erst im Laufe der Jahre bewusst. Nur zu oft haben gerade junge Männer, die sich dem Priestertum zuwenden, die Liebe einer Frau nicht kennengelernt, bevor sie ihr Zölibatsversprechen ablegen, und werden quasi jungfräulich zum Priester geweiht. Vielen von ihnen ist daher das Ausmaß des Verzichtes zum Zeitpunkt der Weihe wegen mangelnder Lebenserfahrung gar nicht oder nur unzulänglich bewusst.
Während für den jungen, hoch motivierten, auch hoch engagierten Priester der Ansturm der Hormone noch vergleichsweise leicht in den Griff zu bekommen ist, indem er sich mit aller Energie und Leidenschaft in die Bewältigung einer faszinierenden Aufgabe stürzt und im Rausch der Arbeit und des Erfolges alles andere vergisst oder doch verdrängen kann, setzt mit zunehmender beruflicher Souveränität und Routine das Bewusstsein einer inneren Leere und unerträglichen Einsamkeit den Priester der mittleren und reiferen Jahre oft schachmatt.
Das Wissen um die Entstehung des Zölibatsgesetzes beschäftigt fast jeden Priester irgendwann. Es besteht kein Zweifel daran, dass es kein Gottesgebot ist, sondern erst im Mittelalter zur sittlichen Besserung der sexuell hemmungslosen Geistlichkeit und zur leichteren Handhabung des Kirchenvermögens eingeführt wurde. Daher werden Sinn und Notwendigkeit des Zölibats für die Gegenwart immer öfter bezweifelt. Vor allem die Tatsache, dass der Leidensdruck des zölibatären Lebens durch kirchliche Willkür begründet und nicht im Geringsten gottgewollt ist, schwächt den Widerstand des Priesters gegen die eigene Sehnsucht nach Liebe und Erfüllung.
Viele Priester flüchten sich in die scheinbare Sicherheit des Alkohols oder anderer Drogen. Homoerotische Neigungen werden ausgelebt. Immer öfter werden Priester als Kinderschänder entlarvt. Psychiater und Psychotherapeuten stellen fest, dass zusehends mehr seelisch schwer belastete Priester bei ihnen Hilfe suchen. Aus dem Verstoß gegen den Zölibat und die damit verbundenen moralischen und sittlichen Forderungen der Kirche entsteht gerade in denjenigen, die ihre Berufung ernst nehmen, der Wahn, schuldig vor Gott zu sein. Die innere Zerrissenheit zwischen Schuldgefühlen und der Unfähigkeit, die Forderungen der Kirche zu erfüllen, bringt immer mehr Priester um ihre Selbstachtung und innere Würde.
Der Schmerz der Einsamkeit, die fast unerträgliche Pflicht zu absolutem Gehorsam und zur Unterdrückung der Sehnsucht nach einer Frau und einer Familie sowie der Zwang zur Geheimniskrämerei, zur Lüge und einem in der Kirche absolut verpönten »Pharisäertum« mauern den Menschen hinter der Maske des Priesters bei lebendigem Leibe ein. Und irgendwann bricht alles zusammen.
Plötzlich fliegt es auf, das tragische Geheimnis einer Priesterliebe. Plötzlich halten ein Mann und eine Frau es nicht mehr aus, wegen ihrer Liebe wie Verbrecher im Untergrund leben zu müssen. Halten es nicht mehr aus, bei jedem Rendezvous die Autonummern der Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Hotels oder Restaurants durchsehen zu müssen, ob jemand Bekanntes darunter ist, ehe sie es wagen, sich in einem möglichst dunklen Ecktisch zueinander zu setzen, in einem möglichst abgelegenen Winkel ein Zimmer zu mieten. Halten es nicht mehr aus, einander vor der Öffentlichkeit mit kalten Blicken betrachten zu müssen, einander zu verleugnen, einander zu meiden, nicht dem allerbesten Freund die Wahrheit sagen zu dürfen, Angst vor dem Zufall zu haben, Angst und immer nur Angst. Halten es nicht mehr aus, ihren Kindern den Vater vorenthalten und verheimlichen zu müssen. Irgendetwas bringt das Fass zum Überlaufen. Und da ist es, das öffentliche Bekenntnis, aller Angst zum Trotz, weil die Not des Verheimlichens schließlich größer ist als die existenzielle Not als Konsequenz der verbotenen Liebe.
In Pfarrämtern und Klöstern lebende Priester, die ich selbst anlässlich meiner Buchprojekte befragen konnte, schätzen, dass weltweit mindestens jeder Dritte von ihnen dauerhaft nicht zölibatär lebt und wenigstens eine heimliche Geliebte, meist auch ein oder mehrere heimliche Kinder hat.
Als ich zum Beispiel vor einiger Zeit Gast einer Talkshow des Saarländischen Fernsehens war und ein amtierender Priester gesucht wurde, der zölibatstreu lebt und den Zölibat verteidigt, mussten der Sender und ich erleben, dass sich kein einziger der befragten Pfarrer dazu bereit erklärte und auch keinen Kollegen empfehlen wollte, weil jeder befürchtete, es könne womöglich eine Zuschauerin anrufen und »aus der Schule plaudern«. Die Sache der Kirche vertrat schließlich der Rundfunkpfarrer, und dieser lehnte den Zölibat ab.
Konkreter rechnet Richard Sipe es in seiner 1988 erstmals in Washington, D.C. vorgestellten und 1990 in New York unter dem Titel »A Secret World: Sexuality and the Search for Celibacy« veröffentlichten Studie vor. Fazit dieser einen Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren umfassenden Studie ist, dass weltweit
über 200.000 amtierende katholische Priester sexuell fest liiert sind.weitere acht Prozent gelegentlich sexuell liiert sind.nur zehn Prozent immer zölibatär leben.Auf den Durchschnitt umgerechnet besagen diese Zahlen, dass nicht nur jeder dritte, sondern sogar jeder zweite Priester schwerwiegende Probleme mit dem Zölibat hat.Davis Rice bestätigt diese Zahlen in seinem Buch »Kirche ohne Priester« und fügt hinzu, dassseit über zwanzig Jahren alle zwei Stunden ein geweihter katholischer Priester seine Kirche wegen der Liebe zu einer Frau für immer verlasse.in Peru achtzig Prozent aller Priester eine Frau haben.auf den Philippinen mindestens fünfzig Prozent aller Priester eine Frau haben.in Zaire alle Priester mindestens eine Frau haben.weltweit 100.000 geweihte Priester verheiratet sind.Auch die amerikanische Vereinigung katholischer Ex-Priester, »Corpus«, sowie die deutsche Selbsthilfeorganisation »Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen« stimmen diesen Zahlen zu. Nach einer Untersuchung des Ex-Priesters Hubertus Mynareck leben allein in Deutschland etwa 6.000 amtierende Priester mit Frauen zusammen.
Leider sind keine Statistiken über die Anzahl von Priesterkindern bekannt. Um möglichst realistisch zu schätzen, halte ich mich an die oben zitierten Zahlenangaben.
Allein in Deutschland leben derzeit etwa 7.000 verheiratete und 6.000 sexuell liierte Priester. Weltweit sind es rund 100.000. Insgesamt machen sie etwa ein knappes Fünftel der gesamten Priesterschaft aus. Da Priesterehen im Allgemeinen kinderreich sind, gehe ich von einem Durchschnitt von zwei Kindern pro Paar aus. Obwohl mir bewusst ist, dass ein hoher Prozentsatz dieser Ehen vor der Kirche als ungültig angesehen wird, da sie ohne ausdrückliche Heiratserlaubnis des Papstes geschlossen wurden, und obwohl mir außerdem bewusst ist, dass viele der in diesen Ehen lebenden Kinder über Jahre hinaus geheime Kinder waren, bezeichne ich die Kinder verheirateter Priester hier zur besseren Unterscheidung als »legal« und nur die Kinder aus einer geheimen Beziehung als »verleugnet«.
»Legale« Priesterkinder, deren Väter sich entweder von Anfang an oder später zu ihnen und den Müttern bekannten und geheiratet haben, gäbe es demnach in Deutschland mindestens 14.000 und weltweit mindestens 200.000.
»Verleugnete« Priesterkinder stammen aus Beziehungen von bis heute amtierenden Priestern. Geht man davon aus, dass nicht jedes, sondern vielleicht nur jedes dritte der 6.000 allein in Deutschland und der weltweit etwa 200.000 in einer festen heimlichen Beziehung lebenden Paare Kinder hat, so wären dies in Deutschland etwa 2.000 und weltweit nochmals mindestens 60.000 bis 70.000 »verleugnete« Kinder. Nicht gerechnet all jene Kinder, die niemals auf die Welt kamen, weil sie aufgrund der Zölibatspflicht abgetrieben wurden.
Wie man unschwer an den Kirchenskandalen der neunziger Jahre erkennt – ich denke hier an Beispiele wie den deutschen Jesuitenpater Rupert Lay oder den schottischen Bischof Roderick Wright –, haben zahlreiche Priester im Laufe ihres zölibatären Lebens nicht nur eine, sondern mehrere Frauen und mit diesen jeweils auch Kinder. Die Anzahl von weltweit 60.000 bis 70.000 »verleugneten« Kindern ist daher mit Sicherheit nicht zu hoch, sondern eher viel zu niedrig angesetzt.
Alles in allem ergibt die Summe der »legalen« plus der »verleugneten« trotz des Zölibates von geweihten katholischen Priestern gezeugten Nachkommenschaft allein in Deutschland mindestens 16.000 und weltweit mindestens 270.000 Kinder, wahrscheinlich aber noch mehr. Die letztgenannte Anzahl entspricht der Einwohnerzahl kleinerer Großstädte.
Für die Kirche sind es freilich nur »ein paar« Kinder. Wies mich doch jüngst ein Weihbischof in einer Fernsehtalkshow des WDR mit dem Titel »Mittwochs live«, zu der ich zum Thema »Priesterkinder« eingeladen war, mit der bösen Bemerkung zurecht: »Ach, haben Sie sich doch nicht so mitleidig mit den paar Kindern!«
Wer dies für herzlos hält, dem könnte man etwas sarkastisch entgegenhalten, er unterschätze wahrscheinlich, wie viel die Kirche damit zu tun hat, ungeborenes Leben zu schützen und Abtreibungen zu verhindern sowie Kondome und andere Verhütungsmittel zu verbieten und Frauen zurück an den Herd zu beordern, damit man die Arbeitslosigkeit, den Sittenverfall, die Gottesstrafe der großen neuen Seuchen und endlich auch den Rückgang der Kirchensteuer wieder in den Griff bekommt. Zeit, Geld und Herz für »ein paar« Priesterkinder ist angesichts der Vielfalt der Pflichten vermutlich ganz einfach nicht mehr drin.
Priesterkinder sind für die Kirche Roms ganz offensichtlich kein Thema. Warum auch? Schließlich ist eine solche Ignoranz beste Kirchentradition.
Die Geschichte lehrt, dass das Kind eines Priesters seit Durchsetzung des Zölibats im Mittelalter automatisch und lebenslang ein Kirchensklave war, ein rechtloses, verkäufliches, ausbeutbares Wesen, das von jeder Erbfolge ausgeschlossen und dem die Fortpflanzung bei Todesstrafe verboten war.
Heute lässt sich dieser Sklavenstatus nicht mehr aufrechterhalten. Um wenigstens eine Art Kainsmal aufzubringen, kennzeichnet die Kirche das Kind eines Priesters, der nicht mit dem Segen und der Zustimmung des Papstes in den Laienstand zurückversetzt wurde und daher nicht kirchlich getraut werden konnte, auf einschlägige Weise. Sie verleiht ihm den lateinischen Titel eines »Sacrilegus«, was frei übersetzt etwa »Tempelschänder« bedeutet.
Dass diese Sicht der Dinge bis heute Gültigkeit hat, beweist eine Alimentenklage, die Gisela Forster, die Mutter Thomas Forsters, im Namen ihrer Kinder gegen die katholische Kirche führte und – verlor. In einer der entscheidenden Verhandlungen begründete einer der Vertreter der Kirche die Ablehnung der Zahlung mit dem Vergleich, dass die Beziehung einer Frau zu einem Priester mit einem »Bankraub« identisch sei.
Vor dem Hintergrund dieser Definition muss die Kirche vermutlich mit der Sparkasse Gottes verglichen werden. Der Priester wäre demnach das auf der Bank anzulegende Kapital. Eine Frau, die eine Liebesbeziehung zu diesem Priester eingeht, wäre logischerweise eine Bankräuberin, die gleichzeitig mit dem Kapital auch die Zinsen raubt, indem sie die Vermehrung des Kapitals in Gestalt von Priesterkindern betreibt. Bleibt man in diesem Denkmuster, würde das Zahlen von Alimenten für das Kind eines Priesters aus der Sparkasse Gottes bedeuten, einer Bankräuberin zusätzlich zur Beute eine Rendite auf dieselbe auszuschütten.
Mit dieser anschaulichen Erklärung, warum die Kirche keine Alimente für Priesterkinder zahlt, jedoch nicht genug. Aus dem Vergleich des Kirchenanwalts geht auch hervor, dass eine Frau, die sich auf eine Beziehung mit einem Priester einlässt, stets eine gemeine Verbrecherin ist, die sich aus niedrigen Beweggründen über fremdes Eigentum hermacht. Da »fremdes Eigentum« keine Schuld daran trifft, wenn es geraubt wird, ist der Priester selbstverständlich als unschuldiges und wohl auch bedauernswertes Opfer der bösen Räuberin anzusehen.
Im strengen alttestamentlichen Sinne geht es bei den Bankern der Bank Gottes »Auge um Auge und Zahn um Zahn« zu. Wer etwas aus dem Kirchenschatz raubt, bricht das Gesetz des Kirchenstaates und ist ein Gangster. Da gibt es kein Pardon.
Da der Kirchenstaat souverän ist, wird sein Gesetz ebenso souverän gegen einen Gesetzesbrecher angewandt, wie jeder andere Staat sein eigenes Gesetz beispielsweise gegen Drogendealer deutscher Herkunft anwendet und diese zur Todesstrafe verurteilt, obwohl es in Deutschland keine Todesstrafe mehr gibt.
Und wie jeder andere Gangster muss auch eine Frau, die widerrechtlich in das Hoheitsgebiet der Kirche eindringt und einen Priester »raubt«, mit den kirchlichen Folgen der bösen Tat fertigwerden. Eine Schwangerschaft, die vor dem Gesetz der Kirche als Teil des »Raubes« gilt, bleibt daher ihr alleiniges Risiko.
Damit die Sünde der Mutter auch wirklich bis ins siebte Glied gerächt und das Erbsünde-Dogma kirchengetreu Anwendung findet, erfasst das Kirchengesetz selbstverständlich auch das Kind und bewirkt, dass es nicht das geringste Anrecht auf seinen der Kirche »geraubten« Vater hat.
Wie der Prozess zeigt, den Gisela Forster gegen die Kirche führte und verlor, kann nicht einmal der weltliche Staat – der die Gleichheit aller Menschen garantiert und der manifestiert hat, dass ein leiblicher Kindesvater seinem Kind Unterhalt in Form von Alimenten zu zahlen hat – die Kirche zwingen, ihre Unterhaltspflicht gegenüber einem ihrer zu Armut und demütigem Gehorsam verpflichteten Priester auf dessen Kind auszudehnen.
Dies heißt nicht, dass weltliches Recht durch Kirchenrecht gebrochen werden könnte und kein Priester Alimente zahlen müsse. So simpel, dass Priester gleich Priester und Priesterkind gleich Priesterkind wäre, ist die Sache nicht.
Nehmen wir etwa einen Priester, der als Pfarrer tätig ist und über ein eigenes Einkommen verfügt. Würde ihn die Mutter seines Kindes – was selten geschieht – als Vater benennen und anzeigen, müsste er von seinem eigenen Einkommen Unterhaltszahlungen leisten und gleichzeitig sein »Abenteuer Frau« im Sinne der Kirche bereinigen oder sein Amt aufgeben.
Dass eine solche Bereinigung trotz des Öffentlichwerdens der Liebesbeziehung und deren Folgen möglich ist, zeigte sich 1996 brandaktuell an dem Beispiel des schottischen Bischofs Roderick Wright, der zwar ein Kind mit einer Frau hat und mit einer anderen ein Verhältnis, jedoch weder die eine noch die andere zu heiraten beabsichtigt und daher in Amt und Würden verbleiben kann. Dass eine derartige Handhabung einen weiteren Akt der Diskriminierung der Frau darstellt, die von ihrem Priester-Geliebten um das Angebot des »Linsengerichtes« in Form des Priesteramtes verlassen werden soll, erschließt sich dem unbeteiligten Beobachter erst im Nachhinein.
Stellen wir uns hingegen einen Priester vor, der einem Klosterorden angehört und vor seiner Weihe ein Armutsgelübde abgelegt hat, welches besagt, dass er niemals Geld besitzen wird.
Ein solcher Priester muss auch dann keine Alimente zahlen, wenn er einen bezahlten Beruf ausübt. Als Folge des Armutsgelübdes ist nämlich das von einem Mönch eingebrachte Einkommen von Anbeginn an Besitz der Kirche. Dem das Einkommen erbringenden Mönch steht kein Pfennig davon zu. Von einem mittellosen Mann aber kann kein Unterhalt bezogen werden. Und von der Kirche schon gar nicht. Zwar ist sie für den kompletten Lebensunterhalt eines Mönches zuständig, aber nur bei dessen Wohlverhalten. Da das Zeugen von Kindern kirchengesetzlich verboten und unter Strafe gestellt ist, ist keine entsprechende Versorgungsleistung vorgesehen. Folgerichtig gehen Mutter und Kind leer aus und der Mönch entweder zurück unter Klosterverschluss oder ärmer als jede Kirchenmaus ins Leben hinaus.
In vielen Fällen haben die unmittelbaren Vorgesetzten langfristig Kenntnis von einer oder immer wieder neuen Liebesaffären eines Priesters und bewahren Stillschweigen darüber. Solange niemand öffentlich Anklage erhebt, wird die Affäre als »Abenteuer« angesehen, das sich hoffentlich von selbst erledigt und gar nicht erst außerhalb der Beichte zur Kenntnis genommen werden muss.
Ist die »sündige Liebe« des Priesters und seiner Geliebten, der »Tempelräuberin«, jedoch erst einmal ruchbar geworden und nicht mehr zu vertuschen, mahlt das Räderwerk der Kirchengewalt erbarmungslos.
Statt ihrer christlichen Aufgabe gerecht zu werden, einem in Not geratenen Menschen aufzuhelfen und beizustehen, stößt die Kirche den Priester wie Luzifer als gefallenen Engel in mitleidloser Härte aus ihrem Schoß, hinaus in die Welt und oft genug ins Elend.
Jeder Priester, der sich zu einer Liebesbeziehung und Vaterschaft bekennt und definitiv erklärt, heiraten zu wollen, wird umgehend seines Amtes enthoben, und es wird ihm fristlos gekündigt. Da es für ihn keinen Kündigungsschutz gibt, steht er, ohne Beruf und meist fast mittellos, von heute auf morgen auf der Straße.
In der Öffentlichkeit ist es weithin unbekannt, dass die Kirche für ihre Priester weder Arbeitslosen- noch Rentenbeiträge in die entsprechenden staatlichen Versicherungen zahlen muss, sodass ein entlassener Priester weder auf die eine noch die andere Absicherung Anspruch hat, obwohl er im Allgemeinen viele Jahre in einer hoch dotierten Position tätig war.
In jüngeren Jahren gelingt es einem aus dem Amt entlassenen Priester mit persönlichem Einsatz vergleichsweise gut, sein Leben neu zu organisieren. In reiferen Jahren ist es oft genug das Aus für das Arbeitsleben und somit – ohne die geringste Absicherung auf der Basis einer Vorsorgeleistung – auch das Ende der wirtschaftlichen Existenz.
Da jeder Priester seinen Beruf nicht etwa als Job versteht, sondern in ihm eine Berufung zum Höchsten wahrnimmt, wiegen das Verstoßenwerden vom »Tisch des Herrn« und das damit verknüpfte Verbot der Berufsausübung besonders schwer. Selten wird der Verlust der »Professio« als Berechtigung zum Dienst am Altar eines Tages verschmerzt. Umso weniger, als die Weihe eines Priesters unwiderruflich ist und auch der seines Amtes enthobene Priester zeit seines Lebens Priester bleibt und nichts lieber wollen würde, als seines Amtes weiterhin zu walten.
Mehrheitlich ist die Geliebte eines Priesters ebenfalls im kirchlichen Dienst tätig, sodass bei Bekanntwerden der Beziehung auch ihr, meist noch schneller als dem Priester selbst, fristlos gekündigt und die Ausübung ihres Berufes in jedweder kirchlichen Einrichtung dauerhaft verwehrt wird. Anders als im Falle des Priesters gibt es für eine Frau auch dann keine Wiedereingliederung in ihr Berufsleben im Dienst der Kirche, wenn sie ihre zum Stein des Anstoßes gewordene Beziehung auflöst.
Arbeitslos, ohne Perspektiven, meist von der Großfamilie verpönt und gemieden, als Schandfleck empfunden, sozial im Abseits und alleingelassen, wissen Mutter und Priestervater von nun an meist jahrelang kaum, wie sie ihre Familie am Leben erhalten sollen. Zu aller materiellen Enge kommt nur zu oft hinzu, dass ein in Weltabgewandtheit, totaler Bevormundung und Versorgung zu leben gewohnter Priester sich in der Welt »draußen« nur schwer zurechtfinden kann. Wie ein Kind muss er Selbständigkeit, Eigenverantwortung und Selbstversorgung erlernen. Dazu gehören solch alltägliche Kleinigkeiten wie einkaufen, Bankgeschäfte tätigen, Wäsche waschen, bügeln, etwas kochen oder einen beliebigen Job annehmen, um Geld zu verdienen. Aber auch ungewohnte zwischenmenschliche Aufgaben wie das Versorgen eines Kindes und das räumliche Zusammenleben mit Frau und Kindern fallen schwer. Was Wunder, dass die Geheimhaltung einer verbotenen Liebe so viel leichter zu verkraften zu sein scheint?
Wer sich jemals kritisch mit dem Problem des Zölibats auseinandergesetzt hat, weiß, dass jeder in einer geheimen Beziehung lebende Priester, der als Pfarrer ein Gehalt bezieht, seine heimliche Familie auf vielfältigste Weise mitfinanziert. Sei es, dass er namens der Kirche der bedürftigen alleinerziehenden Mutter als milde Spende ein Auto oder Möbel schenkt; sei es, dass man einem armen Halbwaisenkind eine Urlaubsreise ermöglicht oder es dazu einlädt und mitnimmt; sei es, dass ein musikalisches Kind durch das Geschenk eines teuren Instrumentes gefördert wird oder eine solide Ausbildungsversicherung erhält; sei es, dass eine regelmäßige monatliche Unterstützung der Familie über einen unverdächtigen Mittelsmann zustande kommt – abgesehen von der nirgendwo vermerkten Barleistung unter der Hand gibt es auch für einen Priester viele unverfängliche Möglichkeiten, die Kirche für seine verbotene Familie zur Kasse zu bitten.
Es gibt sogar als Pfarrer tätige Priester, die mit dem Einverständnis der Kirche Alimente zahlen und im Gegenzug dafür versprochen haben, weder zu der Mutter noch zu ihrem Kind oder ihren Kindern jemals persönlich Kontakt aufzunehmen. Hier zeigt sich die Kirche von ihrer großzügigen Seite und vergibt dem unschuldig verführten Opfer einer skrupellosen »Bankräuberin« seine eingestandene und augenscheinlich bereute Sünde sofort.
Dass einige Pfarrer mehrmals in Sünde fallen und an mehreren verschiedenen Wirkungsstätten verlassene Frauen und Kinder haben, wird ebenfalls verziehen. Hauptsache, es kommt zu keiner Ehe. Alle anderen Sündenfälle sind lässlich. Schließlich ist kein Mensch vollkommen, auch ein nach dem Höchsten strebender Priester nicht.
»Glücklicherweise« bedeutet es jedoch selbst dann noch nicht immer das absolute Aus für einen Priester, wenn es zu einer Ehe kommen sollte. Da nur sehr wenige Priester mit dem Segen des Papstes in den Laienstand zurückversetzt werden und folglich sehr selten ausdrücklich eine Erlaubnis zur kirchlichen Trauung erhalten, werden die meisten Priesterehen nur standesamtlich geschlossen. Zwar akzeptiert die Kirche den Willen des weltlichen Gesetzgebers und toleriert eine solche Bindung. Im Sinne des Kirchengesetzes aber hat eine Ehe, die nicht vor Gott und Altar geschlossen wurde, keine Bedeutung. Daher lebt ein nicht in den Laienstand zurückgeführter, standesamtlich getrauter Priester, der mit seiner Frau Tisch und Bett teilt, permanent in Sünde. Im Fall des Falles gilt seine Ehe jedoch nur als verzeihlicher »Versuch einer Ehe«. Wenn er bereut, seine Frau verlässt und wieder in den Schoß der Kirche zurückkehrt, wird ihm vergeben.
Ähnlich wäre es, wenn der reuige Sünder nachwiese, dass er seine Hochzeit von Anfang an nur als Farce und Hokuspokus betrachtet und niemals ernst genommen hat. Schon das Ausleihen eines schwarzen Anzugs in einem Kostümverleih oder entsprechende lächerlich machende Äußerungen vor einem Zeugen könnten hinlänglich Grund dafür liefern, diese Ehe zu annullieren.
So versöhnlich Mutter Kirche ihrem unschuldigen »geraubten« Sohn gegenübersteht, so unversöhnlich gibt sie sich seiner ebenfalls »geraubten« Nachkommenschaft gegenüber. Für das geheime Kind eines Priesters gibt es keinen Vater.
Dies ist anders, als wenn der Vater eines beliebigen Kindes niemals da ist, niemals kommt. Ein ständig abwesender Vater kann als Mann mit einem bestimmten Namen, einer bestimmten Identität, einem bestimmten Foto in einem Album existent sein. Selbst wenn dieser Vater tot wäre und das Kind ihn niemals kennengelernt hätte, könnte das Kind ihn durch die Augen der anderen verinnerlichen, die sich an ihn erinnern. Selbst ein der alleinerziehenden Mutter tatsächlich unbekannter oder von ihr aus tiefster Seele abgelehnter Vater kann insofern präsent sein, als über ihn gesprochen, diskutiert werden kann. Ein Priester als Vater aber ist »top secret«.
Wann immer ein Priesterkind nach seinem Vater fragt – und ab einem gewissen Alter wird es dies tun und intensiv zu forschen beginnen –, muss die Mutter schweigen. Vor allem dann, wenn der Vater dem Kind als Person bekannt, vielleicht sogar mit ihm bestens vertraut ist. Verriete die Mutter, wer der Vater ist, hätte dies schwerwiegende berufliche, finanzielle, soziale und private Folgen für die ganze Familie. So wird und kann sie ihrem Kind nicht den geringsten Hinweis auf den Vater geben. Ja, sie wird jedes Gespräch über ihn zu meiden versuchen und alles daransetzen, dass das Kind an diesen Vater nicht mehr denkt.
Der Vater wiederum wird sein Kind möglicherweise jeden Tag erleben. Aber nie darf er sich zu erkennen geben, nie dem Kind seine Liebe im echten Maße zeigen, nie sich selbst vor anderen zu seinem Kind bekennen.
Erfährt das Priesterkind eines Tages schließlich doch, wer sein Vater ist, beginnt erst recht eine schwere Zeit. Nun prägt das Geheimnis um den Vater selbst den Schlaf, in dem man nur ja nicht sprechen darf.
Jedes geheime Priesterkind lernt, zu verdrängen und zu unterdrücken, skeptisch und introvertiert zu sein. Es lernt, mit vielen Worten nichts preiszugeben und durch Schweigen zu schützen. Es lernt, dass man leichter durchs Leben kommt, wenn man die Wahrheit nicht gerade in eine Lüge verwandelt, aber doch ein wenig passender macht. Es lernt, dass es keine festen Wurzeln, keinen echten Ursprung im Leben hat und beginnt, sich selbst als Randfigur wahrzunehmen. Wenn es die Mutter in den häufigen Schwierigkeiten ihres Doppellebens oft unglücklich und überfordert sieht, nimmt es sich selbst schnell als Auslöser des Problems an. Um ihre Last zu erleichtern, nimmt sich das Kind in einem seinem Alter unangemessenen Ausmaß zurück, bemüht sich, brav zu sein, keine Probleme aufzuwerfen, vernünftig und selbständig zu sein. Dabei erfährt es sich selbst notgedrungen als anders als die anderen, was vor allem in der Entwicklungsphase des Cliquenalters schmerzlich bewusst ist und abermals ein Dasein als Randfigur und Außenseiter provoziert.
Dem Vater gegenüber muss das verbotene Kind Disziplin lernen. Es darf sich nicht hinreißen lassen, den Vater sichtbar zu lieben. Es darf nicht eifersüchtig werden, wenn andere Kinder um ihn sind und er zu diesen freundlicher, herzlicher und unbefangener ist als zu seinem eigenen Kind. Niemals kann sich das Priesterkind mit dem Papa brüsten, niemals ihn zur Hilfe rufen, niemals erzählen, dass es ihn gibt. Wenn es befragt wird, muss es einen erfundenen Vater beschreiben. Oder es muss so tun, als mache es ihm nicht das Geringste aus, ohne Vater zu sein. Nähe zu diesem verbotenen, geheimen Vater gibt es für ein Priesterkind meist nur auf der gedanklichen Ebene. Gedanken sind frei, das wenigstens gilt auch für einen Priester. Und da dies die einzige Freiheit ist, die er leben kann, sind der Kopf und die Macht des Wissens für ihn auch die Wege der Liebe. Für ein Kind, das in den Arm genommen und mit allen Sinnen Liebe empfangen will, ist solch eine Kopfliebe nicht genug. Und so fühlt es sich kaum jemals wirklich von seinem Priestervater geliebt und angenommen und gerät in den Strudel der Selbstwertprobleme, oft auch der Lebensangst.
Thomas Forster steht als Beispiel für unzählige Priesterkinder in aller Welt. Er ist ein bemerkenswerter junger Mann. Darum lade ich Sie, liebe Leserin, lieber Leser, ein, sich zusammen mit mir auf ein Schicksal einzulassen, das von der Suche nach einem Vater geprägt ist, der – wie die Mutter sagte – vom Papst in Rom gefangen gehalten wurde.
Karin Jäckel
Ich bin ich, ein Individuum, ein auf dieser Welt einmaliges Lebewesen, ein winziges Rädchen im großen Räderwerk des Universums und ein Geschöpf, das der Gott, an den ich glaube, ebenso beim Namen rief, wie er jedes andere beim Namen ruft und sagt: Du bist mein. Und gäbe es mich nicht, so wäre die Welt eine andere, denn sie ist nur die, die wir wahrnehmen, weil sie ist, wie sie ist.
Mein Name ist Thomas. Genauer gesagt: Thomas Johannes.
Den zweiten Namen gab meine Mutter mir zur Erinnerung an den Lieblingsjünger Jesu, zugleich aber auch zur Erinnerung an eine ihrer Freundinnen, die schon sehr jung ein Baby bekam und es trotz mancher Schwierigkeiten schaffte, ihr Kind ohne Vater großzuziehen. Der Name Johannes sollte Mut machen, meiner Mutter ebenso wie mir.
Den Namen Thomas gab mir mein Vater, weil der Tag meiner Geburt der Weiße Sonntag war, an dem die Geschichte des ungläubigen Thomas aus der Bibel vorgelesen wurde. Mein Vater las die Messe, danach besuchte er meine Mutter und mich zum ersten Mal im Krankenhaus. Natürlich gab er sich dabei nicht als mein Vater zu erkennen. Und meine Mutter hoffte, dass meine Ähnlichkeit mit ihm niemandem auffallen würde.
Inzwischen bin ich neunzehn Jahre alt. Und ganz gleich, wie ähnlich ich manchen Leuten auch bin oder geworden sein mag oder noch werde, so bin ich doch noch anders. Ich bin in meinem ganzen Wesen und Denken anders als die meisten, die ich kenne. Nehmen wir zum Beispiel die Suche nach dem Sinn des Lebens. Es gibt diejenigen, die sich keine Gedanken darüber machen; vielleicht weil sie noch nie auf die Idee gekommen sind, dass man sich darüber überhaupt Gedanken machen könnte. Es gibt die anderen, die sich unentwegt darüber Gedanken machen und daran zerbrechen. Und es gibt mich. Ich mache mir weder keine noch unentwegt Gedanken darüber, denn ich bin mir mit meinem ganzen Sein meines Zieles und damit dem Sinn meines Lebens bewusst.
Es ist kein Ziel, das ich konkret aussprechen könnte. Es ist eher ein Ziel, das ich fühle und das mich ganz ausfüllt mit dem weit über Gedanken hinausreichenden Wissen: Ich habe auf dieser Welt etwas zu tun. Etwas, das mehr ist als eine Sache, eine Aufgabe, ein Einzelnes. Es lässt sich vielleicht unter einem Oberbegriff zusammenfassen: Kreativität.
Damit meine ich, etwas schaffen, was es vorher noch nicht oder nicht in dieser Konstellation gegeben hat und nicht gegeben haben kann, weil das Ich des Schaffenden vor oder auch während meiner Lebenszeit ein anderes war oder ist als ich. Ich meine damit, Gedanken denken, von denen ich vorher noch nicht gewusst habe, dass man diese überhaupt denken kann, und mit ihnen Spuren ziehen, die mein Leben prägen und dadurch, wie mein Leben selbst, Rädchen sind im großen Räderwerk des Seins.
Ich glaube, dass ich lebe, weil mein Leben dieses innere Ziel hat und Gott will, dass ich lebe, um es ganz oder zumindest bis zu einem gewissen Grad zu erreichen. Wobei die Bestimmung, wann dieser Grad erreicht ist und mein Leben sein Ziel erfüllt hat, bei Gott liegt.
Obwohl mein Leben aus meiner Sicht also ein gottgewolltes ist, wäre ich nie gezeugt und nie geboren worden, wenn es nach dem Willen des Stellvertreters Gottes auf Erden, dem Papst, gegangen wäre, denn in seinen Augen bin ich nicht von Gott gewollt, sondern Gott geraubt worden.
Geraubt, weil das Spermafädchen, das in einem Akt grenzenloser Liebe und Leidenschaft aus dem Schoß meines Vaters in den meiner Mutter drang, um sich dort mit einer ihrer aufnahmebereiten Eizellen zu vereinigen und schließlich mich hervorzubringen, aus dem Besitz der Kirche stammte.
Nein, nein, ich denke nicht an künstliche Befruchtung oder gentechnische Machenschaften. Der Spermafaden meines Vaters stammte einzig deshalb aus dem Besitz der Kirche, weil mein Vater ein katholischer Priester und Mönch ist, dessen Körper und Seele Besitz Gottes sind, welcher von der Kirche als Hüterin des Gottesreiches auf Erden mithilfe strenger Gesetze verwaltet wird, damit nicht der kleinste Teil des Gottes-Schatzes an einen Menschen verschwendet werde.
Nach Auffassung der katholischen Kirche begingen mein Vater, indem er seinen Gott gehörenden Samen veruntreute, und meine Mutter, indem sie diesen in sich aufnahm, ein gemeinsames Verbrechen gegen die Kirche und eine unverzeihliche Sünde gegenüber Gott. Ich selbst bin für die Kirche das sichtbare Ergebnis dieses schändlichen Verbrechens und trage daher das Stigma eines Lebens ohne Daseinsberechtigung.
Wollte ich glauben, dass die Kirche mit dieser Meinung recht hat, so wäre Gott mein schlimmster Feind, den ich über den Tod hinaus zu fürchten hätte. Ich müsste meine Eltern sehen wie Adam und Eva nach dem verbotenen Griff nach einem Apfel vom Baum der Erkenntnis, ihrem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies. Ich müsste leiden an meiner Existenz und der Erbsünde, durch die ich niedergedrückt würde. Ja, vermutlich müsste ich Gott jede Sekunde dreimal um meinen Tod bitten, damit meine arme Seele im Feuer der Hölle geläutert werde.
Wahnsinn!
Es beschäftigt mich nicht und macht mir nichts aus, auf welche Weise andere mit der Frage nach dem Sinn des Lebens umgehen. Ich fühle keinen missionarischen Eifer, will niemanden davon überzeugen, dass Gott existiert. Es mag sogar sein, dass jeder Mensch einen eigenen Gott hat oder auch keinen. Ganz gleich, wie und worin er diesen erkennt oder nicht erkennt – für mich hat es letztlich keine Bedeutung. Warum sollte es in der unvorstellbaren Vielfalt des Lebens unmöglich sein, dass es für den einen Menschen einen Gott gibt und für einen anderen nicht? Und dass beides nebeneinander oder jede beliebige Variante davon gleichwertig existiert und dann eben auch im Sinn des großen Räderwerks funktioniert?
Ich weiß nur, dass es Gott für mich gibt und er mein bester Freund ist, dessen Freundschaft ich nicht durch irgendwelche Leistungen erwerben muss. Er ist da und tut das Seine, so wie ich das Meine tue, und ich vertraue ihm, auch wenn ich mal nicht verstehen sollte, was läuft. Um dies zu spüren und ganz tief zu erkennen, brauche ich keine Kirche und keinen Papst und keine Messe und keinen Priester und auch kein Kirchengesetz.
Dies alles war für mich nicht immer so.
Die längste Zeit meines Lebens habe ich Gott nicht deutlich erkannt. Ich war mir immer unsicher, ob es ihn gibt, und tendierte zu der Meinung, dass die Schöpfung eine eher zufällige und Gott die geniale Erfindung einiger machtgieriger Führungspersönlichkeiten sei, die die menschliche Neigung zum Übernatürlichen als besonders wirksame Methode der Machtergreifung ausbeuteten.
Als unbekannte Größe im Sinne eines bedeutenden Diskussionsthemas war Gott für mich allerdings immer vorhanden. Schließlich war er derjenige, der maßgeblich und unausweichlich in mein Leben eingriff, ob es ihn nun gab oder nicht. Allein die Tatsache, dass es einschneidende Ereignisse gab, die an mir in seinem Namen durchgeführt wurden und mein Leben prägten, ließ nicht zu, dass ich ihn übersehen oder verdrängen konnte. Ich hätte ihn allenfalls verleugnen können, doch niemals einfach ignorieren.
Mein Vater ist Priester. Und noch ehe ich wusste, dass mein Vater Priester ist, wuchs ich mit dem Wissen auf, dass mein Vater nie bei mir war, weil der Papst in Rom ihn gefangen hielt und nicht zu mir kommen ließ. Der oberste »Boss« für jeden Priester und auch für den Papst aber ist Gott.
Wie sollte ich da leben, ohne Gott wenigstens zu denken?
Meine Mutter ist eine wunderbare Frau. Stark, fest und doch warmherzig-weich, klug und gebildet, engagiert und tapfer. Ich habe nie erlebt, dass sie mich einmal geschlagen oder jemals im Stich gelassen hätte. Und wenn ich mich auf ihre für mich herausragendste Eigenschaft festlegen müsste, so würde ich sagen, dass es ihr Bemühen um Menschlichkeit und ihr Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Leben ist.
Sie war Mitte zwanzig, als sie meinen Vater kennenlernte. Blond gelockt, attraktiv und durch und durch positiv denkend, so eroberte sie mit der ihr bis heute eigenen tatkräftigen Lebensfreude sein Leben.
Wiewohl deutlich älter als meine Mutter, war auch mein Vater damals noch jung, dynamisch und voll charismatischer Kraft, der sich niemand entziehen konnte, der mit ihm in Kontakt trat. Erst seit wenigen Jahren mit seiner Ausbildung fertig, war er nach kurzer Einführungszeit zum Direktor der Klosterschule ernannt worden, die sein Lebenswerk werden sollte. Ihrem Aufbau widmete er sich mit Begeisterung.
Da mein Vater Lehrer aus Leidenschaft war, sah er die höchste Freude darin, junge Menschen zu verantwortungsvollen Erwachsenen heranzubilden. In seinem klösterlichen Vorgesetzten, dem Abt, stand ihm ein verständnisvoller Begleiter zur Seite, der ihm zugleich herzlich zugetan war. Dank seiner Unterstützung wurde mein Vater trotz seines Klosterlebens großzügig mit allen Freiheiten und Verantwortlichkeiten seiner beruflichen Führungsposition ausgestattet.
Er nutzte beides, um sich zuerst einmal ein ganz neues, junges, hoch motiviertes Kollegium aufzubauen. Entsprechend der klösterlichen Führung musste dieses zwar zutiefst christlich eingestimmt sein und eine angemessene Lebensweise pflegen. Diese Lebensweise war jedoch weltlich orientiert. Das heißt, die meisten Lehrerinnen und Lehrer waren verheiratet und hatten Kinder, die zu gegebener Zeit fast alle in der Klosterschule eingeschult wurden. Von dem vormals nur aus Klostermännern bestehenden Kollegium blieben nur wenige Mönche als Lehrer übrig. Unter der integrativen Führung meines Vaters gelang es ihnen schnell, mit den anderen Lehrkräften eine verschworene Gemeinschaft zu bilden. Alle zogen an einem Strang, um die Schule zu neuem Glanz zu bringen.
Meine Mutter hatte damals gerade ihr Diplom als Bildhauerin und Architektin mit zusätzlicher Lehrberechtigung erworben. Obwohl sie in der Abschlussphase ihres Studiums schwanger geworden war, heiratete und meinen älteren Halbbruder Magnus zur Welt brachte, den sie überwiegend selbst zu versorgen hatte, meisterte sie ihre Prüfungen mit Bravour.
Eine sichere Zukunft in der Großstadt winkte. Gemeinsam mit ihrem Ehepartner, der ebenfalls Architekt war, hätte sie sich leicht selbständig und ihren Weg machen können. Gerade dieser rein materialistische Plan passte jedoch nicht in das Lebenskonzept meiner Mutter. Sie hatte nicht die Absicht, die zauberhaft schöne, ländliche Seenregion der Bergwelt Bayerns zu verlassen, in der sie aufgewachsen war und die sie liebt. Ebenso unverzichtbar empfand sie die Nähe zu ihrem »Matriarchat«, wie sie ihre Familie nennt, die überwiegend aus Frauen besteht. Frauen, wie meine Mutter sie bewundert und schätzt: weltoffen, selbständig, mit dem Herzen am rechten Fleck, durchaus gut dafür, ungewöhnliche Entscheidungen zu treffen und »gegen den Strom zu schwimmen «, aber auch dafür, mit den Konsequenzen zu leben.
Ich weiß nicht, ob meine Mutter mit ihrem Ehemann lange Dispute wegen dieser Berufs- und Lebensplanung hatte. Auf jeden Fall stand fest, dass meine Mutter zwar unter allen Umständen berufstätig sein und eine feste Anstellung annehmen wollte, ihren Lebensplatz aber zu Hause sah, und ihr Ehepartner damit einverstanden war.
Es war ein Glückstreffer, den meine Mutter niemals bereut hat, als sie sich in der nahe ihrem Heimatort gelegenen Klosterschule meines Vaters um eine Anstellung als Kunsterzieherin bewarb. Sie hatte kaum ihre Bewerbungsunterlagen ausgebreitet, als sie bereits spürte, gewonnen zu haben. Sie fand nämlich in meinem Vater einen nicht nur interessierten und aufgeschlossenen Kunstliebhaber, sondern auch einen profund ausgebildeten Kenner. Zugleich bewies er Sinn für das Praktische, denn er erkannte sofort die Doppelchance, die für seine Schule in einer Fachkraft mit der Ausbildung meiner Mutter steckte.
Zum einen würde ihr sowohl theoretisch wie praktisch umfassendes künstlerisches Können und begeistertes Engagement dem Unterrichtsfach Kunsterziehung an seiner Schule einen weithin unvergleichlichen Ruf verleihen. Zum anderen aber würde sie als Architektin auch die Arbeiten mit übernehmen können, die bei der Planung des Ausbaus einer aufstrebenden Schule stets anfallen.
Die spontane Sympathie, die meine Mutter für meinen Vater empfand, stieß bei ihm sofort auf ein Echo. Vermutlich imponierte ihm meine Mutter, weil sie ähnlich dynamisch war wie er selbst. Überdies sah sie gut aus. Und dafür war mein Vater, der sich trotz seines Keuschheitsgelübdes immer wieder hoffnungslos verliebt und für viele Frauen geschwärmt hatte, schon immer sehr empfänglich.
Meine Mutter war absolut glücklich darüber, die angestrebte Anstellung im Schuldienst erhalten zu haben. Ihr Matriarchat und sogar ihr Ehemann waren begeistert. Selbst im Hinblick auf das Kind war der Schuldienst die ideale Lösung. Alles schien wunderbar.
Schon während der Studienzeit hatte meine Mutter immer wieder mit ihrem Ehepartner zu arrangieren versucht, dass beide ihrem Beruf nachgehen konnten und dennoch ihr Kind nicht vernachlässigt würde.
Allen Diskussionen und Anstrengungen zum Trotz gelang das Arrangement mehr schlecht als recht. Die Ehe entwickelte sich zusehends zur einseitigen Belastung für meine Mutter. Vor der Ehe war ihr Mann ein ganz lockerer Typ gewesen, der sich selbst und seinen Einmannhaushalt ohne Probleme versorgte. Jetzt verleitete ihn die Bequemlichkeit dazu, allmählich immer ausgiebiger in die bequeme »Männerrolle« zu schlüpfen.
In demselben Maße, wie meine Mutter anfing, Kuchen zu backen, die Wäsche für alle zu waschen und zu bügeln, zu putzen und dafür zu sorgen, dass genug zu essen im Kühlschrank und der Tisch immer gedeckt war, fing ihr Mann an, seine Siebensachen überall liegen und sich umsorgen zu lassen, zugleich aber auch sein Junggesellenleben fortzusetzen.
Für meine Mutter war dies wie ein Schock. Plötzlich steckte sie in der Rolle der treu sorgenden Hausfrau und Mutter, die rund um die Uhr für alles zuständig ist und immer dann verfügbar zu sein hat, wenn der Mann will. Genau die Rolle also, die meine Mutter, die ihre Unabhängigkeit so hoch schätzte, niemals gewollt hatte.
Von dem Moment an, in dem meine Mutter ihre Anstellung als Lehrerin bekam, lag es für sie vollkommen auf der Hand, dass mit ihrer Berufstätigkeit an der Schule alles anders werden müsse. Als Lehrerin konnte sie es sich nicht leisten, unpünktlich zum Unterricht zu erscheinen, weil sie ihr Kind oder ihren Haushalt zu versorgen hatte.
Konkret und pragmatisch, wie meine Mutter in derlei organisatorischen Dingen stets ist, tüftelte sie diesmal also einen genauen Zeitplan aus, wann ihr kleiner Sohn vom Vater, wann von der Mutter und wann von einer fremden Person betreut werden würde.
»Kein Problem!«, meinte ihr Ehemann. »Das kriegen wir schon hin!«
Doch viel mehr als ein Lippenbekenntnis war es nicht. Die Verwirklichung seiner guten Absichten fiel ihm so schwer wie zuvor. Es schien ihm nicht in den Kopf zu gehen, dass die Verpflichtungen und Interessen meiner Mutter ebenso wichtig waren wie seine eigenen.
Beruflich riss die Glückssträhne meiner Mutter allerdings nicht ab. Schon kurze Zeit nach ihrem vielversprechenden Start ins Berufsleben wurde ihr eine geräumige, sehr gemütliche Dienstwohnung angeboten. Diese befand sich in einem urgemütlich wirkenden Haus mit einem kleinen, vom Wetter ausgeblichenen, verzierten Holzbalkon und grünen Fensterläden. Ursprünglich vielleicht einmal für Klosterbedienstete gebaut, war es Klosterbesitz und lag unmittelbar gegenüber der Schule. Ringsherum war es von einem Garten mit einer schönen Spielwiese und einem festen Stangenzaun umgeben.
Im unteren Geschoss befand sich ein Lädchen, in dem die Schulkinder des Klosters ihren Bedarf an Heften, Büchern und anderen Materialien decken konnten. Es war viele Jahre lang von einer alten Dame geführt worden, die im Hauptgeschoss des Hauses ihre Wohnung hatte. Jetzt war sie tot. Die Wohnung und mit ihr die Ladenräume standen leer.
»Wenn Sie möchten, können Sie jederzeit mit Ihrer Familie dort einziehen«, sagte der Abt des Klosters. »Wir sind froh, wenn das Haus bewohnt ist. Und wegen der Miete müssen Sie sich auch keine Gedanken machen. Zahlen Sie dem Kloster, was Sie erübrigen können.«
Meine Mutter war überglücklich.
Sie wusste, dass in dem Haus noch eine alleinstehende alte Dame in einer Mansarde unter dem Dach wohnte. Außer ihr gab es dort oben nur noch einen jungen Lehrer als Mieter eines Einzelzimmers.
Es gab keinen Grund, das großzügige Angebot des Abtes auszuschlagen.
Freudestrahlend kam meine Mutter mit dieser Nachricht nach Hause. Es bedurfte keiner Diskussionen. Sowohl meine Mutter als auch ihr Mann hatten das Umziehen von einer engen Zweizimmerwohnung in die andere lange schon satt. Wenige Tage später rollte der Umzugswagen an.
Endlich hatte meine Mutter mit ihrer Familie genug Platz. In der neuen Wohnung gab es ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine geräumige Diele, ein helles Kinderzimmer, eine schöne Küche, ein freundliches Bad und sogar ein Arbeitszimmer.
»Ich hab dann halt jeden Monat hundertfünfzig Mark Miete für die dreihundert Quadratmeter Wohnraum überwiesen«, sagte meine Mutter, als ich sie fragte. »Der Abt hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn ich nichts gezahlt hätte. Aber das hab ich dann doch nicht fertiggebracht. Sonst meinst du womöglich, du wohnst da gar nicht.«
Die kleine Hausgemeinschaft war nett und familiär, was sich vor allem für meinen Bruder günstig auswirkte. Die alte Dame aus der Mansarde und er freundeten sich schnell an. Wie schnell und wie gut, merkte meine Mutter bald schon an dem allmählich umfangreicher werdenden urbayerischen Sprachschatz meines Bruders. Meine Mutter wusste nicht recht, ob sie darüber lachen oder sich ärgern sollte. Sie hatte sich große Mühe gegeben, meinen Bruder mundartfreies Deutsch zu lehren. Vergeblich! Innerhalb weniger Monate machte mein Bruder all ihre Bemühungen um preußisches Schriftdeutsch zunichte, sodass es den zu vernachlässigenden Status der Zweitsprache erhielt. Mit fünf Jahren war er deshalb noch immer kaum imstande, einen echten hochdeutschen Umlaut auszusprechen und brachte meine Mutter damit schier zur Verzweiflung.
Erstaunlicherweise ist er heute derjenige von uns, der am saubersten Hochdeutsch spricht. Wie oft haben wir darüber schon miteinander lachen können!
Im Laufe der Zeit beschloss die alte Dame aus der Mansarde, in ein Altersheim umzuziehen, das ebenfalls dem Kloster gehörte. Es war nur wenige Meter von uns entfernt. Die alten Leute, die dort wohnten, hatten es gut. Auch unsere alte Dame fühlte sich recht behaglich in ihrem Zimmer und genoss es, verwöhnt zu werden. Mein Bruder besuchte sie nun nicht mehr ein paar Treppen höher unter dem Dach, sondern ein paar Schritte den Berg hinauf. Solang die alte Dame lebte, blieben die beiden einander herzlich zugetan.
Meine Mutter nutzte die Gunst der Stunde, um das ganze Haus in Beschlag zu nehmen. Kurz entschlossen belegte sie auch die Wohnung der alten Dame, da es dort oben trockener war. Viel später hatte sie im Untergeschoss sogar ein kleines Atelier eingerichtet. Es war mit einer feierlichen Vernissage eingeweiht worden und diente dazu, sowohl künstlerische Arbeiten meiner Mutter als auch besonders gelungene Schülerarbeiten auszustellen und zum Verkauf anzubieten. Gleichzeitig warb das Atelier mit der Vielfalt und Qualität der Arbeiten für den außerordentlichen Kunstunterricht der Klosterschule. Nicht zuletzt wegen dieses Angebots und des weit über ein gemeinhin übliches Lehrerengagement hinausgehenden persönlichen Einsatzes meiner Mutter entschlossen sich immer mehr Eltern, ihre Kinder auf »unsere« Schule zu schicken.
Mein Vater und das gesamte Lehrerkollegium waren sich in der Annahme einig, dass meine Mutter ein echter Glücksfall für die Schule war.
Es dauerte nicht lange, bis mein Vater sich heftig in meine Mutter verliebte. Für mich als Sohn ist es schwer, mir meine Eltern als Liebespaar vorzustellen. Eltern haben für ihre Kinder ja oft etwas Geschlechtsloses.
Meine Eltern fotografieren beide gern und oft. Daher gibt es bei uns zahlreiche dicke Fotoalben. Meine Mutter hat sie angelegt. Wie es ihrer großzügigen Natur entspricht, hat sie die einzelnen Fotos nicht immer in der richtigen Reihenfolge eingeklebt. Aber ich liebe gerade dieses typisch bunte Durcheinander. Und wenn ich die Alben einmal zur Hand nehme, betrachte ich einige wenige Lieblingsaufnahmen immer wieder.
Eine zeigt meine Mutter mit langen blonden Locken, die ihr in den Nacken rollen, während sie eine Strähne ebenso gedankenverloren um den Finger wickelt, wie sie dies bisweilen immer noch tut. Sie trägt Schlaghosen und dicke Plateausohlenschuhe, wie sie heute wieder ganz modern sind. Und sie hat so einen kessen Gesichtsausdruck mit so einem bestimmten Lachen. Auf diesem Bild sieht sie aus wie ein Mädel, das genau jetzt in meiner Schulklasse oder auf einer unserer Partys sein könnte. Abgesehen davon, dass ich eher auf Dunkelhaarige abfahre, wäre sie ein Mädel, das ich gut finden würde. Sie sieht so aus, als könnte man mit ihr reden. Aber eben nicht nur reden. Genau die richtige Mischung. Vielleicht würde ich mich in sie verlieben.
Mein Vater – das ist schon problematischer.
Ich erinnere mich, dass ich als kleiner Bub einmal einen Traum hatte, den ich danach lange Zeit immer wieder geträumt und nie vergessen habe. Es war nur ein ganz kurzer Traum. Aber er hat mich tief beeindruckt.
Es war in der Zeit, als ich besonders oft und dringend wissen wollte, wer mein Vater ist. Ich war schon aus dem Kindergartenalter heraus. Wahrscheinlich ging ich in die erste, zweite Klasse. Ständig nervte ich meine Mutter, aber auch meine Oma mit meinen Fragen, wer mein Vater sei und wo er denn sei und warum. Ich habe gefragt und gefragt und gefragt. Irgendwann hatte meine Mutter mir dann gesagt: »Dein Vater ist in Rom. Er kann nicht kommen.«
Ich fragte natürlich: »Und warum nicht?«
Darauf sagte sie: »Er wird vom Papst in Rom gefangen gehalten.«
Ich war unglaublich erschrocken und auch verwundert. Mein Vater und gefangen! Ein Käfig fiel mir ein, in dem er sitzen muss, während unter ihm ein paar Wilde in Kriegsbemalung Feuer anzündeten. Oder ein Gefängnis mit Eisengittern und Wärtern, die ein Stück Trockenbrot durch eine Luke schoben.
»Warum denn gefangen? Ist er ein Verbrecher?« So oder so ähnlich habe ich wohl gefragt.
Jedenfalls erklärte meine Mutter mir: »Nein, nein. Er ist ein Doktor.«
Wäre ich damals verständiger und vor allem lebenserfahrener gewesen, hätte ich die verschlüsselte Botschaft zwischen den Worten meiner Mutter natürlich sofort erkannt. Es war das Besondere ihrer Antworten, dass sie nicht wirklich log, sondern die Wahrheit zurechtbog, bis sie passte.
Für den kleinen Buben, der ich damals war, klang es jedoch so, als sei mein Vater ein Arzt und zwar ein berühmter. Einer, der jede Krankheit heilen könne und deshalb so berühmt und wichtig sei, dass sogar der Papst ihn jede Sekunde bei sich haben und nie mehr fortlassen wolle und ihn in einem Krankenhaus eingesperrt habe.
Eines Tages, als ich meine Oma wieder so genervt und ausgefragt hatte, waren wir in München in einem Park mit einem Spielplatz gewesen. Der Spielplatz war sehr schön. Vor allem eine Gruppe kleiner Holzhäuschen beeindruckte mich sehr. Sie waren an einem Hang hoch gebaut und über eine Treppe erreichbar. Es erinnerte mich an ein Haus in Italien, in der Toskana, das meine Mutter fast gekauft hätte. Als Haus konnte man es leider vergessen, aber der Anblick des Hauses mit seinem steilen Hanggarten sah aus wie aus einem fantastischen Film. Ein Dornröschenschloss sozusagen. Jahrelang hatte sich niemand darum gekümmert. Entsprechend verwildert war der Garten. Es wäre ein sagenhafter Abenteuerspielplatz gewesen. Noch heute kommt es mir so vor, als würde ich, wenn ich etwas über ein einsames Haus lese, unwillkürlich dieses Haus vor Augen haben.
An diesem Tag in München spielte ich, dass mein Vater in einem dieser Holzhäuschen wohnt und Arzt ist. Ich war vollkommen vertieft in die Szene, die ich mir dabei ausdachte.
Mein Traum in der Nacht fußte ganz genau auf dieser Vorstellung. Ich weiß nicht mehr, was ich um die eine unvergessliche Kernszene herum noch träumte. Ich glaube, es war kein sonderlich ausführlicher Traum. Eher ein kurzer, aber sehr intensiver Traum. Sehr viel Handlung gab es da nicht. Am Ende meines Traumes sah ich mich jedoch wie in einer Hubschrauberkamerafahrt durch ein Tal auf dieses Dornröschenschloss in der Toskana zurasen. Es stand zwischen Bäumen und hatte eine breite Treppe, die zu einer fest verschlossenen Tür führte. Hinter dem einzigen hell erleuchteten Fenster saß mein Vater und arbeitete an irgendwelchen medizinischen Geräten. Irgendwo lag da, glaube ich, auch ein Gebiss herum. Das hatte ich vielleicht aus der »Unendlichen Geschichte«, in der der Vater von Bastian Zahntechniker ist.
Dass der Mann in diesem Haus mein Vater ist, wusste ich sofort. Als er mich erblickte, stand er auf und winkte mir durch das Fenster zu. Auch er erkannte mich also, obwohl ich damals ja glaubte, dass wir einander noch niemals gesehen hatten. Er sah ungefähr aus wie Sean Connery, so dieser James-Bond-Typ, würde ich sagen. Also der Coole, Gelassene. Weißer Kittel, groß, schlank, dunkles Haar. Ganz das Gegenteil von meinem Vater. Wenn ich heute darüber nachdenke, muss ich lachen. Irgendetwas rief er mir auch zu. Ich verstand es nicht. In diesem Moment wachte ich auf.
Ich habe diesen Traum wie einen Zauber gehütet. Bis heute habe ich ihn im Gedächtnis bewahrt. Wenn ich seitdem an meinen geheimnisvollen Vater dachte, stand mir das Bild des Traumes vor Augen. Ich habe alles immer wieder geträumt, wohl auch deshalb, weil ich es immer wieder träumen wollte. Vielleicht, um endlich zu verstehen, was mein Vater mir zurief. Ganz sicher auch einfach, weil ich Sehnsucht nach ihm hatte. Dieser Traum war damals meine einzige Chance, ihm nahe zu sein. Erst jetzt, da ich intensiv über alles nachdenke, wird mir bewusst, wie sehr ich ihn vermisste.
Mein echter Vater hat äußerlich mit einem Actionhelden wie Sean Connery nichts gemein. Er ist eher kleiner, eher etwas untersetzter. Eben nicht wie Sean Connery, sondern so wie ich. Von schlank und groß also keine Spur. Nicht einmal die dunklen Haare stimmten; mein Vater ist blond. Auf den Fotos meiner Mutter zeigt er schon früh einen Ansatz zur Petrusfrisur mit schütterem Haupthaar. Und auch der coole, gelassene Typ trifft nicht zu.
Auf seine Weise hat allerdings auch mein Vater eine charismatische Ausstrahlung. Wenn man ausklammert, dass er als Vater absolut enttäuschend ist, kann er ein imponierender Mann sein. Meine Mutter schwärmt heute noch von ihm und seiner unglaublich fantastischen Persönlichkeit, wegen der ihm ihr Herz nur so zuflog.
Sie spricht oft und gern von ihm. Sie hat dann so einen warmen und zugleich melancholischen Ausdruck in den Augen, dass man sofort erkennt, sie hat ihn wirklich geliebt, und ein Teil von ihr liebt einen Teil von ihm auch immer noch. Trotz allem, was geschehen ist.
»Ich habe mich schon früh sehr in ihn verliebt«, sagt sie immer. »Ich habe ihn ja als Schuldirektor kennengelernt. Und da war er so mutig und hat die Schule vergrößert und so ausgebaut, dass die Mädchen reinkonnten, die bis dahin ja nicht zugelassen waren. Wir waren damals eine der ersten Versuchsschulen in ganz Bayern mit einer Kollegstufe. Das hat alles er gemacht! Er ist ein faszinierender, ein wirklich absolut faszinierender Typ. Er hat eine wahnsinnige Wirkung auf Menschen und einen irren Charme. Und auch die Art, wie er mit seiner sehr, sehr schönen Stimme spricht! Alle in seiner Familie sind sehr musikalisch und haben schöne Stimmen. Und da konnte er herrlich reden. Auch vor den Schülern. Bei den Ansprachen, in der Kirche; es war einfach traumhaft. Er konnte die Leute so extrem gut überzeugen und für sich einnehmen. Das habe ich von Anfang an bewundert. Er hat Seminare abgehalten. Er war im Grunde dem ganzen Kollegium immer einen Schritt voraus. Für all das habe ich ihn absolut verehrt und geliebt. Ich habe immer gedacht: Ich habe den tollsten Pädagogen und Erzieher. Das braucht er im Grunde nur auf eine eigene Familie zu übertragen, und er ist perfekt.«
In schweren Zeiten, in denen ich daran verzweifelt bin, dass mein Vater ist, wie er ist, habe ich meine Mutter gefragt, ob sie denn nicht geahnt habe, wie mein Vater wirklich ist.
»Nein«, sagte sie da. »Dass er das alles, was er als Schuldirektor im Umgang mit Kindern und Erwachsenen perfekt konnte und wusste, nie und nimmermehr auf sein Privatleben übertragen konnte, weil das Kloster ihn so gespalten hat, das habe ich erst viele Jahre später gemerkt, so schleichend gemerkt. Auch für mich selbst viel zu spät bemerkt.«
Zurückschauend sieht meine Mutter heute ziemlich klar, dass sie damals etwas von der anderen Seite meines Vaters hätte ahnen können.