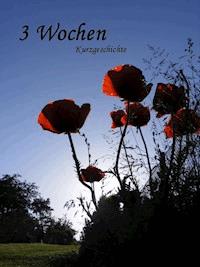Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Roman mit biografischem Hintergrund. Die Autorin nimmt die Leser mit auf eine zweijährige Reise zu ihrer leiblichen Mutter. Über die Suche und eine erste schriftliche Kontaktaufnahme bis hin zum Treffen erfahren die Leser mehr über die Emotionen zur Adoption freigelassener Kinder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simone Zenker
Wer bin ich?
Die Suche nach meiner Mutter
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Wer bin ich?
Suche
Gefunden
Zukunft
Nachwort
Anhang
Impressum neobooks
Wer bin ich?
Eine Frage, die sich eigentlich ganz einfach beantworten lässt. Ich bin Simone Z., 42 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder. Doch warum lässt mich diese Frage dann seit Jahren immer wieder grübeln? Warum finde ich keine Ruhe? Die Antwort ist vielleicht ganz offensichtlich, doch sie kann mir keine „Erlösung“ bringen. Denn sie ist dabei das Problem. Ich bin ein Kind, das keiner wollte. Ein Kind, dessen Mutter einfach aus dem Krankenhaus lief, ohne ihren Säugling mitzunehmen. Ein Kind, bei dessen Vater die Trunksucht größer war als das Verantwortungsgefühl für das eigene Baby.
Adoption ist in der heutigen Zeit kein negatives Wort mehr. Adoption heißt für mich: ein Kind kommt zu Menschen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als Eltern zu sein. Das Kind darf mit ihnen ein Leben teilen, welches ihnen mit den leiblichen Erzeugern versagt bleibt. Geholfen wird allen Beteiligten. Den Eltern, die selbst keine Kinder bekommen können. Und dem Kind, welches nicht in einem Heim aufwachsen muss. Doch bei allen positiven Aspekten vergisst man oft, dass irgendwann das Kind die Wahrheit erfährt, erfahren muss. Und dann beginnt ein Teil des Lebens, der für die meisten adoptierten Kinder schwierig wird.
Und so suchen viele nach Antworten. Warum hat man mich nicht gewollt? Welche Gründe gab es für die Freigabe zur Adoption? Wurde ich je geliebt? Hat man sich jemals nach mir gesehnt? Hat man versucht, mich später wieder zu finden? Hat man die Entscheidung vielleicht bereut?
Die Antworten darauf können nur die Mitbetroffenen selbst geben: die Eltern. Wer also all das wissen will, muss mutig genug sein, um mit ihnen den Kontakt aufzunehmen. Muss sich im Klaren sein, dass das, was man zu hören bekommt, vielleicht nicht das ist, was man hören will. Dass man im schlimmsten Fall wieder abgelehnt wird. Dass man nach einer Kontaktaufnahme sich vielleicht wünscht, man hätte nie diesen Versuch unternommen.
Suche
01. Mai 1982
Ich war damals 9 Jahre alt, saß zu Hause und wartete. Ich musste losgehen, es war der 1. Mai und wir Schüler der Karl-Marx-Schule in R. mussten in die Innenstadt. Auf einer Tribüne vor dem Rathaus dann jedes Jahr dasselbe. Sprechchöre ertönten, Schüler lasen von vorgefertigten Zetteln ihre Texte ab. Doch ich wollte nicht alleine mit der Bahn fahren, hatte Angst und wartete deshalb wie jedes Jahr auf meine beste Freundin. Doch sie kam nicht. Ich wurde unruhig und wollte lieber zu Hause bleiben, statt alleine in einer überfüllten Straßenbahn mit fremden Menschen zu fahren, um dann später meine Klasse zu suchen. Meine Mutter wurde langsam böse. Sie hatte eine Vermutung, was hinter meiner bockigen Art stecken könnte. Schon in den Tagen und Wochen vorher soll ich mich anders benommen haben. Sie ahnte Schlimmes und bat mich dann gemeinsam mit meiner Oma in unser Wohnzimmer. In meinen Gedanken sehe ich immer noch das grün-weiß bezogene Velours-Sofa und es ist wieder 10.00 Uhr vor 33 Jahren. Niemals mehr werde ich dieses Gefühl vergessen können. Meine Mutter saß auf der Lehne rechts neben mir. Meine Oma links. Ich verstand nicht, was los war. Meine Mutter fing an zu weinen. Sie fragte mich direkt, ob unsere Nachbarn irgendetwas zu mir gesagt hätten. Ich verstand immer noch nichts. Nachbarn? Dann erzählte sie von ihrer Angst davor, dass andere mir schon etwas zugetragen hätten, was eigentlich nur sie mir sagen wollte. Jetzt bekam ich Angst. Und dann kam es. Sie sagte es unter Tränen und ich hörte ganz verschwommen: „Ich bin nicht deine leibliche Mutter. Ich habe dich nicht selbst zur Welt gebracht.“ Ich war völlig überrascht. Meine erste Frage war daher: „Bin ich denn ein Roboter?“. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten damals geahnt, was mich später an diesem Morgen so durcheinander bringen würde. Ich erinnere mich noch gut an dieses Gefühl, dass ich damals hatte. Wie kann es denn sein, dass meine eigene Mutter mich nicht zur Welt gebracht hat? Das ist völliger Quatsch. Absurd. Lächerlich. Dass es eine andere Frau gewesen sein könnte, das kam mir damals allerdings auch nicht in den Sinn. Dann erklärte meine Mutter weiter – unter vielen Tränen -, dass sie mir das schon längst hätte sagen wollen. Dass ich ein adoptiertes Kind bin. Ich wusste nicht genau, was das bedeutete. Deshalb tröstete ich sie. Ich wollte nicht, dass sie weinte. Ihr Schmerz lenkte mich von meinem ab, den ich deshalb erst viele Jahre später so intensiv spürte, als hätte er sich umso stärker angesammelt. Ich sagte ihr, dass ich sie liebe und dass nur sie meine Mama ist. Egal, wer mich geboren hatte. Ich konnte es fast leichtfertig sagen und in meinem Kinderhirn war einzig meine Mama meine Mama. Denn ich hatte doch nur sie. Und ich wollte, dass sie glücklich ist …. und aufhörte zu weinen.
Erst viele Jahre später und nach dem Lesen von vielen Büchern weiß ich, dass man Adoptivkindern schon frühzeitig erzählen soll, woher sie kommen. Damit genau das nicht passiert, was ich erfahren musste. Und ganz wichtig ist auch das Wie des Erzählens. Warum weinte meine Mutter damals so viel? Sie hatte große Angst, dass ich mich von ihr abwenden könnte. Doch durch ihr Weinen habe ich als Kind gedacht, die ganze Adoption wäre etwas furchtbar Schlimmes gewesen, über das sie eigentlich gar nicht reden wollte, aber musste. Insgesamt war also die „Offenbarung“ ein traumatisches Erlebnis, welches man ganz anders hätte vorbereiten und durchführen können. Ich muss meine Adoptivmutter hier allerdings in Schutz nehmen, denn vor 42 Jahren zu meiner Adoptionszeit gab es keinerlei Sozialarbeiter, die einen hätten darauf hinweisen können, es gab zu DDR-Zeiten keine schlauen Bücher mit Vorschlägen, wie und wann man seinem Kind die Wahrheit sagen sollte. Meine Mutter hatte einfach zu lange gewartet bis es gar nicht mehr ging und dann sehr emotional reagiert. Infolge dessen fühlte ich mich wegen der Traurigkeit meiner Adoptivmutter stets sehr schuldig. Ich hatte sie ja mit meiner Person zum Weinen gebracht. Diese Schuldgefühle und die Verantwortlichkeit für das Wohlergehen meiner Mutter spürte ich noch bis vor einigen Jahren. Mein ganzes Leben war bis zu meiner absolvierten Therapie davon geprägt, dankbar zu sein. Das war ein Gefühl, welches mich immer begleitet hat und ganz natürlich war. Und ich konnte das auch gut erklären. Meine leibliche Mutter hat mich nicht gewollt, doch meine Adoptivmutter hat mich aus dem Krankenhaus abgeholt und mir ein Zuhause geboten. Erst vor wenigen Jahren erfuhr ich dann, dass diese Dankbarkeit meinerseits gar nicht nötig war. Denn meine Adoptivmutter hatte sich einen großen Wunsch erfüllt. Sie war kinderlos und wollte unbedingt ein Kind haben. Ich war „gerade da“. Wenn vor 42 Jahren noch ein Baby zur Adoption zur Verfügung gestanden hätte, dann wäre ich vielleicht woanders aufgewachsen. Das ist natürlich für mich ein irrealer Gedanke. Doch so ist es.
Vielen Adoptivkindern ist dieses Gefühl angeboren. Diese ewige Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die sie angenommen haben. Doch was bewirkt das ganze in der Entwicklung eines Kindes, wenn man stets und ständig dankbar ist? Man lernt nicht wie andere, seine eigene Meinung zu sagen, ohne darüber nachzudenken, dass man mit dieser vielleicht den anderen verletzt. Den anderen, der einem ja das Leben erst ermöglicht hat. Das ist ein anderes Gefühl als bei leiblichen Eltern. Da kann man trotzig und aufmüpfig sein, denn dazu sind Eltern ja da. Sie haben ein Kind bekommen und nun müssen sie halt sehen, wie sie mit ihrem pubertierenden Nachwuchs klar kommen. Hat man Adoptiveltern und weiß um die eigene Adoption, dann ist hier einiges anders. Dieses Gefühl, man wurde angenommen und könnte – vielleicht – aus welchen Gründen auch immer wieder „abgegeben“ werden, ist hintergründig immer da. Nicht, dass man daran tagtäglich denken würde. Ich kann mich auch daran nicht erinnern, dass ich tatsächlich besonders lieb und nett in meiner Jugend zu meinen Adoptiveltern war, um sie zu schonen. Doch jetzt in meinem „hohen“ Alter erinnere ich mich schon an Entscheidungen, die ich damals gefällt habe, um die Liebe meiner Eltern nicht zu verlieren. Entscheidungen, die ich heutzutage anders getroffen hätte. Das Gefühl, seinen Adoptiveltern nicht schaden zu wollen und sie Zeit ihres Lebens aus Dankbarkeit nicht zu belasten, kennen sicherlich viele Adoptierte.
Das Problem des „Outings“ bezüglich meiner Adoption bestand damals aber auch noch aus einer anderen Sache. Nach dem Gespräch mit meiner Oma und meiner Adoptivmutter gab es niemals mehr ein weiteres. Statt nun – nach der Offenbarung meines „Andersseins“ – das ganze als etwas Natürliches anzusehen und offen damit umzugehen, wurde es wieder vergraben. Meine Familie hat mit keinem Wort mehr etwas darüber erwähnt und ich wurde auch nicht darauf angesprochen. Im Nachhinein weiß ich selbst nicht mehr genau, wie lange ich damals noch darüber nachdachte. An die Zeit danach kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber ich wollte wohl auch gar nicht darüber sprechen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich damals den Wunsch verspürte, meine leibliche Mutter aufzusuchen. Ich hatte und habe ja eine Mutter. So wurde dann das Trauma der „Enthüllung“ nie aufgearbeitet. Es war und blieb verschüttet.
Als ich Jahre später meine Ausbildung begann und neue Menschen kennen lernte, fing ich an, hin und wieder, wenn sich das Thema ergab, auch darüber zu sprechen, dass ich ein Adoptivkind bin. An die genauen Zusammenhänge kann ich mich nicht erinnern, aber irgendwie machte es mich sogar ein bisschen stolz, so anders zu sein als die anderen. Denn Adoptivkinder waren anders, dass spürte ich. Auch meinem Mann erzählte ich früh meine Geschichte. Meine Kinder erfuhren es, als sie alt genug waren. Ich weiß noch, dass ich das ganze recht emotionslos erzählen konnte, denn es berührte mich – damals – tatsächlich nicht so stark. Ich war ein Adoptivkind und fertig. Es gab nun einmal unterschiedliche Menschen. Findelkinder, leibliche Kinder, Kinder mit nur einem Elternteil. Was sollte daran so besonderes sein? Die Welt ist bunt.
Jahrelang sah ich im Fernsehen mit Unverständnis die Geschichten anderer adoptierter Menschen, die mit Feuereifer nach ihren leiblichen Eltern suchten, nur um dann später enttäuscht zu werden. Die weinend in die Kameras blickten und sagten, sie brauchen das Gefühlt, „ihre Wurzeln“ zu kennen. Ich weiß noch genau, dass ich so manches Mal abfällige Bemerkungen fallen ließ. Denn ich fand es albern, in aller Öffentlichkeit so ein Getöse darum zu machen, dass man von Eltern abstammte, die man nicht kannte. Mittlerweile sehe ich solche Sendungen mit anderen Augen. Ich kann die Menschen viel besser verstehen. Ich brauchte vielleicht etwas länger als andere, die schon mit 20 auf die große Reise gehen, um ihre engsten Angehörigen zu finden. Es gibt nun einmal Situationen im Leben, die in einem erst dieses Verlangen entfachen, dass es nun an der Zeit ist, auf die große Suche zu gehen. Man muss sich stark und mutig fühlen und diesen Wunsch auch wirklich verspüren. Alles andere wäre auch sinnlos. Denn es ist kein kleines Kapitel im Leben eines Menschen, welches man erforschen möchte. Es ist der Ursprung des eigenen Ichs. Es ist die Basis eines jeden Lebens. Und wer daran rüttelt, kann böse überrascht werden. Man muss darauf gefasst sein zu hören, dass man absolut nicht gewollt war oder zu seiner Person auch heute keinen Kontakt wünscht.
Die Sozialarbeiter in den Jugendämtern sind bestens geschult für die rechtzeitige Aufklärung der Kinder über ihre Adoption und bieten ihr Wissen dazu an. Frühzeitige Aufklärung und der ganz natürliche Umgang mit der Situation ist ihre Devise. Wäre ich heute noch jung und meine Adoptivmutter hätte dieses Wissen, vieles wäre wohl anders gekommen in meinem Leben. Daran denke ich aber nicht. Ich freue mich ganz einfach für all diejenigen, die Jahre nach mir adoptiert wurden und deren Adoptiveltern - mit den aktuellen Erkenntnissen versorgt – die Offenbarung einer Adoption ganz anders angehen.
Jahre später
Ich kann mich an die Zeit vor dem bewussten Gespräch an jenem 1. Mai nicht mehr erinnern. Meine Kindheit ist fort. Alle Ereignisse aus Kindergarten und Schule existieren für mich nicht mehr. Ich sehe mir Bilder an und erkenne mich darauf. Ich höre zu, wenn lustige Geschichten von damals die Runde machen. Ich weiß aber nichts mehr. Die Erinnerungen sind – wenn überhaupt – verschwommen und ich kann nicht mehr klar sagen, ob ich etwas tatsächlich weiß oder die ganzen Geschichten einfach nur schon zu oft gehört habe. Ich lebte mein Leben als Jugendliche und sprach mit meinen Adoptiveltern nie wieder über den 1. Mai 1982. Meine Verwandtschaft wusste natürlich Bescheid und schwieg ebenfalls. Es war einfach kein Thema mehr. Wenn in den Medien über Adoption gesprochen wurde, hörte ich zu, fand es aber wenig interessant. Mich bedrückte es nicht, mich interessierte es nicht.
Mit der Zeit veränderte sich unsere Familie. Ich hatte eine kleine Schwester bekommen. Meine Adoptivmutter wurde nach ihrer zweiten Heirat doch noch schwanger und wir freuten uns alle über den Zuwachs. Ich war jetzt die große Schwester. Unterschiede bei unserer Erziehung gab es nicht. Meine Mutter war sogar noch etwas vorsichtiger und ängstlicher bei mir. Später bekomme ich von ihr die Antwort auf ihr Verhalten: sie hatte immer Angst, ich könnte ihr wieder weggenommen werden. Sie hatte mich also behütet wie eine Glucke und versucht, immer alles Negative von mir fernzuhalten. Dass das nicht das richtige Erziehungskonzept war und ist, wusste sie damals nicht. Meine Schwester wuchs mit vielen Jahren Altersunterschied nicht unbedingt wie eine Schwester für mich auf. Da ich früh selbst ein Baby bekam, wurde sie eher wie ein Kind von mir behandelt. Sie verstand sich ausgezeichnet mit meinem Erstgeborenen und spielte viel mit ihm. Mein Mann und ich wiederum nahmen sie zu vielen Unternehmungen, auch in den Urlaub mit. Erst viele Jahre später wurde das Verhältnis zu meiner Schwester „geschwisterlich“. Freier und unkomplizierter könnte man das Leben meiner Schwester damals bezeichnen. Ich selbst war immer gefangen in meinen Gedanken, nicht klug genug, schön genug, dankbar genug zu sein. Und ich hing an meiner Mutter. Sie wiederum an mir. Wir waren/sind Seelenverwandte. Wir verstanden/verstehen uns blind. Meine Schwester ist wiederum ein Papa-Kind. Ich denke, dass die Zeit, die ich alleine mit meiner Mutter war, uns dieses intensive Verhältnis brachte.
2004
Ich gründete eine eigene Firma in meiner Heimatstadt und war glücklich. Die erste Zeit war nervenaufreibend und oftmals hatte ich schon Angst, dass ich es nicht schaffen könnte. Meine Familie stand hinter mir und organisatorisch bekam ich alles hin. Und doch merkte ich langsam eine Veränderung. Es passierte zuerst an der Bahn-Haltestelle. Ich warte. Plötzlich kam mein Herz ins Stolpern. Ich erschrak und wurde panisch. Ich blieb stehen und versuchte zu atmen. Alles kam wieder in Ordnung. Ich stieg in die Bahn an.
Tage später die gleiche Situation. Herzstolpern. Nun schon länger andauernd und ausgeprägter. Mal setzten Schläge zuviel ein und mein Puls stieg. Mal dauerte es zu lange zwischen den Schlägen. Ich bekam schlechter Luft in überfüllten Bahnen und mochte keine Menschenansammlungen mehr. Mein Herzschlag wurde von nun an beobachtet. Ich hörte in mich hinein und es machte mich fast wahnsinnig. Alles noch korrekt? Ich ging abends ins Bett, der Trubel des Tages lies nach und ich hatte Zeit. Nun schon regelmäßig stieg mein Puls und das Herz pochte wie verrückt. Hatte ich vorher nie im Leben Schlafprobleme gehabt, war jetzt der Anblick meines Bettes schon furchtbar. Wenn ich mich reinlegte, ging es wieder los. Es vergingen einige Wochen und ich wurde immer müder und unausgeglichener. Eines Nachts dann der Höhepunkt. Ich wachte auf, mein Puls schlug bedrohlich schnell, ich bekam keine Luft. Panik. Ich riss das Fenster auf und versuchte, die eiskalte Luft einzuatmen. Meine Gedanken kreisten nur um ein Wort: überleben. Mein Mann rief den Notarzt. Ich versuchte mich von einem Atemzug zum nächsten zu hangeln. Innerlich verfluchte ich den Arzt, der auf sich warten ließ. Eine gefühlte ewige Zeit später saß ich dann im Wohnzimmer und vor mir stand ein Herr mittleren Alters, der mir eine Beruhigungsspritze gab. Er nahm die Angelegenheit völlig gelassen auf, fragte nach Stress in der Vergangenheit. Ich gab Auskunft und wurde wieder alleine gelassen mit dem Hinweis, doch mal wegen meiner Nerven zum Arzt zu gehen. Natürlich ging ich zu meinem Hausarzt und nahm auch brav die pflanzlichen Präparate ein, die ich verordnet bekommen hatte. Die Wochen vergingen und ich saß nun schon oftmals beim Arzt. Es gab mal Tabletten, mal gute Ratschläge. Nach einigen schlimmen Nächten mit Herzrhythmusstörungen war ich morgens nicht mal in der Lage, mein Kind zum Kindergarten zu bringen. Meine Mutter musste kommen. Das hielt ich nicht lange durch. Organisch war alles gesund. Ich wollte psychologische Hilfe. Ich hatte Glück und musste nicht lange auf einen Therapie-Platz warten und fortan bestimmte jeder Freitag in der Woche mein Leben. Ich durfte erzählen und man hörte mir zu. Ich bekam Ratschläge und versuchte, mein Leben zu ändern.