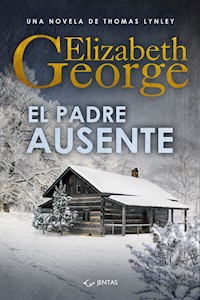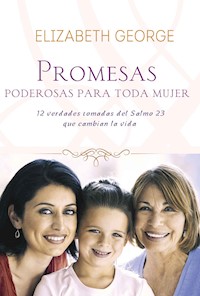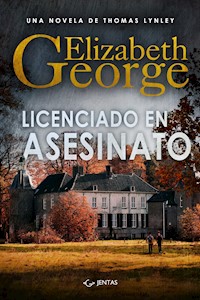9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Lynley-Roman
- Sprache: Deutsch
Über 15 Millionen verkaufte Bücher allein im deutschsprachigen Raum.
Die Bürger des englischen Städtchens Ludlow sind zutiefst entsetzt, als man den örtlichen Diakon eines schweren Verbrechens beschuldigt und ihn verhaftet. Kurz darauf wird er in Polizeigewahrsam tot aufgefunden. Im Auftrag Scotland Yards versucht Sergeant Barbara Havers Licht ins Dunkel um die geheimnisvollen Vorfälle zu bringen. Zunächst weist tatsächlich alles auf den Selbstmord eines Verzweifelten hin – doch Barbara und mit ihr DI Thomas Lynley trauen dieser Version der Ereignisse nicht. Gemeinsam werfen sie einen genaueren Blick hinter die idyllische Fassade Ludlows – und entdecken, dass fast jeder hier etwas zu verbergen hat …
Der 20. Fall für Inspector Thomas Lynley und Barbara Havers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1252
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Als im idyllischen Ludlow ein Diakon der Anglikanischen Kirche sich in Polizeigewahrsam das Leben nimmt, fördert eine erste vorläufige Untersuchung nichts Ungewöhnliches zutage. Doch der Vater des Verstorbenen ist ein wohlhabender Brauereibesitzer mit guten Beziehungen ins Parlament. Und so ist schon bald Scotland Yard involviert – wenn auch eher unfreiwillig.
Die Ermittlungen im mittelalterlichen Städtchen übernimmt Detective Chief Superintendent Isabelle Ardery. Auf Anordnung ihres Vorgesetzten wird sie dabei von Sergeant Barbara Havers begleitet. Wenn Havers – bekannt für ihre regelwidrigen Eigenmächtigkeiten – auch diesmal wieder eine rote Linie überschreitet, ist dies Arderys Chance, sie ein für alle Mal loszuwerden. Doch überraschenderweise ist dann nicht Barbara Havers das Problem – es ist Ardery selbst: In ihrer Eile, nach London zurückzukehren, übersieht sie entscheidende Details.
Also wird eine weitere Reise nach Ludlow nötig, diesmal unter Leitung von Detective Inspector Thomas Lynley. Denn irgendjemand scheint ein nachhaltiges Interesse daran zu haben, den Vorfall nicht weiter zu hinterfragen. Nun ist es an Lynley, mit Barbara Havers´ bewährter Hilfe Licht ins Dunkel um den Tod des Diakons zu bringen. Und damit die verschlafene Stadt gewaltig aufzurütteln. Denn hinter deren idyllischer Fassade hat fast jeder etwas zu verbergen …
Weitere Informationen zu Elizabeth George sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Elizabeth George
Wer Strafe verdient
Ein Inspector-Lynley-Roman
Ins Deutsche übertragen vonCharlotte Breuer, Norbert Möllemann und Marion Matheis
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel
»The Punishment she deserves«
bei Viking, a Penguin Random House Company, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2018
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Susan Elizabeth George
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Friederike Arnold
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Entwurfs von Darren Haggar
Umschlagmotiv: Wolken: Getty Images / Stijn Dijkstra / EyeEm
Stadt: Andrew Compton / Alamy Stock FotoTh · Herstellung: Han
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-22532-2V004
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Tom, Ira und FrankMit Dank und Zuneigung.Irgendwie habe ich Glück gehabt.
Warum aus freien Stücken mit den Folterstrickenan Zukunft und Vergangenheit sich binden?Der Geist, der über Geisteskraft hinaus das Morgenzu formen sucht, kann niemals Ruhe finden.
Rumi
Der Augenblick hat größre Tiefe als die Zukunft.Was kannst du noch einmal erntenVom Felde der Zukunft?
Rabia von Basra
TEIL 1
15. Dezember
BAKER CLOSELUDLOWSHROPSHIRE
In Ludlow begann es zu schneien, während die meisten Leute noch schnell den Abwasch erledigten, um es sich anschließend für den Abend vor dem Fernseher gemütlich zu machen. Nach Einbruch der Dunkelheit gab es in der Stadt eigentlich auch nicht viel mehr zu tun, als sich von irgendeiner Sendung berieseln zu lassen oder sich auf den Weg in einen Pub zu machen. Und da es seit einigen Jahren immer mehr Rentner nach Ludlow zog, die in mittelalterlichem Gemäuer Ruhe und Frieden suchten, wurden selten Klagen über mangelndes Abendprogramm laut.
Wie die meisten anderen in Ludlow war Gaz Ruddock auch gerade beim Abwasch, als er bemerkte, dass es anfing zu schneien. In der Fensterscheibe über seiner Spüle erblickte er sein Spiegelbild und das des alten Mannes neben sich, der das Geschirr abtrocknete. Doch eine kleine Lampe im hinteren Teil des schmalen Gartens beleuchtete die fallenden Schneeflocken. Schon nach wenigen Minuten klebte so viel Schnee an der Fensterscheibe, dass es aussah wie eine Spitzengardine.
»Das gefällt mir nicht. Hab ich doch schon oft gesagt. Aber es nützt ja nichts.«
Gaz schaute zu dem Alten hinüber. Er glaubte nicht, dass er über den Schnee redete, und er hatte richtig vermutet, denn Robert Simmons schaute nicht zum Fenster, sondern betrachtete die Spülbürste, mit der Gaz gerade einen Teller säuberte.
»Das Ding ist unhygienisch«, sagte der alte Rob. »Ich hab’s dir schon hundert Mal gesagt, und du hörst nicht auf mich.«
Gaz lächelte, aber er lächelte nicht den alten Rob an – so nannte er ihn immer, als gäbe es auch einen jungen Rob –, sondern sein eigenes Spiegelbild. Er tauschte mit dem Gaz im Fenster einen wissenden Blick aus. Rob beklagte sich jeden Abend über die Spülbürste, und Gaz erklärte ihm jeden Abend, dass seine Methode wesentlich hygienischer war, als Gläser, Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen in Seifenlauge zu tauchen, so als würden sie sich nach jedem Tauchvorgang selbst reinigen.
»Das Einzige, was besser ist als das hier«, sagte Gaz jeden Abend und wedelte mit der Bürste, »ist eine Spülmaschine. Ein Wort von dir, und ich besorg uns eine, Rob. Geht ganz schnell. Ich schließ sie sogar selber an.«
»Pah«, erwiderte Rob dann. »Ich bin sechsundachtzig Jahre ohne so eine Kiste ausgekommen, dann werd ich’s wohl auch ohne noch bis ins Grab schaffen. Moderner Schnickschnack.«
»Aber eine Mikrowelle hast du«, gab Gaz zurück.
»Das ist was anderes«, lautete die lapidare Antwort.
Wenn Gaz fragte, inwiefern es etwas anderes war, eine Mikrowelle zu besitzen, als eine Spülmaschine anzuschaffen, erntete er jedes Mal die gleiche Reaktion: ein Schnauben, ein Achselzucken und ein »Ist einfach so«, und damit war die Diskussion beendet.
Im Prinzip war es Gaz auch egal. Er kochte sowieso kaum, es gab also nie viel Abwasch. Heute hatte es Backkartoffeln gegeben, gefüllt mit Chili con Carne aus der Dose, dazu Mais und grünen Salat. Das meiste davon hatte er in der Mikrowelle zubereitet, und die Dose hatte eine Aufreißlasche gehabt, er hatte nicht mal einen Öffner gebraucht. Es gab also nicht mehr zu spülen als zwei Teller, ein bisschen Besteck, einen hölzernen Kochlöffel und zwei Henkeltassen, aus denen sie ihren Tee getrunken hatten.
Gaz hätte den Abwasch auch allein erledigen können, aber der alte Rob half gern. Der Alte wusste, dass Abigail, sein einziges Kind, jede Woche anrief und sich bei Gaz nach dem Wohlbefinden ihres Vaters erkundigte, und Gaz sollte ihr sagen, dass sein Schützling noch genauso voller Saft und Kraft war wie an dem Tag, als er eingezogen war. Aber der alte Rob würde auch ohne die regelmäßigen Anrufe seiner Tochter darauf bestehen, seinen Teil beizutragen, das wusste Gaz. Schließlich hatte der Alte nur unter der Bedingung zugestimmt, einen Betreuer ins Haus zu lassen.
Nach dem Tod seiner Frau hatte er sechs Jahre lang allein gelebt, aber seine Tochter fand, dass er allmählich allzu vergesslich wurde. Zweimal täglich musste er seine Medikamente nehmen. Und falls er stürzte, würde ihn niemand finden. Sie brauche jemanden, der sich um ihren Vater kümmerte, hatte Abigail erklärt, und vor die Wahl gestellt, sein Zuhause mit einem sorgfältig ausgewählten Fremden zu teilen oder aus Ludlow wegzuziehen und bei seiner Tochter, ihren vier Kindern und ihrem Mann zu wohnen, den Rob seit dem Tag nicht ausstehen konnte, als er vor der Tür gestanden hatte, um seine einzige Tochter in eine Disco in Shrewsbury zu entführen, hatte er sich mit einer solchen Begeisterung für den Hausgenossen entschieden, als wäre der sein Lebensretter.
Und dieser Hausgenosse war Gary Ruddock, genannt Gaz. Er hatte auch noch einen Job als Hilfspolizist, aber in dieser Funktion drehte er meist nur abends seine Runden und konnte deshalb zwischendurch nach dem alten Herrn sehen. Das Arrangement war eigentlich perfekt: Von dem, was er als Hilfspolizist verdiente, blieb kaum etwas übrig, aber der Job bei dem alten Rob verschaffte ihm nicht nur einen Wohnplatz, sondern er verdiente zusätzlich auch noch Geld.
Rob hängte das säuberlich gefaltete Geschirrtuch zum Trocknen über den Herd, und Gaz säuberte das Abtropfbrett. Gaz’ Handy klingelte, und er warf einen kurzen Blick aufs Display. Er überlegte kurz, ob er den Anruf einfach ignorieren sollte, da Rob ihn schief beäugte. Er wohnte jetzt lange genug bei dem Alten und wusste, was als Nächstes passieren würde. Wenn am Abend ein Anruf kam, mussten sie meistens ihre Pläne ändern.
»Gleich fängt Let’s Dance an«, sagte Rob. Let’s Dance war seine Lieblingssendung. »Und auf Sky kommt ein Film mit Clint Eastwood. Der mit dieser verrückten Frau.«
»Sind nicht alle Frauen verrückt?« Gaz beschloss, den Anruf nicht anzunehmen, und er wurde auf die Mailbox umgeleitet. Er würde die Nachricht abhören, sobald er den alten Rob in seinen Sessel bugsiert hatte, die Fernbedienung in Reichweite.
»Aber die übertrifft alle«, sagte der Alte. »Das ist die, die immer dieses Lied im Radio hören will. Du weißt schon. Dann will sie Clint Eastwood unbedingt haben – vielleicht treiben sie’s auch miteinander, kann mich nicht erinnern, aber Männer sind ja so blöd, wenn’s um Frauen geht – und dann bricht sie bei ihm ein und verwüstet seine Wohnung.«
»Wunschkonzert für einen Toten«, sagte Gaz.
»Du erinnerst dich also?«
»Allerdings. Nach dem Film wollte ich nichts mehr mit Frauen zu tun haben.«
Der alte Rob lachte, was jedoch zu einem Hustenanfall führte. Das klang überhaupt nicht gut, dachte Gaz. Rob hatte im Alter von vierundsiebzig nach einer Bypass-Operation das Rauchen aufgegeben, aber da er sechzig Jahre geraucht hatte, konnte er immer noch Krebs oder ein Emphysem kriegen.
»Alles in Ordnung, Rob?«, fragte Gaz.
»Klar. Wieso denn nicht?« Der alte Rob bedachte ihn mit einem giftigen Blick.
»Stimmt eigentlich«, sagte Gaz. »Komm, wir schalten die Glotze an. Oder musst du vorher noch aufs Klo?«
»Was redest du da? Ich werd doch wohl noch wissen, wann ich pissen muss!«
»Ich hab auch nichts Gegenteiliges behauptet.«
»Also, wenn ich einen brauch, der mich zum …«
»Ich hab’s kapiert.« Gaz folgte dem alten Herrn ins Wohnzimmer, das nach vorne hinaus lag. Es gefiel ihm nicht, wie Rob beim Gehen schwankte und sich mit der Hand an der Wand abstützte. Er sollte eigentlich einen Stock benutzen, aber der Alte war ein sturer Hund. Wenn er keinen Stock benutzen wollte, dann konnte ihn keiner eines Besseren belehren.
Im Wohnzimmer ließ der alte Rob sich in seinen Ohrensessel sinken. Gaz schaltete den Elektrokamin ein und zog die Vorhänge zu. Dann kramte er die Fernbedienung unter einem Sofakissen hervor und suchte den Sender, auf dem Let’s Dance lief. Noch fünf Minuten, bis die Sendung anfing, Zeit genug, um die allabendliche Ovomaltine anzurühren.
Er nahm Robs Henkeltasse aus dem Schrank, die ein Foto von seinen Enkelkindern zusammen mit dem Weihnachtsmann zierte. Das Foto war vom vielen Spülen ein bisschen verblasst, und der Henkel in Form eines Tannenzweigs war angeschlagen. Aber der alte Rob weigerte sich, seine Ovomaltine aus einer anderen Tasse zu trinken. Er beklagte sich zwar gern wortreich über seine Enkel, aber Gaz hatte schnell begriffen, dass er in Wirklichkeit ganz vernarrt in sie war.
Als Gaz mit der heißen Ovomaltine ins Wohnzimmer ging, klingelte sein Handy schon wieder. Auch diesmal ließ er es klingeln. Let’s Dance hatte gerade angefangen, und der Vorspann war immer das Beste an der Sendung.
Rob konnte sich gar nicht sattsehen an den Frauen, die am Wettbewerb teilnahmen, und den Profitänzerinnen, die den anderen den Cha-Cha-Cha, den Foxtrott, den Wiener Walzer und das ganze Zeug beibringen sollten. Er liebte die Kostüme, die mehr zeigten als verhüllten, und wenn die Frauen ihre Titten wackeln ließen, konnte man nicht leugnen, dass Robert Simmons mit seinen sechsundachtzig Jahren noch quicklebendig war.
»Sieh sie dir an, Junge«, seufzte der alte Rob. Er hob seine Henkeltasse, als wollte er dem Fernseher zuprosten. »Schon mal so hübsche Möpse gesehen? Wenn ich zehn Jahre jünger wär, würde ich den Mädels zeigen, was man mit solchen Möpsen macht!«
Gaz musste unwillkürlich lachen, aber eigentlich wurden Frauen da, wo er herkam, verehrt, sie wurden auf ein Podest gehoben und alles. Sicher, sie besaßen eine Sexualität. Aber nur weil das zu Gottes Plan gehörte, und dieser Plan sah nicht vor, dass sie Männern zu Diensten standen und ihre »Möpse« zeigten, erst recht nicht im Fernsehen. Aber der alte Rob war nun mal ein geiler alter Bock, daran ließ sich nichts mehr ändern, und Let’s Dance war für ihn das Highlight der Woche.
Gaz nahm eine Decke von der Sofalehne und legte sie Rob um die dünnen Beine. Er schlug die Fernsehzeitschrift auf und vergewisserte sich, dass Wunschkonzert für einen Toten tatsächlich später laufen würde. Dann ließ er den alten Rob, der leise über das alberne Gequatsche des Moderators und der Preisrichter lachte, allein im Wohnzimmer sitzen und ging in die Küche.
Er nahm sein Handy von der Anrichte und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Er hatte ein ungutes Gefühl wegen des Anrufs. Am West Mercia College ging das Wintersemester zu Ende. Die Klausuren waren geschrieben, die Koffer für die Weihnachtsferien gepackt, und wahrscheinlich wurden im Moment jeden Abend feuchtfröhliche Partys gefeiert.
Er tippte auf Rückruf, und Clo meldete sich nach dem ersten Läuten. »Wir haben hier Schnee, Gaz«, sagte sie. »Ihr auch?«
Gaz wusste, dass sie keinen Wetterbericht hören wollte, aber es war ein netter Anfang für ein Gespräch, das sicherlich mit einer Bitte enden würde, die sie sich lieber sparen sollte. Er würde es ihr nicht leicht machen. »Ja, hier auch«, sagte er. »Die Straßen werden wieder eine einzige Schlitterbahn sein, aber so bleiben wenigstens die meisten zu Hause.«
»Das Semester ist zu Ende, Gaz. Die jungen Leute bleiben nicht zu Hause. Wenn das Semester vorbei ist, lassen die sich nicht von Schnee oder Matsch oder Regen abschrecken.«
»Die müssen ja auch die Post nicht austragen«, sagte er.
»Hä?«
»Schnee, Matsch, Regen. Für Briefträger spielt das keine Rolle.«
»Glaub mir, die könnten genauso gut Briefträger sein. Das Wetter schreckt sie nicht ab.«
Er wartete. Sie brauchte nicht lange.
»Könntest du mal nach ihm sehen, Gaz? Du kannst es doch auf deiner normalen Runde machen. Du drehst heute ohnehin deine Runde, oder? Bei dem Wetter bist du bestimmt nicht der einzige Hilfspolizist, der gebeten wird, mal in den Pubs nach den jungen Leuten zu sehen.«
Das bezweifelte Gaz. West Mercia war das einzige College in ganz Shropshire, und es war ziemlich unwahrscheinlich, dass die anderen Hilfspolizisten ohne Grund im Schnee ihre Runden absolvierten. Aber er widersprach ihr nicht. Er mochte Clo. Er mochte ihre Familie. Natürlich nutzte sie seine Gefühle aus, aber er konnte ihr die Bitte nicht abschlagen.
Trotzdem sagte er: »Es wird Trev nicht gefallen. Aber das weißt du, oder?«
»Trev wird nichts davon erfahren, weil du es ihm nicht erzählen wirst. Und von mir erfährt er’s erst recht nicht.«
»Meinetwegen brauchst du dir keine Sorgen zu machen, ich petze nicht.«
Einen Moment lang erwiderte sie nichts. Er sah sie direkt vor sich. Falls sie noch bei der Arbeit war, saß sie an einem Schreibtisch, der so ordentlich war wie sie selbst. Aber falls sie zu Hause war, war sie im Schlafzimmer und trug etwas, das ihrem Mann gefiel. Sie hatte ihm mehr als einmal im Scherz erzählt, dass Trev es gern mochte, wenn sie weich, anschmiegsam und gefügig war, lauter Eigenschaften, die eigentlich überhaupt nicht zu ihr passten.
»Wie gesagt, Semesterende«, fuhr sie schließlich fort. »Die Straßen sind vereist, die Studenten besaufen sich nach dem Examen … Es wird keinem merkwürdig vorkommen, wenn du unterwegs bist und dich vergewisserst, dass alle in Sicherheit sind, einschließlich Finnegan.«
Da war was dran. Außerdem hatte ein Spaziergang nicht nur den Vorteil, dass man an der frischen Luft war. Er sagte: »Also gut. Weil du’s bist. Aber ich geh erst später los. Um die Zeit führt noch keiner was Böses im Schilde.«
»Alles klar«, sagte sie. »Danke, Gaz. Du erzählst mir doch, was er treibt?«
»Sicher«, antwortete er.
ST. JULIAN’S WELLLUDLOWSHROPSHIRE
Missa Lomax betrachtete die Kleidungsstücke, die ihre Freundin Dena – von allen Ding genannt – auf dem Bett ausgebreitet hatte. Drei Röcke, ein Kaschmirpullover, zwei Seidenblusen, ein Pulli, am Ausschnitt bestickt mit silbernen Pailletten, die aussahen wie winzige Eiszapfen. »Der schwarze ist am besten, Missa. Der ist total elastisch.«
Auf elastisch kam es an. Die Kleider gehörten alle Ding, und sie und Missa hatten nicht die gleiche Figur. Ding war zierlich und hatte weibliche Rundungen, während Missa eher birnenförmig gebaut war, mit ziemlich ausladenden Hüften, weswegen sie immer auf ihr Gewicht aufpassen musste, außerdem war sie einen Kopf größer als ihre Freundin. Aber sie hatte nichts nach Ludlow mitgebracht, um sich fürs Ausgehen feinzumachen. Als sie sich im College eingeschrieben hatte, hatte sie überhaupt nicht an Partys gedacht, denn sie war nach Ludlow gekommen, um Biologie, Chemie, Mathe und Französisch zu studieren, bevor sie weiter auf die Uni gehen würde.
»Die sind mir alle zu kurz, Ding«, sagte sie und zeigte auf die Röcke.
»Kurz ist modern, und was spielt das schon für eine Rolle?«
Für Missa spielte es eine große Rolle, doch sie sagte nur: »Mit so einem Rock kann ich nicht Fahrrad fahren.«
»Bei dem Wetter fährt niemand mit dem Fahrrad.« Das sagte Rabiah Lomax, die gerade in Missas Zimmer kam. Ein lilafarbener Trainingsanzug schlackerte um ihren dünnen Körper, und sie war barfuß. Passend zur Weihnachtszeit hatte sie ihre Zehennägel abwechselnd rot und grün lackiert, und die Nägel der großen Zehen zierte ein kleiner, goldener Tannenbaum. »Ihr nehmt ein Taxi«, fuhr sie fort. »Ich bezahle.«
»Aber Ding ist mit dem Fahrrad gekommen, Gran«, sagte Missa. »Sie kann doch nicht …«
»Das war total leichtsinnig von dir, Dena Donaldson«, fiel Missas Großmutter ihr ins Wort. »Ihr fahrt mit dem Taxi. Dein Fahrrad kannst du ein andermal abholen, nicht wahr?«
Ding wirkte erleichtert. »Danke, Mrs Lomax«, sagte sie. »Wir geben Ihnen das Geld zurück.«
»Unsinn«, sagte Rabiah. »Ich freue mich, wenn ihr ausgeht und euren Spaß habt.« Dann sagte sie zu Missa: »Du wirst doch mal einen Abend ohne Pauken auskommen können. Das Leben besteht aus mehr als Schulbüchern und der Pflicht, die Eltern zufriedenzustellen.« Missa warf ihrer Großmutter einen Blick zu, sagte jedoch nichts. Rabiah fuhr fort: »Also, was haben wir denn hier Schönes?« Sie betrachtete die Kleidungsstücke auf dem Bett und nahm den schwarzen Rock. Missa sah, wie Ding vor Freude strahlte.
»Zieh den mal an«, sagte Rabiah. »Mal sehen, wie er sitzt. Ich würde dir was von mir leihen, aber da ich fast nur noch Tanz- und Laufklamotten habe, würdest du in meinem Kleiderschrank nichts Passendes finden. Außer vielleicht Schuhe. Du brauchst auch ein Paar Schuhe.« Sie wedelte mit den Händen und eilte in ihr Zimmer, während Missa sich die Turnschuhe und die Jeans auszog und Ding in der Kommode nach einer Strumpfhose suchte, »die nicht aussah wie von Oxfam«, wie sie sich ausdrückte.
Missa zwängte sich in Dings Rock. Er war wirklich sehr elastisch, schnitt aber trotzdem am Bauch ziemlich ein. »Pff«, stöhnte sie. »Ich weiß nicht, Ding.«
Ding blickte von der Kommode auf, in der Hand eine schwarze Strumpfhose. »Super!«, rief sie aus. »Genau das Richtige! Die Jungs schmelzen dahin, wenn sie dich darin sehen!«
»Darauf lege ich eigentlich keinen Wert.«
»Klar tust du das. Es bedeutet ja nicht, dass du irgendwas mit ihnen machen musst. Hier, halt mal. Ich hab noch was ganz Besonderes für dich.« Sie gab Missa die Strumpfhose, öffnete ihren Rucksack und förderte einen Spitzen-BH zutage.
»Da pass ich niemals rein«, wehrte Missa ab.
»Der ist nicht von mir«, sagte Ding. »Es ist ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk von mir für dich. Hier, nimm. Er beißt nicht.«
Missa trug nichts aus Spitze. Aber Ding würde nicht lockerlassen.
»Der ist aber schön!«, rief Rabiah aus, als sie sah, was Ding in der Hand hielt. »Wo kommt der denn her?«
»Mein Weihnachtsgeschenk für Missa«, sagte Ding. »Endlich keine Leibchen mehr!«
»Ich trage keine Leibchen!«, protestierte Missa. »Ich mag einfach keine Spitze … Die kratzt.«
Rabiah sagte: »Pah, was macht das schon … Dena Donaldson, ist das ein Push-up-BH?«
Ding kicherte. Missa spürte, wie ihre Wangen glühten. Aber sie nahm den BH, kehrte den anderen den Rücken zu und probierte ihn an. Dann schaute sie in den Spiegel, und als sie die Wölbung ihrer Brüste sah, wurden ihre Wangen noch heißer.
»Hier, hier!« Ding warf Missa den Pulli mit den Eiszapfen zu, und Missa zog ihn über. Der Ausschnitt brachte das Ergebnis des Push-up-BHs besonders gut zur Geltung. »Suuuu-per!«, juchzte sie. »Nicht zu fassen!« Dann zu Rabiah: »Oooch, sind die süß, Mrs Lomax! Sind die auch für Missa?«
Missa entging nicht, dass damit die Schuhe gemeint waren. Sie betrachtete sie ebenfalls und fragte sich, wann ihre Großmutter sie zuletzt getragen haben mochte. Die Rabiah, die sie kannte, trug normalerweise Sportschuhe, wenn sie nicht gerade barfuß lief oder ihre Square-Dance-Schuhe anhatte. Nachdem sie in Rente gegangen war, hatte sie alles Modische aus ihrem Kleiderschrank entfernt. Aber die Schuhe sahen aus, als stammten sie noch aus der Zeit, als Rabiah Lehrerin gewesen und offenbar zum Tanzen ausgegangen war.
»Ich weiß nicht«, sagte Missa skeptisch.
»Ach, Quark«, sagte Rabiah. »Darin kannst du problemlos laufen. Probier sie mal an.«
Sie passten. So gerade. Rabiah bestimmte, dass Missa die Schuhe anziehen würde, »und keine Widerrede. Bei dem Wetter geht ihr ja sowieso nicht zu Fuß. Und ich vermute mal, Dena Donaldson, dass du auch noch ein paar Schminksachen in deinem Rucksack hast. Du kannst dich also weiter um Missas Verschönerung kümmern, während ich ein Taxi bestelle.«
»Soll ich ihr auch die Augenbrauen zupfen?«, fragte Ding.
»Das volle Programm«, sagte Rabiah.
QUALITY SQUARELUDLOWSHROPSHIRE
Als das Taxi kam, machte Missas Großmutter ein Riesengewese darum, die Fahrt im Voraus zu bezahlen – also ins Stadtzentrum und auch wieder zurück – und klarzustellen, wie sie sich ausdrückte, was die beiden Mädchen dem Fahrer am Ende des Abends schuldeten, nämlich nichts.
»Ich hoffe, Sie haben das verstanden, mein Guter«, sagte Rabiah nachdrücklich zu dem Taxifahrer.
Der Mann sprach kaum Englisch, und Ding bezweifelte, dass er sie zum Quality Square bringen würde, geschweige denn später zurück nach St. Julian’s Well. Doch er nickte und vergewisserte sich mit ernster Miene, dass Ding und Missa sich auch wirklich auf dem Rücksitz seines Audi ordnungsgemäß anschnallten.
Ein Audi, dachte Ding, dann liefen die Geschäfte wohl gut. Aber als der Wagen um die Ecke bog, geriet er auf der vereisten Fahrbahn ins Schleudern, er brauchte vermutlich neue Reifen. Trotzdem lehnte sie sich zurück, drückte Missa die Hand und sagte: »Das wird ein grandioser Abend. Und den haben wir verdient!«
In Wirklichkeit war es Missa, die einen grandiosen Abend verdient hatte, denn Ding sorgte sowieso dafür, dass sie möglichst oft möglichst viel Spaß hatte. Bei Missa sah das ein bisschen anders aus.
Ding googelte jeden, mit dem sie sich vielleicht anfreunden wollte, und nach der dritten gemeinsamen Mathestunde war sie zu dem Schluss gekommen, dass sie das Mädchen mit der dunklen Haut und der süßen kleinen Lücke zwischen den Schneidezähnen gern kennenlernen würde. Also hatte sie im Internet nach ihr gesucht, ein paar Links angeklickt und herausgefunden, dass Melissa Lomax eine von drei Schwestern und die mittlere Schwester zehn Monate zuvor gestorben war. Sie hatte auch in Erfahrung gebracht, woher Melissa stammte: aus Ironbridge. Ihr Vater war Apotheker, ihre Mutter Kinderärztin, und ihre Großmutter Rabiah hatte einmal zu der Showtanzgruppe The Rockettes gehört, war bis zu ihrer Pensionierung Lehrerin gewesen und hatte den letzten London-Marathon in ihrer Altersgruppe gewonnen.
Ding machte es Spaß, Informationen über andere Leute zu sammeln, und eigentlich ging sie davon aus, dass das bei allen anderen genauso war. Sie wunderte sich jedes Mal, wenn sie mitbekam, dass andere nicht im Internet herumspionierten, wenn sie jemanden als potentiellen Freund oder potentielle Freundin in Betracht zogen. Nach Dings Meinung konnte man mit ein bisschen Detektiv spielen viel Zeit sparen. Zum Beispiel war es immer gut zu wissen, ob jemand früher mal eine Tendenz zum Psychopathen an den Tag gelegt hatte.
Von St. Julian’s Well aus war es nicht weit bis zum Quality Square, allerdings dauerte die Fahrt wegen des Schnees etwas länger als gewöhnlich. Bei dem Wetter war fast niemand unterwegs – sehr ungewöhnlich am Semesterende –, aber die Corve Street und der Bull Ring waren hell erleuchtet, und die Weihnachtslichter in den Schaufenstern sorgten für eine so heitere Atmosphäre, dass man sich nicht wundern würde, wenn plötzlich ein paar Weihnachtssänger auftauchten wie in einem Roman von Dickens.
Ding freute sich nicht auf Weihnachten. Schon seit Jahren freute sie sich nie auf irgendwelche Feiertage. Aber wenn es sein musste, fiel es ihr nicht schwer, ein freudiges Gesicht zu machen, und jetzt sagte sie: »Was für eine Pracht! Wie im Märchenland, oder?«
Missa schaute aus dem Fenster, und Ding sah ihr ihre Skepsis an – nicht wegen der hübschen Weihnachtsdeko, an der sie vorbeifuhren, sondern wegen der Party, zu der sie unterwegs waren. »Glaubst du, es gehen heute viele Leute aus?«
»Na, hör mal! Die Weihnachtsferien haben angefangen! Alle Klausuren sind geschrieben! Da sind jede Menge Leute unterwegs, vor allem da, wo wir hinfahren.«
Mit Kneipen kannte Ding sich aus, denn sie wohnte nicht weit vom West Mercia College entfernt, und sie hatte sich in dem Pub Hart & Hind am Quality Square, zu dem sie unterwegs waren, schon oft mit ein paar Freunden die Kante gegeben.
Das Taxi brachte sie so nah wie möglich an ihr Ziel. Sie fuhren durch die Altstadt von Ludlow, vorbei an mittelalterlichen Gebäuden, durch immer engere Straßen, die zum Castle Square führten, einem länglichen kopfsteingepflasterten Platz, über dem die Burgruine aus dem zwölften Jahrhundert thronte. Hier hatten jahrhundertelang Märkte stattgefunden, auf denen von Schweinefleisch-Pies bis hin zu Suppennäpfen alles feilgeboten worden war. In den windschiefen Häusern an drei Seiten des Platzes gab es Läden, Cafés, kleine Hotels und Restaurants.
An der Ecke King Street ließ der Taxifahrer sie aussteigen. Die sehr schmale Straße bildete die einzige Zufahrt zum Quality Square; zwar konnte ein verwegener Fahrer es bis zum Platz schaffen, aber da die King Street auch die einzige Straße war, durch die man wieder zurückgelangte, nahmen nur diejenigen, die über den Läden und Restaurants um den Platz herum wohnten, diese Strapaze auf sich.
Entlang der vierten Seite des Platzes verlief eine kleine Straße, die zu einer großen Terrasse führte, und dorthin machten die beiden Freundinnen sich auf den Weg, nachdem der Taxifahrer ihnen seine Handynummer gegeben hatte, damit sie ihn anrufen konnten, wenn sie abgeholt werden wollten. »Komm«, sagte Ding zu Missa, die die Karte des Fahrers mit einem dankbaren Lächeln eingesteckt hatte. »Jetzt gehen wir ordentlich feiern.«
Sie betraten die Gasse, vorsichtig darauf bedacht, in ihren hochhackigen Schuhen auf dem Kopfsteinpflaster nicht umzuknicken. Vor ihnen lag der Platz, und wegen des Schnees mussten sie aufpassen, dass sie nicht ausrutschten. Sie schoben sich zwischen zwei geparkten Autos hindurch und gingen an einer Kunstgalerie vorbei, vor der die metallene Skulptur einer leicht bekleideten Frau unter einem Mantel aus Schnee stand. Die Zweige der immergrünen Sträucher, die um die Figur herum standen, bogen sich bereits unter dem weißen Gewicht.
Wie Ding vorausgesagt hatte, waren sie nicht die Einzigen auf dem Weg zum Pub. Und als sie in die Straße einbogen, sahen sie, dass die Terrasse des Pubs bereits mit zahlreichen Rauchern bevölkert war. Einige hatten ihre Getränke auf den Fenstersimsen abgestellt, andere saßen an Tischen, über denen elektrische Heizstrahler angebracht waren, und hatten sich gegen die Kälte zusätzlich in Decken gehüllt.
Das sei das Hart & Hind, erklärte Ding ihrer Freundin, eine ehemalige Kutschstation aus dem sechzehnten Jahrhundert und der Lieblingspub aller College-Studenten, die gern dem Alkohol zusprachen. Natürlich gebe es reichlich Pubs in der Stadt, fuhr Ding fort, aber hier gingen alle am liebsten hin, und zwar nicht nur, weil es auf dem Weg liege und man sich gleich nach dem Ende eines Seminars oder einer Vorlesung volllaufen lassen könne, sondern auch, weil der Wirt wegschaue, wenn »bewusstseinserweiternde Substanzen der illegalen Art« gegen Geld den Besitzer wechselten.
»Ich nehme keine Drogen, Ding!«, sagte Missa.
»Weiß ich doch«, sagte Ding. »Du trinkst ja noch nicht mal Alkohol.« Dann fügte sie in verschwörerischem Ton hinzu: »Über dem Pub gibt’s auch Zimmer. Klar, war ja auch früher mal ’ne Kutschstation. Aber die vermietet er nicht.«
»Wer?«
»Jack. Der Typ, dem der Laden gehört. Es gibt zwei – Zimmer, mein ich –, und wenn man ihm Geld gibt, kann man sich da ein bisschen …«
Missa runzelte die Stirn. »Aber wenn er die Zimmer gar nicht vermietet … wofür sind die dann?«
Ding hätte beinahe gesagt, »Mensch, du weißt doch, was ich meine«, doch dann fiel ihr ein, dass Missa es eben nicht wusste, sondern dass man es ihr erklären musste.
Ding hatte schnell gemerkt, dass Missa ein Riesentheater um ihre Jungfräulichkeit machte. Sie schien aus einem anderen Jahrhundert zu stammen, denn sie bewahrte sich tatsächlich auf für ihren Märchenprinzen. Und wenn der Prinz mit dem gläsernen Schuh aufkreuzte, auf der Suche nach einer Prinzessin, würde sie im Umkreis von tausend Kilometern die einzige Jungfrau sein.
Ding hatte ihre Jungfräulichkeit mit dreizehn verloren. Sie hatte es schon früher versucht, aber die Jungs hatten sich erst für sie interessiert, als sie richtige Brüste hatte. Als es dann endlich passiert war, war sie sehr erleichtert gewesen – sie war entjungfert worden und hatte damit eine Sorge weniger. Sie hatte keine Ahnung, warum Missa sich ihre aufsparte. Dings Erinnerung an den »großen Augenblick« begann mit der entsetzten, wenn auch im betrunkenen Zustand gestellten Frage: »Was?! Das Ding willst du in mich reinstecken?« Dann hatte der Typ sie auf die harte Holzbank hinten in der St. James Church gedrückt, neun Mal zugestoßen und war beim zehnten Mal mit einem Grunzen gekommen.
Als sie sich durch die Menge schoben, öffnete sich die Tür des Pubs. Laute Musik schallte ihnen entgegen. Die Bee Gees, dachte Ding. Lieber Himmel. Gleich würden sie auch noch ABBA auflegen. Sie nahm Missa an der Hand und zog sie hinein. Ein langer, mit dunklen Eichenpaneelen getäfelter Flur war brechend voll – nackte Schultern, nackte Beine, Glitzer, Pailletten, hautenge Hosen –, die sich im Rhythmus zu Stayin’ Alive bewegten.
Im Pub war die Musik so laut, dass die Wände wackelten. Das sollte die Leute zum Tanzen animieren, damit sie durstig wurden und möglichst viel Bier, Cider und Cocktails bestellten. Ding kämpfte sich mühsam durch die Menge der Studenten, die sich zur Musik drehten, SMS schrieben, Selfies schossen, vor zum dicht besetzten Tresen, hinter dem der Wirt und sein Neffe ihr Bestes taten, um den Bestellungen nachzukommen.
Ding schnappte nur Bruchteile von geschrienen Gesprächen auf.
»Nein! Hat er nicht!«
»Aber hallo!«
»… und dann hat er meterweise danebengepinkelt. Männer sind so was von …«
»… über die Ferien. Ich sag dir Bescheid, wenn …«
»… an die Côte d’Azur über Silvester – frag mich nicht, warum …«
»… glaubt tatsächlich, wenn ich mit ihm ins Bett geh, kann er …«
Es war gar nicht so einfach, in dem Gedränge Missas Hand festzuhalten. Plötzlich sah sie an einem Tisch unter alten Fotos von Ludlow einen ihrer beiden Mitbewohner sitzen. Es war Bruce Castle, mit dem sie häufig ins Bett ging. Alle nannten ihn Brutus, ein Spitzname, der in humorvollem Widerspruch zu seiner kleinen Statur stand, und er trank Cider, wie Ding feststellte. Falls die beiden leeren Pintgläser vor ihm etwas zu bedeuten hatten, dann wusste Ding genau, was er vorhatte: Er wollte sich besaufen, um eine Ausrede zu haben, falls ihn nächste Woche irgendein Mädchen beschuldigte, er hätte ihr unter den Rock gelangt.
Wie immer hatte sich Brutus total in Schale geworfen, und als Ding und Missa zu ihm an den Tisch kamen, sagte er »Affenscharf« zu Missa, womit er ihre knallengen Klamotten meinte. »Setz dich zu mir, du fühlst dich bestimmt gut an.«
Ding setzte sich neben ihn und bugsierte Missa auf einen Stuhl. »Halt die Klappe«, sagte sie zu Brutus. »Glaubst du im Ernst, dass es Frauen gefällt, so blöd angequatscht zu werden?«
Brutus war es kein bisschen peinlich. »Ich weiß gar nicht, wo ich bei ihr zuerst hinfassen soll, Arsch oder Titten«, sagte er, was ihm einen Faustschlag gegen den Oberarm einbrachte, da, wo es wehtat. »Verdammt, Ding! Was ist denn mit dir los?«
»Besorg uns einen Drink!«, erwiderte Ding.
»Ich will keinen …«, sagte Missa.
Ding winkte ab. »Das ist kein Schnaps, das ist bloß Cider. Schmeckt dir bestimmt.« Sie sah Brutus eindringlich an. Er stemmte sich von seinem Stuhl hoch und wankte durch die Menge zum Tresen. Ding schaute ihm stirnrunzelnd nach. Sie konnte es nicht leiden, wenn er betrunken war. Ein Schwips war okay. Bekifft sein auch. Aber wenn Brutus vollgetankt hatte, war er nicht er selbst, und sie konnte nicht verstehen, warum er so früh am Abend schon so neben der Spur war. So hatte sie sich das überhaupt nicht vorgestellt.
Sie beobachtete, wie Missa sich im Pub umschaute und alles in sich aufnahm: überall lachende, spärlich bekleidete Frauen und Männer, die so dicht wie möglich neben ihnen standen und sie anbaggerten. Sie fragte sich, ob ihre Freundin mitbekam, was sich in der Nähe des Tresens abspielte. Der Wirt Jack Korhonen warf gerade einem jungen Mann, der seinen Arm um eine junge Frau in einem hautengen Paillettenkleid gelegt hatte, einen Zimmerschlüssel zu. Der junge Mann fing den Schlüssel mit einer Hand und drehte seine Gefährtin, die sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, in Richtung Treppe.
Brutus kam zurück. Er brachte drei Pintgläser mit, von denen er eins vor Missa stellte. Ihre Freundin trank einen Schluck. Ob Missa wohl merkte, dass der Cider Alkohol enthielt?, überlegte Ding. Sie merkte es nicht. Der kohlensäurehaltige Cider schmeckte erfrischend, eine angenehme Art, schnell beschwipst zu werden.
Brutus rückte mit seinem Stuhl näher an Ding heran. »Du duftest heute wie eine Göttin«, flüsterte er ihr ins Ohr und legte ihr eine Hand auf den Oberschenkel. Sie packte seine Finger und bog sie nach hinten. Er schrie auf. »Hey! Was zum Teufel ist in dich gefahren?«
Ding brauchte nicht zu antworten, denn in dem Augenblick gesellte sich ihr anderer WG-Mitbewohner zu ihnen und sagte: »Fick dich, Brutus, probier’s nächstes Mal auf die romantische Tour.«
Brutus sagte: »Ist doch genau, was ich will. Dass jemand Brutus fickt.«
»Ich lach mich schlapp.« Finn Freeman schnappte sich einen Stuhl vom Nebentisch und beachtete die junge Frau nicht, die schrie: »Hey, der ist besetzt!«
Er ließ sich auf den Stuhl fallen, nahm Brutus’ Glas und trank einen großen Schluck. Dann verzog er das Gesicht. »Fuck, was für ein widerliches Gesöff!«
Ding merkte, dass Missa wegen Finns ordinärer Wortwahl peinlich berührt den Blick gesenkt hatte. Das war auch so etwas, was sie an ihrer Freundin rührend fand: Sie würde niemals herumpöbeln, und sie schämte sich auch nicht zu zeigen, dass es ihr unangenehm war, wenn andere es in ihrer Gegenwart taten.
Finn hingegen dachte sich überhaupt nichts dabei. Für jemanden, der sich den halben Schädel kahlrasiert hatte, um ihn sich tätowieren zu lassen, war er eigentlich ganz in Ordnung. Es sah zwar nicht besonders cool aus, aber das spielte auch keine große Rolle, fand Ding.
»Wer gibt mir ein Guinness aus?«, fragte Finn in die Runde.
»Wo wir gerade vom Saufen reden«, bemerkte Ding leichthin.
Aber Brutus stand auf und ging zum Tresen. Wenn er es nicht getan hätte, dann hätte Finn, egal, wie ekelhaft er den Cider fand, zuerst Brutus’ und dann Missas und Dings Glas ausgetrunken. Er hatte ein Alkoholproblem, aber das war, wie Ding in den letzten Monaten mitbekommen hatte, nur eins von seinen Problemen.
Sein größtes Problem war seine Mutter. Er nannte sie Big Mother wegen ihrer Neigung, sein Leben zu kontrollieren, in Anspielung auf Big Brother. Ihretwegen sträubte sich Finn, die Weihnachtsferien zu Hause zu verbringen, und wollte lieber seine Großeltern in Spanien besuchen. Allerdings hatte er das Geld für den Flug nicht. Als er in Spanien anrief, weil er seine Großmutter bitten wollte, ihm das Ticket zu spendieren, bekam er seinen Großvater an die Strippe. Der wiederum hatte Finn versprochen, ihm die Reise zu bezahlen, und sofort danach bei seiner Mutter angerufen, um sich zu vergewissern, dass es für sie in Ordnung war, wenn ihr einziger Sohn Weihnachten nicht mit seinen Eltern verbrachte.
Damit war Spanien für Finn gestorben. Er hatte noch zwei Tage in Ludlow rausgeschlagen und seiner Mutter vorgeschwindelt, er wirke an einem Ferienprogramm für Kinder mit, das von der Kirche veranstaltet werde. Der Himmel wusste, warum Finns Mutter ihm die Geschichte abgekauft hatte. Aber mehr als zwei Tage Freiheit waren nicht drin, und darüber war Finn ziemlich frustriert.
»Sag mal«, fragte er Missa gerade, »wie hat Ding dich eigentlich überredet, mit ihr auszugehen? Ich seh dich sonst immer nur mit der Nase in irgendeinem Buch.«
»Sie nimmt ihr Studium ernst«, sagte Ding.
»Im Gegensatz zu dir«, lautete Finns Antwort. »Dich hab ich jedenfalls noch nie beim Pauken erwischt.«
Brutus kam mit Finns Guinness. Er sagte: »Du bist mir was schuldig.«
»Wie immer.« Finn prostete ihnen allen zu. »Fröhliche Scheißweihnachten!« Er trank einen großen Schluck. »Jetzt wird’s ernst, Leute«, sagte er dann. »Jetzt wird gesoffen bis zum Abwinken.«
Ding musste grinsen. Finn wusste es nicht, aber sie hatten beide dasselbe vor.
QUALITY SQUARELUDLOWSHROPSHIRE
Das Komasaufen brachte eine Menge Probleme mit sich. Frauen übergaben sich in den Rinnstein, Männer pissten an Hauswände, die Gehwege waren übersät mit Flaschenscherben, in den Vorgärten wurden Beete zertrampelt und Mülltonnen umgeworfen. Es wurde lauthals auf der Straße gestritten und geprügelt, Handtaschen und Handys gestohlen … Die Folgen des Komasaufens waren zahlreich, und in den großen Städten, wo die Nachtklubs bis in die frühen Morgenstunden geöffnet hatten, ging es noch viel schlimmer zu.
In einer Kleinstadt wie Ludlow gab es nur Pubs und keine Nachtklubs, was die jungen Leute jedoch nicht vom Saufen abhielt. Schon in seiner ersten Woche als Hilfspolizist hatte Gaz Ruddock festgestellt, dass die Pubwirte angesichts der stetig wachsenden Zahlen von Rentnern gelernt hatten, ein Publikum anzuziehen, das auch nach der Sperrstunde noch etwas erleben wollte.
Es war schon nach Mitternacht, als Gaz am Castle Square eintraf. Er hatte zuerst die Pubs am Stadtrand abgeklappert, weil er davon ausgegangen war, dass Finnegan Freeman, wenn er sich schon die Kante geben wollte, das nicht ausgerechnet in dem Pub direkt neben dem West Mercia College tun würde, wo er studierte. Aber da hatte Gaz sich geirrt.
Er parkte seinen Streifenwagen vor dem Harp Lane Deli, das sich wie immer an dem städtischen Deko-Wettbewerb beteiligte. An Halloween hatte der Laden den ersten Preis gewonnen, und auch diesmal sah die Fensterdekoration preisverdächtig aus: Mitten im Fenster saß ein Weihnachtsmann, umringt von Kindern, die versuchten, auf seinen Schoß zu klettern, und hinter ihm stand ein rotwangiger Kobold mit einem Berg Geschenke bepackt.
Gaz stieg aus. Schnee lag auf den Fenstersimsen und bildete einen weißen Teppich auf dem Marktplatz. Durch die von Scheinwerfern angeleuchtete Schlossruine, die sich über dem Platz erhob, erinnerte die ganze Szenerie an eine gigantische Schneekugel. Es war hübsch anzusehen, aber Gaz war viel zu durchgefroren und hatte es viel zu eilig, Finnegan Freeman endlich zu finden.
Vom Marktplatz bog er in die Gasse zum Quality Square ein. Schon von Weitem konnte er die Musik, die Stimmen und das Gelächter hören, die von den Mauern auf dem Platz widerhallten. Er wunderte sich nicht, als er fünf aufgebrachte Anwohner sah, die dick in Parkas und Schals und Mützen eingemummelt vor der Haustür standen. Zwei von ihnen kamen auf ihn zu. Es werde auch verdammt noch mal Zeit, zeterten sie, dass endlich einer komme und für Ruhe sorge.
Er riet den Leuten, zurück in ihre Häuser zu gehen und ihm die Sache zu überlassen. Dem Lärm nach zu urteilen wurde nicht nur im, sondern auch vor dem Pub gefeiert, und es würde ein Stück Arbeit werden, all die Zecher zur Ordnung zu rufen.
Er bog um die Ecke. Unter den Heizstrahlern auf der Terrasse konnte er etwa zwei Dutzend betrunkene junge Leute ausmachen. Getränke aller Art in der Hand lehnten sie an der Hauswand, standen in Gruppen zusammen, lachten, knutschten. Der scharfe Geruch von Marihuana wurde stärker, als Gaz sich dem Pub näherte.
Er blies kräftig in seine Trillerpfeife, doch er hatte keine Chance gegen Waterloo, das aus der offenen Tür des Pubs dröhnte. Zuerst musste er sich um die Musik in dem Laden kümmern. Im Flur begrapschten fünf gut gekleidete junge Männer zwei sturzbetrunkene junge Frauen, wobei sie in einer Sprache, die Gaz die Schamesröte ins Gesicht trieb, darüber Wetten abschlossen, wie weit sie wohl kommen würden, ehe die Frauen merkten, was mit ihnen geschah.
Gaz presste die Lippen zusammen. Gott, war ihm das zuwider. Er packte einen der jungen Männer an der Schulter, der wütend herumfuhr und auf ihn losgehen wollte, die Faust aber wieder sinken ließ, als er Gaz’ Uniform sah.
»So ist’s recht«, sagte Gaz. »Mach, dass du hier rauskommst, und nimm deine Kumpels gleich mit.«
Er umfasste die beiden jungen Frauen fest und schob sich durch die Menge in den Pub. Es stank nach Erbrochenem. Gaz drückte die jungen Frauen auf Stühle an dem Tisch, von dem der Gestank auszugehen schien. Dadurch wurden sie entweder nüchtern, oder sie mussten sich ebenfalls übergeben. Beides war ihm recht.
Der Wirt Jack Korhonen war gerade dabei, eine junge Frau am Tresen anzubaggern. Sie sah aus, als wäre sie nicht älter als fünfzehn. Jack bemerkte Gaz erst, als der die junge Frau packte und anschrie: »Du bist minderjährig!«
»Ich bin achtzehn«, lallte sie.
»Wenn du achtzehn bist, bin ich zweiundsiebzig. Raus hier, sonst bring ich dich nach Hause.«
»Sie können mich nicht …«
»Ich kann, und ich werde. Du kannst dich entweder auf Zehenspitzen ins Haus schleichen, oder ich klingel deine Eltern aus dem Bett und übergebe dich eigenhändig, was ist dir lieber?«
Sie bedachte ihn mit einem bösen Blick, dann verdrückte sie sich. Er schaute ihr nach, bis sie im Flur verschwand. Ihm entging nicht, dass drei weitere Mädchen etwa im selben Alter ebenfalls das Weite suchten. Gaz drehte sich zu Jack um, der die Hände hob, wie um zu sagen, was kann ich dafür? »Schalt die Musik aus«, schrie Gaz über den Lärm hinweg. »Hier ist jetzt Feierabend.«
»Ich muss noch nicht zumachen«, protestierte Jack.
»Ruf die letzte Runde aus, Jack. Wer ist oben in den Zimmern?«
»Was für Zimmer?«
»Was für Zimmer, haha! Sag dem da«, er zeigte auf Jacks Neffen, »er soll an die Türen klopfen und Bescheid sagen, dass der Spaß vorbei ist. Wenn nicht, geh ich rauf, und das wird keinem gefallen. Und jetzt mach die Musik aus, oder soll ich das übernehmen?«
Jack lachte höhnisch, aber Gaz wusste, dass das bloß Show war. Als ABBA unvermittelt verstummten, gab es Protestgeschrei, und Jack brüllte: »Letzte Runde! Sorry!«
Die Leute schrien wütend durcheinander. Unbeirrt schlängelte sich Gaz zwischen den Tischen hindurch. Er musste immer noch Finnegan Freeman finden, und er entdeckte ihn im hinteren Bereich des Pubs an einem Tisch an der Wand. Er hatte den Kopf auf seine verschränkten Arme gelegt. Neben ihm hielt ein schick gekleideter junger Mann ein Handy auf Armeslänge, auf dem er einer jungen Frau mit olivfarbener Haut etwas zeigte, worüber sie beide lachen mussten.
Gaz stürmte auf den Tisch zu, stolperte jedoch über etwas, kurz bevor er ihn erreichte. Als er nach unten schaute, erblickte er eine junge Frau, die auf dem Boden saß und sich schläfrig an die Wand lehnte. Er kannte sie: Dena Donaldson, von ihren Freunden Ding genannt. Gaz hatte den Eindruck, als kriegte sie so langsam ein ernstes Alkoholproblem.
Er bückte sich, packte sie unter den Achseln und zog sie auf die Füße. Als sie ihn erkannte, schien sie das augenblicklich zu ernüchtern. »Es geht mir gut«, sagte sie. »Alles in Ordnung.«
»Ach ja?«, erwiderte Gaz. »Sieht aber gar nicht so aus. Ich sollte dich jetzt gleich nach Hause bringen, dann können Mummy und Daddy …«
»Nein«, entgegnete sie entschlossen.
»Ach nein? Du möchtest also nicht, dass Mummy und Daddy dich …«
»Er ist nicht mein Dad.«
»Also, Schätzchen, es ist mir egal, wer er ist, aber er will ganz sicherlich wissen, wie unsere kleine Dena ihre Abende verbringt. Meinst du nicht auch? Und wenn nicht …«
»Ich kann Missa nicht hierlassen. Ich hab ihrer Gran versprochen, dass ich bei ihr bleib. Lass mich los!«, rief sie und versuchte, sich aus Gaz’ Griff zu befreien. »Komm, Missa, wir gehen. Du hast doch die Karte mit der Nummer von dem Taxi, oder?«
Missa und der junge Mann rissen sich von dem los, was sie sich gerade auf dem Handy ansahen. Beide registrierten den Hilfspolizisten. »Hey«, sagte der junge Mann. »Sie tut Ihnen doch nichts. Lassen Sie sie los. Suchen Sie sich jemand anders, auf dem Sie rumhacken …«
»Fick dich, Gaz.« Das kam von Finnegan. Er hatte den Kopf gehoben und natürlich sofort begriffen, was Gaz hier wollte.
»Los, steh auf, Finn«, sagte Gaz zu dem jungen Mann. »Ich muss dich nach Hause und ins Bett bringen.«
Finnegan sprang auf, er wankte und stieß gegen die Wand. »Vergiss es!«
Alle anderen verfolgten das Geschehen mit Verwunderung, denn natürlich hatte Finn ihnen nicht gesagt, dass er den Hilfspolizisten mehr als flüchtig kannte. »Ich rede nicht von Worcester, sondern von Ludlow«, sagte Gaz. »Ich bringe dich nach Hause und ins Bett und mache dir, was du sonst noch brauchst. Eine Tasse heißen Kakao oder Ovomaltine, wie du willst.«
»Du kennst diesen Penner, Finn?«, sagte der andere junge Mann.
Gaz wurde wütend. Er konnte junge Leute nicht ausstehen, die ihre Zugehörigkeit zur Oberschicht raushängen ließen, und er fuhr herum.
Dena sagte »Brutus« in einem Ton, der eine versteckte Warnung enthielt. Der junge Mann zuckte die Achseln und wandte sich wieder seinem Smartphone zu.
Gaz riss es ihm aus der Hand. Es war in seiner Tasche verschwunden, ehe Brutus – was war das überhaupt für ein Name für so einen Knirps? – wusste, wie ihm geschah. An alle vier gerichtet sagte Gaz: »Ihr marschiert jetzt ab nach Hause, genau wie alle anderen hier.« Dann rief er: »Letzte Runde, ihr habt’s gehört! Und ich gebe euch fünf Minuten, um auszutrinken!« Mit Genugtuung sah er, wie einige den Pub bereits verließen und vier junge Leute hinter dem Neffen des Wirts die Treppe herunterkamen. Sie wirkten zerzaust, und eigentlich müsste er sie sich alle nacheinander vorknöpfen, aber er hatte schon mit den vier Kandidaten hier am Tisch alle Hände voll tun.
Zu Dena sagte er: »Du musst dich bald entscheiden, Fräulein.«
Zu Finn sagte er: »Ich bringe dich nach Hause.«
Und zu den anderen: »Und ihr beide macht gefälligst, dass ihr wegkommt, ehe ich mir überlege, was ich mit euch anstelle.«
»In Ordnung«, erwiderte Dena. »Ich hab’s mir überlegt. Sie können uns alle nach Hause bringen.« Und ehe Gaz antworten konnte, er sei kein Taxiunternehmen, verkündete sie: »Wir wohnen alle zusammen, falls Sie das nicht wussten. Ich bin froh, dass Sie uns fahren, und die anderen bestimmt auch. Kommt ihr?«, sagte sie lässig zu ihren Freunden, während sie ihre Jacke nahm. Nachdem sie auch ihre Handtasche auf dem Boden gefunden hatte, fügte sie hinzu: »Wir können zu Hause weiterfeiern, das war’s doch, was der Constable gemeint hat, oder, Constable?«
Gaz hörte den Triumph in ihrer Stimme, die Gewissheit, dass sie die Oberhand behalten hatte. Okay, dachte er. Das werden wir ja noch sehen.
4. Mai
SOHOLONDON
Als Erstes hatte sie sich die passende Kleidung zulegen müssen und dabei in erster Linie auf Schlichtheit geachtet. Sie besaß bereits Dutzende von T-Shirts mit Slogans – von denen nur einige wenige wirklich geschmacklos waren –, und so hatte sie sich nur Leggins gekauft, und zwar schwarze, da Schwarz angeblich schlank machte, und sie wollte weiß Gott schlanker aussehen, als sie in Wirklichkeit war. Als Nächstes hatte sie sich Schuhe besorgen müssen, wobei sie festgestellt hatte, dass viel mehr Schuhe angeboten wurden, als sie es sich jemals hätte träumen lassen. Natürlich gab es jede Menge schwarze Schuhe, aber auch beige, pinkfarbene, rote, silberne und weiße. Und welche mit Glitzer. Bei den Sohlen hatte man die Wahl zwischen Leder, Kunstharz, Gummi oder einem synthetischen Material unbekannter, aber hoffentlich umweltfreundlicher Herkunft. Und es gab die unterschiedlichsten Schnürsenkel. Oder Riemchen und Schnallen. Dann waren da noch die Taps, die metallenen Plättchen. Wollte man welche an den Spitzen oder an den Hacken oder beides oder keine? Warum man sich Stepptanzschuhe ohne Taps kaufen sollte, erschloss sich ihr allerdings nicht so recht. Am Ende entschied sie sich für rote Schuhe – rote Schuhe waren schließlich ihr Markenzeichen – mit Riemchen und Schnallen, denn sie traute sich nicht zu, Schnürsenkel so fest zu binden, dass sie nicht aufgingen: Immerhin dauerte das Training neunzig Minuten.
Als Barbara Havers sich hatte überreden lassen, zusammen mit Dorothea Harriman, der Sekretärin ihrer Abteilung bei der Metropolitan Police, an einem Stepptanzkurs teilzunehmen, hätte sie nie im Leben damit gerechnet, dass ihr das tatsächlich Spaß machen würde. Sie hatte sich nur darauf eingelassen, weil sie Dorothea Harrimans beharrlichen Überredungskünsten nichts mehr hatte entgegensetzen können. Eigentlich war Barbara jede Art von sportlicher Betätigung, die über das Schieben eines Einkaufswagens durch den nächstgelegenen Tesco-Supermarkt hinausging, ein Graus, aber am Ende waren ihr einfach die Argumente ausgegangen.
Zumindest hatte Dorothea inzwischen aufgehört, sich um Barbaras Liebesleben zu kümmern oder vielmehr um das Fehlen desselben. Barbara hatte nämlich beiläufig den Namen eines italienischen Polizisten erwähnt – Salvatore Lo Bianco –, den sie im Jahr zuvor kennengelernt hatte. Das weckte Dorotheas Interesse, und sie wurde erst recht neugierig, als Barbara ihr erzählte, dass Commissario Lo Bianco sie über Weihnachten mit seinen beiden Kindern besuchen würde. Leider war der Besuch dann ins Wasser gefallen, weil der zwölfjährige Marco wegen einer Blinddarmoperation ins Krankenhaus musste. Klugerweise hatte Barbara Dorothea gegenüber nicht erwähnt, wie enttäuscht sie darüber war, sondern die Sekretärin der Abteilung in dem Glauben gelassen, dass der Besuch stattgefunden hatte und die beiden fast schon ein Paar waren.
Das Thema Stepptanz hatte Dorothea jedoch nicht fallen gelassen, und so fuhr Barbara jetzt schon seit sieben Monaten jede Woche in ein Tanzstudio in Southall, wo sie und Dorothea lernten, dass ein Shuffle ein Brush war, gefolgt von einem Spark, dass ein Slap ein Flap war ohne Gewichtsverlagerung und dass Maxie Ford, eine Schrittkombination aus vier verschiedenen Bewegungen, nichts für Hasenfüße oder Tollpatsche war. Und wer nicht täglich außerhalb des Kurses übte, würde diesen Schritt niemals meistern.
Anfangs hatte Barbara sich schlicht und einfach geweigert zu üben. Als Detective Sergeant der Metropolitan Police verfügte sie nur über sehr knapp bemessene Freizeit, in der sie nicht endlos in der Gegend herumsteppen konnte. Zwar war der Tanzlehrer sehr geduldig mit seinen Anfängern und ermutigte sie, so gut er konnte, aber da Barbara keine besonderen Fortschritte machte, nahm er sie nach der zehnten Stunde beiseite.
»Daran muss man arbeiten«, sagte er zu ihr, als sie und Dorothea ihre Steppschuhe in den Stoffbeuteln verstauten. »Wenn man mal sieht, welche Fortschritte die anderen Damen inzwischen gemacht haben, und das, obwohl sie es viel schwerer haben …«
Ja, ja, alles klar, dachte Barbara. Der Lehrer meinte die jungen Musliminnen in der Gruppe, die stets lange, schwere Kleider trugen. Die meisten von ihnen bekamen den Cincinnati im Gegensatz zu ihr bereits fehlerfrei hin, weil sie nämlich taten, was der Lehrer ihnen auftrug, und das hieß üben, üben, üben.
»Ich übe mit ihr zusammen«, versprach Dorothea dem Tanzlehrer. Der Mann hieß Kazatimiru – »Ihr dürft mich Kaz nennen!« –, und für einen erst kürzlich eingewanderten Belorussen sprach er erstaunlich gut Englisch mit einem nur leichten Akzent. »Das kriegen wir schon hin.«
Barbara wusste, dass Kaz in Dorothea verknallt war. Die meisten Männer erlagen ihrem Charme. Und als sie Kaz kokett um etwas mehr Geduld mit Barbara bat, schmolz er natürlich wie Wachs in ihren manikürten Händen dahin. Barbara hatte sich schon gefreut und geglaubt, sie könne von nun an nach Lust und Laune auf dem Tanzboden herumspringen und so tun, als wüsste sie, was sie tat, Hauptsache, sie machte genug Krach mit ihren Steppschuhen, aber da hatte sie ihre Rechnung ohne Dorothea gemacht.
Dorothea kündigte an, dass sie von nun an jeden Tag nach der Arbeit zusammen üben würden. »Es werden keine Ausreden akzeptiert, Detective Sergeant.« Es standen eine Menge Frauen auf der Warteliste für Kaz’ Unterricht, und wenn Barbara Havers ihr Übungspensum nicht ernst nahm, würde sie aus dem Kurs fliegen.
Erst als Barbara beim Leben ihrer Mutter schwor, eigenständig zu üben, hatte Dorothea lockergelassen. Ihr Vorschlag war gewesen, nach der Arbeit im Treppenhaus der Met zu üben, dort, wo die Getränkeautomaten standen, aber damit würde sie ihren Ruf bei der Met endgültig ruinieren. Sie versprach hoch und heilig, jeden Abend zu Hause zu üben, und das tat sie. Mindestens einen Monat lang.
Kaz quittierte ihre Fortschritte mit einem anerkennenden Nicken, und Dorothea lächelte. Die beiden waren die Einzigen in ihrem Bekanntenkreis, die von Barbaras neuem Hobby wussten; vor allen anderen hielt sie es geheim.
Nach einer Weile stellte Barbara fest, dass sie ganz nebenbei gut sechs Kilo abgenommen hatte. Sie musste sich ein paar Röcke in einer kleineren Größe zulegen, und die Schleifen am Gummizug ihrer Pumphosen wurden von Woche zu Woche größer. Bald musste sie sich die Hosen in einer noch kleineren Größe kaufen. Womöglich war sie irgendwann tatsächlich rank und schlank, dachte sie. Es waren schon seltsamere Dinge geschehen.
Andererseits gönnte sie sich, gerade weil sie sechs Kilo abgenommen hatte, zwei Mal die Woche ein ordentliches Curry. Und dazu aß sie jede Menge Naanbrot. Und zwar nicht einfach nur Naanbrot, sondern Naanbrot mit Knoblauchbutter oder mit Butter und Gewürzen und Honig und Mandeln, jede Art von Naanbrot, die sie finden konnte.
Sie war auf dem besten Weg, wieder ordentlich zuzulegen, als Kaz das mit der Tap-Jam-Veranstaltung zur Sprache brachte. Barbara war jetzt seit sieben Monaten im Steppkurs, und sie träumte nach dem Training gerade von Naanbrot und Tagliatelle mit Lachs (beim Essen hatte sie kein Problem damit, verschiedene Ethnien in einen Topf zu werfen), als Dorothea zu ihr kam und sagte: »Da müssen wir hin, Detective Sergeant Havers. Donnerstagsabends haben Sie doch frei, oder?«
Barbara schreckte aus ihrem Tagtraum von wild gewordenen Kohlehydraten auf. Donnerstagabend? Frei? Sie hatte doch jeden Abend frei, oder? Sie nickte dämlich. Als Dorothea jauchzte: »Super!« und dann Kaz zurief: »Du kannst mit uns rechnen!«, hätte sie wissen müssen, dass etwas im Busch war. Erst auf dem Weg zur U-Bahn erfuhr sie, worauf sie sich eingelassen hatte.
»Das wird ein Riesenspaß«, schwärmte Dorothea. »Kaz wird auch da sein. Er bleibt die ganze Zeit bei uns auf der Bühne.«
Als Barbara das Wort »Bühne« hörte, wusste sie, dass sie sich für den kommenden Donnerstag irgendein Fußleiden ausdenken musste. Anscheinend hatte sie gerade zugesagt, an irgendeiner Art Stepptanzauftritt mitzuwirken, und das war so ziemlich das Allerletzte, was sie wollte.
Und so fing sie an, über Plattfüße und Ballenzehen zu klagen, aber Dorothea Harriman ließ sich nichts vormachen. »Versuchen Sie ja nicht, sich davor zu drücken, Detective Sergeant Havers«, sagte sie und verlangte auch noch von Barbara, dass sie an dem besagten Donnerstag ihre Stepptanzschuhe mit zur Arbeit brachte, und sollte sie die Schuhe vergessen, erkläre Detective Sergeant Winston Nkata sich bestimmt bereit, sie aus Barbaras Wohnung zu holen, fügte sie hinzu. Oder Detective Inspector Lynley. Der fahre doch so gern in seinem schicken Auto in der Gegend herum, oder? Ein Abstecher nach Chalk Farm komme ihm gerade gelegen.
»Ist ja gut, ist ja gut«, hatte Barbara schließlich gesagt. »Aber wenn Sie glauben, dass ich auf der Bühne tanze, dann sind Sie schiefgewickelt.«
Und so kam es, dass sie an einem Donnerstagabend in Soho war.
In den Straßen wimmelte es von Leuten, nicht nur, weil Ferien waren, sondern auch wegen des herrlichen Wetters und weil Soho mit seinen Klubs, Restaurants, Kneipen und Theatern alle möglichen Leute anzog. Sie mussten sich also durch die Menge kämpfen bis zur Old Compton Street, wo sich der Klub namens Ella D’s befand.
Eine Etage über dem Nachtklub fand zwei Mal im Monat ein Tap Jam statt, und der beinhaltete einen Jam Mash, einen Renegade Jam und ein Solo Tap. Als sie erfuhr, was einem da jeweils abverlangt wurde, schwor Barbara sich, auf gar keinen Fall bei dem Zeug mitzumachen.
Der Jam Mash hatte schon angefangen, als sie eintrafen. Sie warteten eine Viertelstunde lang vor der Tür in der Hoffnung, dass Kaz aufkreuzen würde und ihnen das Ella D’s schmackhaft machte. Doch dann erklärte Dorothea ungehalten: »Okay, er hat seine Chance gehabt!«, und ging in den Klub, wo aus der oberen Etage ein Lärm zu hören war, als würde eine Herde Ponys durchs Haus stürmen.
Der Lärm nahm zu, als sie die Treppe hochstiegen. Zu Big Bad Voodoo Daddy hörten sie eine Frau in ein Mikrophon schreien: »Einen Scuffle und gleich noch einen, jetzt probiert einen Flap. Gut! Macht ihr prima.«
Sie entdeckten Kaz am Ende eines großen Raums auf der Bühne. Er hatte sie also doch nicht im Stich gelassen. Etwa zwei Dutzend Stühle standen entlang der Wände, und es waren weniger Leute da, als Barbara gehofft hatte. Sie würde nicht einfach unbemerkt zwischen ihnen untertauchen können.
Kaz stand zusammen mit einer kräftig gebauten Frau im Fünfziger-Jahre-Outfit auf der Bühne. Sie trug keine High Heels, sondern glänzende Stepptanzschuhe, die sie gekonnt zum Einsatz brachte. Sie verkündete mit lauter Stimme die Schritte und machte sie zusammen mit Kaz vor. Vor der Bühne versuchten drei Reihen von Stepptänzern, die Bewegungen der beiden nachzumachen.
»Wahnsinn!«, rief Dorothea begeistert aus.
Aus unerfindlichen Gründen hatte sie sich für das Ereignis in Schale geworfen. Normalerweise trug sie beim Stepptanztraining einen Trikotanzug über einer Strumpfhose, aber heute hatte sie sich für einen Tellerrock entschieden, eine Bluse, die sie unter den Brüsten verknotet hatte, und ein gepunktetes Tuch in den Haaren im Stil von Betty Boop. Barbara begriff, dass es ein Versuch war, hier möglichst nicht aufzufallen, und wünschte, sie wäre auf die gleiche Idee gekommen.
Kaz entdeckte Dorothea und Barbara sofort. Er sprang von der Bühne und kam auf sie zugesteppt. Mit dem sechsten Sinn des erfahrenen Tänzers drehte er direkt vor ihnen eine Pirouette. Noch ein Schritt, und er hätte sie über den Haufen gerannt.
»Was für ein Anblick!«, rief er aus. Natürlich meinte er Dorothea. Barbara hatte sich wie immer für Schlichtheit entschieden: Sportschuhe, Leggins und ein T-Shirt mit dem Aufdruck Ich mache mich nicht über dich lustig. Ich hab nur vergessen, meine Pillen einzuwerfen.
Dorothea lächelte und machte einen Knicks. »Das sah toll aus!«, sagte sie. »Wer ist die da?«
»Die da«, antwortete Kaz voller Stolz, »ist KJ Fowler, die Stepperin Nummer eins in Großbritannien.«
KJ Fowler gab immer weiter die Schritte vor. Kaum hörte ein Stück auf, begann ein neues. Johnny Got a Boom Boom schallte aus den Lautsprechern. »Zieht euch die Schuhe an, Mädels. Jetzt kommt der Buck-Schritt.«
Kaz steppte zurück zur Bühne, wo KJ Fowler ein paar Schrittkombinationen vorführte und die Leute sich bemühten, ihr zu folgen, wobei sie aussahen, als wollten sie einen Bus erwischen, der ihnen vor der Nase wegzufahren drohte. Dorothea strahlte. »Schuhe!«, sagte sie zu Barbara.
Sie gingen an die Seite und zogen sich die Schuhe an. Während Barbara immer noch verzweifelt nach einer überzeugenden Erklärung für plötzliche Lähmungserscheinungen suchte, schleppte Dorothea sie auch schon auf die Tanzfläche. KJ Fowler führte auf der Bühne gerade einen Cramp Roll vor, und Kaz machte – nach ihren Anweisungen – eine schwindelerregende Schrittkombination, die nur ein Narr zu kopieren versucht hätte. Aber es gab einige, die es probierten, unter ihnen Dorothea. Barbara ging an die Seite und sah zu. Sie musste zugeben: Dorothea war richtig gut. So gut, dass sie bald ein Solo aufführen konnte. Und da sie außer Barbara und den Musliminnen keine Konkurrentinnen hatte, würde das nicht mehr lange dauern.
Beim Jam Mash schafften sie fast zwanzig Minuten. Barbara war nassgeschwitzt und überlegte gerade, wie sie sich unbemerkt verdrücken konnte, als die Musik plötzlich abbrach – wofür sie dem Himmel dankte – und KJ Fowler sie darüber informierte, dass die Zeit um war. Zuerst glaubte Barbara, sie seien erlöst und könnten jetzt verschwinden, doch dann verkündete KJ Fowler eine Überraschung: Die Gruppe Tap Jazz Fury würde jetzt im Anschluss spielen.
Beifall und Hochrufe ertönten, während eine kleine Jazz-Combo aus dem Nichts auf der Bühne erschien. Die Musiker begannen zu spielen, und die Tänzer legten sich ins Zeug. Einige, das musste Barbara zugeben, waren so behände, dass sie schon fast überlegte, mit dem Steppen weiterzumachen; vielleicht würde sie es ja wenigstens ein bisschen so hinkriegen wie die anderen.