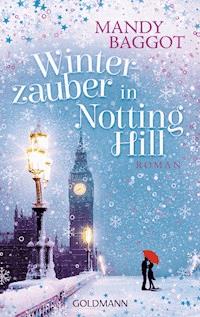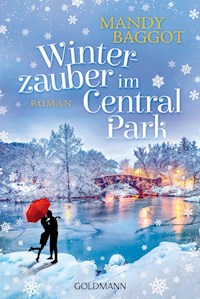9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ihr steht das schlimmste Weihnachten aller Zeiten bevor, davon ist die junge Lehrerin Emily Parker überzeugt. Von der Liebe enttäuscht, hängt nun auch ihr geliebter Job am seidenen Faden. Denn ihre Chefin brummt ihr das Weihnachtsmusical der Schule auf – und das, obwohl Emily völlig unmusikalisch ist. Doch dann gabeln ihre Schüler den skandalumwitterten Popstar Ray Stone nach einer durchzechten Nacht verkatert im Schulschuppen auf. Könnte er Emilys Rettung sein? Vielleicht wird dieses Weihnachtsfest ja doch das schönste, das Emily je hatte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 665
Ähnliche
Buch
Ihr steht das schlimmste Weihnachten aller Zeiten bevor, davon ist die junge Lehrerin Emily Parker überzeugt. Von der Liebe enttäuscht, hängt nun auch ihr geliebter Job am seidenen Faden. Denn ihre Chefin brummt ihr das Weihnachtsmusical der Schule auf – und das, obwohl Emily völlig unmusikalisch ist. Doch dann gabeln ihre Schüler den skandalumwitterten Popstar Ray Stone nach einer durchzechten Nacht verkatert im Schulschuppen auf. Könnte er Emilys Rettung sein? Vielleicht wird dieses Weihnachtsfest ja doch das schönste, das Emily je hatte …
Weitere Informationen zu Mandy Baggot sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Mandy Baggot
Winterzauber in Mayfair
Roman
Aus dem Englischenvon Ulrike Laszlo
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »One Christmas Star« bei Aria, an imprint of Head of Zeus Ltd, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2020
Copyright © der Originalausgabe by Mandy Baggot
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by Arrangement with HELLAS PRODUCTIONS.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München; taseffski / Getty Images
Redaktion: Lisa Caroline Wolf
AKS · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-26576-2V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Justin Edinburgh,
einen meiner ersten romantischen Helden.
Schlaf in Ruhe und leuchte hell.
KAPITEL EINS
Grundschule Stretton Park, LondonEnde November
Konzentration. Kon-zen-tra-tion. Du bist jetzt die Bastel-Superwomn …
Emily Parkers Zunge klebte an der Oberlippe, während sie in höchster Konzentration die Augen zusammenkniff und mit einer Pinzette die winzige Krone aus Knetmasse in die Höhe hielt. Sie verzog den Mund und pustete etwas Luft nach oben, um die Wimpern von dem etwas zu langen kastanienbraunen Pony zu befreien.
Es war kurz vor acht am Morgen, und in ihrem Klassenzimmer herrschte zu dieser Zeit noch eine Stille wie in einer Kapelle voller Benediktinermönche. Emilys Hand zitterte, als müsste sie jemanden am offenen Herzen operieren, statt ein Modell mit dem Titel »Was Weihnachten für mich bedeutet« zu vollenden. Gestern hatte ihre sechste Klasse Sterne gebastelt – aus Alufolie und mit jeder Menge Glitzer – und sie an Kleiderbügeln aus Draht befestigt, die nun von der Decke baumelten. Wenn sie sich um die eigene Achse drehten, malten sie schimmernde Lichtpunkte an die Wände. Emily hatte noch immer ein wenig Sorge, einer (oder gleich alle) könnte auf das kostbare Kunstwerk fallen, das sie gerade fertigstellte.
»Nicht zerdrücken, Miss Parker, jetzt sieht es endlich wieder schön aus.«
»Ich weiß.« Emily holte tief Luft. »Das hast du wirklich sehr gut gemacht, Jayden.« Die aufmunternden Worte waren an einen ihrer Schüler gerichtet, der in einem Gebäude mit dem unpassenden Namen Riches Tower wohnte. Der »Turm des Reichtums« war ein schauderhaftes Hochhaus aus den Siebzigern, in dem einige der ärmeren Einwohner dieses Stadtviertels von London lebten. Bei dem Modell vor ihr handelte es sich bereits um Jaydens zweiten Versuch. Und bevor der Unterricht begann, wollte sie ihm unbedingt noch helfen, es fertig zu bekommen. Das erste Modell war Jaydens gewalttätigem Vater zum Opfer gefallen. Er hatte es in der Küche an die Wand geworfen. Emily war einmal bei den Jacksons zu Hause gewesen, und zwar, weil sie sich Sorgen gemacht hatte, als Jayden wegen einer angeblichen Grippe über eine Woche lang nicht zum Unterricht gekommen war. Allerdings war sie bereits in der altmodisch ausgestatteten Küche, dem ersten Raum gleich hinter der Wohnungstür, von Mr Jackson, der sich an Mrs Jackson vorbeigedrängt hatte, abgepasst und vor die Tür gesetzt worden.
Mit zitternden Fingern holte Emily Luft. Positiv denken. Irgendwann musste bei diesem Jungen doch einmal etwas klappen. Es war fast Dezember, nicht mehr lange hin bis zum Weihnachtsfest. Kurz blickte sie zur Decke mit den tanzenden Mobiles hinauf und pustete den angehaltenen Atem aus. Sie war fest entschlossen, diese Krone ohne Zwischenfall an ihren Platz zu befördern. Deshalb ließ sie ihr Werkzeug in Richtung Zielpunkt sinken, drückte die Krone fest … und gab sie schließlich frei.
»Wow!«, rief Jayden aus und rutschte mit seinem Stuhl näher an sein Kunstwerk heran. »Glauben Sie, ich gewinne den Wettbewerb, Miss Parker?«
Emily schluckte. Er konnte nicht gewinnen, und das sollte er auch nicht. Immerhin hatte sie ihm in der letzten Woche viel geholfen. Auch wenn Jayden von den dreiunddreißig Schülern in ihrer Klasse den Preis, eine Schachtel mit Konfekt, vermutlich am meisten zu schätzen wusste …
»Ich denke«, erwiderte Emily und betrachtete den Zehnjährigen, dem das fettige dunkle Haar an der Stirn klebte und dessen Augen voller Hoffnung unter den Ponyfransen hervorspähten, »dass du eine ausgezeichnete Chance hast, Erster zu werden.«
Jayden lächelte und steckte den Rest des Bagels mit Frischkäse und Speck, den sie ihm mitgebracht hatte, in den Mund. »Schauen Sie meinen Dad an.« Lachend deutete er auf die Szene. »Sogar wenn er aus Knete ist, sieht er sternhagelvoll aus.«
Was antwortete man auf so etwas? Obwohl Emily die Worte fehlten, musste sie sich etwas einfallen lassen. Etwas Positives. »Vielleicht ist dein Dad ja stolz darauf, dass er in deiner Szene die Hauptrolle spielt.«
»Er wird es nicht sehen«, verkündete Jayden mit vollem Mund. »Er kann nicht zur Ausstellung kommen, weil er arbeiten muss.«
»Er hat einen Job!«, begeisterte sich Emily. »Jayden, das ist ja wundervoll.« Mr Jackson hatte zur Arbeit ein eher schwieriges Verhältnis.
»Er hält bestimmt nicht lange durch«, meinte Jayden in sachlichem Ton. »Meine Mum sagt, sie gibt ihm vierzehn Tage.« Er grinste. »Erst habe ich sie nicht ganz verstanden, doch als sie es mir erklärt hat, fand ich, dass sie richtigliegt.«
»Nun«, begann Emily, zog ein Papiertaschentuch hervor und tupfte Jayden den Frischkäse aus den Mundwinkeln. »Du weißt, dass wir in diesem Klassenzimmer einander zuhören, niemanden verurteilen und jedem eine zweite Chance geben, richtig?«
Mit einem missmutigen Brummen befreite Jayden sich von Emilys Säuberungsversuchen. »Rashid kriegt inzwischen von mir seine dritte Chance.«
»War er schon wieder gemein zu dir?«, erkundigte sich Emily. Rashid Dar entstammte einer offenkundig wohlhabenden Familie, die eine Kette indischer Schnellrestaurants besaß. Seit Rashid im September in ihre sechste Klasse gekommen war, fragte sich Emily, wieso er nicht anstelle von Stretton Park die nahe gelegene Privatschule besuchte. Vielleicht war das Auftischen von Phall-Curry ja doch nicht so lukrativ, wie sie glaubte. Oder seine Eltern hatten einfach keine Lust, Geld für Schulgebühren auszugeben. Allerdings hatte sie, wie die Klassenregeln besagten, nicht das Recht, ein Urteil über ihre Mitmenschen zu fällen. Ihre Pflicht war es, dafür zu sorgen, dass alle ihre Schüler sich ins Zeug legten und das Beste aus sich herausholten. Sie war ihre Lehrerin in diesem letzten wichtigen Schuljahr, bevor sie an weiterführende Schulen wechseln würden. Emily war schon immer der Ansicht gewesen, dass sich die Schüler in dieser Zeit am meisten veränderten. Man konnte buchstäblich mit ansehen, wie aus Kindern kleine Jugendliche wurden, die herausfanden, wer sie wirklich waren und was sie werden wollten.
»Rashid hat gesagt, in meinen Haaren wäre so viel Fett, dass sein Dad Samosas darin frittieren könnte«, verkündete Jayden.
Emily spürte, wie Zorn in ihr hochstieg. Trotz all ihrer Bemühungen war Rashid weiterhin vorlaut und arrogant. Für einen Zehnjährigen ein wenig besorgniserregend. »Hat er das?«
Bevor sich die Zahnräder in ihrem Gehirn in Bewegung setzen konnten und ihr die zündende Idee lieferten, wie sie gegen Rashids Sticheleien vorgehen sollte, flog die Tür des Klassenzimmers auf, und die Rektorin stand vor ihr. Susan Clark war mit schweren Aktenordnern bepackt. Die Brille rutschte ihr von der Nase, ihre Lippen leuchteten neonpink, und ihr zu enger Rock spannte sich bei jedem Schritt.
»Guten Morgen, Miss Parker. Was ist denn hier los?« Entschlossen wie ein General kurz vor der Schlacht marschierte Susan auf den Tisch zu, an dem Emily und Jayden gerade arbeiteten. Plötzlich löste sich eines der Sternenmobiles, sodass es nur noch an einem kleinen Stück Klebestreifen baumelte.
»Wir haben …«, stammelte Emily. Im nächsten Moment hielt sie inne und hätte sich ohrfeigen können. Was hatte diese Frau nur an sich, dass sie sich ihr stets unterlegen fühlte? Denn das war eindeutig nicht der Fall. Inzwischen wäre sie durchaus in der Lage, selbst eine Schule zu leiten. Also begann sie noch einmal und versuchte, dabei selbstbewusster zu klingen. »Jayden ist früher gekommen, um sein ›Was Weihnachten für mich bedeutet‹-Projekt abzugeben.«
Emily stellte fest, dass Susans Bluse sich gefährlich spannte, als die Rektorin die Akten in ihrem Arm auf einen Tisch warf, tief einatmete und die Luft rings um Jaydens Modell schnupperte.
»Hast du das etwa aus Speck gebastelt?«, fragte Susan. Als sie sich die Brille hochschob, fing sich das Licht in den Bernsteinperlen der Kette, an der sie hing.
»Nein, Mrs Clark«, erwiderte Jayden wie aus der Pistole geschossen. »Das kommt von dem Bagel, den Miss Parker mir gegeben hat.« Er grinste. »Superlecker.«
Emily biss sich auf die Unterlippe. Wenn sie nicht aufpasste, würde sie sich auf diese Weise noch Herpesbläschen einhandeln. Und jetzt drohte ihr Ärger. Susan hatte ihr bereits zweimal verboten, Schülern aus armen Familien Lebensmittel zu schenken. Auf diese Weise würden Extrawürste gebraten, und außerdem sei das ein schlechtes Beispiel. Die Kinder erhielten in der Schule schon ein kostenloses Mittagessen. Und es gab ja schließlich auch noch die Tafeln …
»Ich verstehe.« Susan ging auf Abstand zu dem Modell und blickte Emily an. Wenn sie den Ausdruck »ich verstehe« benutzte, hieß das, dass sie überhaupt nichts verstand.
»Jayden«, übernahm Emily das Kommando. »Warum gehst du nicht auf den Schulhof. Es ist acht Uhr, und du kannst ein bisschen Fußball spielen, bis es läutet.« Vielleicht sammelte sie ja wieder Pluspunkte, wenn sie den Jungen zu körperlicher Bewegung ermunterte.
»In Ordnung«, meinte Jayden, den man nicht lange überreden musste, Sport zu machen. Er stand vom Stuhl auf, griff nach seinem Rucksack mit dem gerissenen Riemen, der von Isolierband zusammengehalten wurde, und machte sich davon.
Emily beschloss, die Unstimmigkeiten mit Susan so schnell wie möglich zu klären.
»Bevor …«
»Sie haben dieses Modell gebastelt, nicht wahr, Emily?«, unterbrach Susan. Ihre laute Stimme übertönte die Tatsache, dass Emily überhaupt angefangen hatte zu reden. Wieder löste sich ein Tesafilm eines Sternenmobiles und hing nun dicht über Susan Clarks Kopf. Emily wusste, dass sie sich für den Rest des Schuljahres von dem Gedanken an eine Beförderung würde verabschieden müssen, wenn der Stern die Rektorin traf. Sie schluckte, und ihre Gedanken schweiften ab zu Simon. Er hatte sie immer wieder darin bestärkt, Rektorin zu werden.
»Nein«, antwortete sie wie aus der Pistole geschossen. Und das, obwohl sie ziemlich sicher war, dass zukünftige Rektorinnen nicht lügen durften.
Susan bedachte sie mit einem Blick durch ihre Brille, der besagte, dass sie das ebenso wenig glaubte wie die Behauptung, der Austritt Großbritanniens aus der EU sei ein Kinderspiel.
»Wirklich nicht«, beteuerte Emily. »Das heißt … ich habe ihm vielleicht Vorschläge gemacht … wie man das allgemeine Erscheinungsbild verbessern könnte, aber …« Warum gab sie sich überhaupt Mühe. Susan wusste es sowieso. Susan wusste immer alles. Ob es an schwarzer Magie oder einfach nur an ihrer jahrelangen Erfahrung lag, ihr entging praktisch nichts.
»Okay«, sprach Emily weiter. »Sein grässlicher, aggressiver und unsympathischer Vater hat das Originalmodell in der Küche an die Wand geworfen. Und dann ist er drauf herumgetrampelt.« Sie wusste, dass sie gerade rot anlief. Als Jayden ihr den Vorfall mit Tränen in den Augen geschildert hatte, hätte sie Mr Jackson am liebsten selbst gegen eine Wand geschleudert. Nicht dass sie Gewalt guthieß. Oder zu sehr an ihren Schülern hing. Denn so etwas wurde nicht gerne gesehen und fiel in dieselbe Kategorie wie Kürzungen der Mittel und Political Correctness … und offenbar auch der Kauf von Bagels.
»Ich verstehe«, wiederholte Susan.
Sie verstand noch immer kein Wort. Und das wollte sie auch gar nicht. Schon gut, Emily würde die Rüge verkraften, solange sie nur ihre Stelle behielt. Da ihr Mitbewohner und bester Freund Jonah ausgezogen war, die Heizung Geräusche von sich gab, die an eine teure Kaffeemaschine erinnerten, und Weihnachten vor der Tür stand, brauchte sie unbedingt weiterhin ein regelmäßiges Einkommen. Der kleine Betrag, der ihr unerwartet in den Schoß gefallen war, würde nicht ewig reichen. Das schreckliche Ereignis, das dem vorangegangen war, würde sie dagegen für immer begleiten.
»Ich war auch einmal wie Sie, Emily«, stellte Susan fest. Als sie ihre ausladenden Hüften auf dem Tisch parkte, hätte sie beinahe Jaydens Modell gestreift. »Fast zwanzig Jahre lang. Es gab keine Nase, die ich nicht geputzt, und kein Knie, das ich nicht verpflastert hätte. Aber so leid es mir tut, Emily, und das ist wirklich so, diese Zeiten sind vorbei.« Susan beugte sich vor, entschlossen, ihr flächiges Gesicht in Emilys Sichtfeld zu manövrieren. »Das begreifen Sie doch, oder? Denn schließlich führen wir dieses Gespräch nicht zum ersten Mal.«
Ganz, ganz sacht holte sie zum tödlichen Schlag aus. Es war wirklich nicht das erste Mal, dass Emily gegen die Regeln verstieß und die Anweisungen aus dem Tower überhörte.
Susan wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Modell auf dem Tisch zu und rückte ihre Brille zurecht, als wollte sie vergrößern, was sie da betrachtete. »Was genau soll das eigentlich sein? Wie eine Krippe sieht es für mich nicht aus.«
»Es ist auch keine«, entgegnete Emily. »Ich habe dieses Jahr kein ausdrücklich christliches Thema gewählt.« Auf ein christliches Thema hätte sie schon im letzten Jahr und im Jahr davor gern verzichtet, doch da die Schule unter der Aufsicht der Church of England stand und Susan allen eingebläut hatte, dass die Vertreter der Diözese bei ihrem Besuch ausschließlich biblische Motive erwarteten, war ihr nichts anderes übrig geblieben. »Wie ich schon sagte, lautet das Motto ›Was Weihnachten für mich bedeutet‹. Oder besser: ›Was die Feiertage für mich bedeuten.‹ Und zwar für diejenigen Schüler, die Weihnachten nicht feiern.« Sie schluckte. »Frema deckt beides ab, weil sie mit zwei Religionen aufwächst.«
»Hat der Mann da etwa ein … Bierglas in der Hand?«, rief Susan entsetzt. Offenbar hatte sie Jaydens Werk inzwischen eingehender gemustert.
»Ja«, räumte Emily ein. »Ja, das hat er.« Seufzend begutachtete sie das Ergebnis von Jaydens Bemühungen. Die winzige Krone, die sie so vorsichtig an ihren Platz gesetzt hatte, war nicht etwa für den Kopf eines schlafenden Christkindes oder für einen der Heiligen Drei Könige bestimmt, sondern für das Dach von Mr Jacksons Lieblingspub, das Rose & Crown.
Susan sprang auf und fuhr zurück. Dann sammelte sie ihre Akten ein. »Vergessen Sie nicht die Budgetbesprechung heute Abend nach dem Unterricht«, meinte sie und näherte sich rückwärts der Tür. »Und, Emily, dieses Pub« – bei ihr klang »Pub«, als spräche sie in Gegenwart des Bischofs das Wort »Judas« aus – »darf auf keinen Fall den Wettbewerb gewinnen.«
Emily schwieg. Sie kannte ihren Platz. Neunundzwanzig Jahre alt und noch nicht einmal Konrektorin. Susan rauschte hinaus und knallte schwungvoll die Tür hinter sich zu. Die Erschütterung sorgte dafür, dass zwei der Sterne, einen Lamettaschweif hinter sich herziehend wie explodierende Kometen, auf die Dielenbretter segelten.
KAPITEL ZWEI
Well-Roasted Coffee House, Islington
Es lief Musik von Nat King Cole und Dean Martin, ab und zu auch Mud oder Band Aid. Viel zu fröhlich, ohne einen einzigen Mollakkord. Ray Stone verabscheute diesen ganzen Festtagskitsch. »Nichts Weihnachtliches« hieß es in einer der Klauseln, die auf sein Verlangen hin in seinen letzten Vertrag mit Saturn Records eingefügt worden waren. Auf gar keinen Fall eine Weihnachts-LP. Nicht einmal dann, wenn der echte Saturn im Weltall einfror.
Es war noch nicht einmal Dezember, und dennoch schien sich London bereits in ein Weihnachtswunderland verwandelt zu haben. Drittklassige Promis schalteten öffentlich Weihnachtsbeleuchtung ein, die Läden machten Werbung für Adventsangebote, und in den Restaurants wurde alles mit einem Hauch Zimt oder Muskatnuss versehen. Wie zum Beispiel der Kaffee, den Ray gerade trank. Er hatte nicht um den Sirup gebeten, den man üppig in das dunkle Getränk gerührt hatte, doch jetzt war er nun einmal drin, und … er sehnte sich von Herzen etwas anderes herbei. Und zwar hergestellt von der Firma Jack Daniel’s, Tennessee.
»Hörst du mir überhaupt zu, Ray?«
Er sah auf. Als sich seine Augen an das Funkeln von Lametta, Christbaumkugeln und blinkenden LEDs gewöhnt hatten, fiel sein Blick auf einen Weihnachtsbaum, der in einer Ecke hinter seiner Agentin aufragte. Er hätte eine Sonnenbrille aufsetzen sollen. Ja, es war November, und vielleicht hätte er damit noch mehr Aufmerksamkeit erregt. Aber der Morgen war knackig kalt, der Himmel blau, und eine grelle, tief stehende Sonne schien herein, während das gesamte Café erleuchtet war wie Las Vegas.
Als Ray einen Schluck Kaffee trank, lag ihm der süße Geschmack unangenehm auf der Zunge. »Du siehst müde aus, Deborah.« Mit seinem Brummschädel durfte er sich eigentlich kein Urteil erlauben.
Seine Bemerkung hatte zur Folge, dass Deborah anfing, an ihrem wie immer makellosen schwarzen Pagenschnitt herumzuzupfen. Sie richtete sich ein Stück auf und zog die Ärmel ihres grauen Sakkos glatt, bevor sie antwortete.
»Meiner Meinung nach solltest du dir nicht den Kopf darüber zerbrechen, wie ich mich fühlen oder wie ich aussehen könnte, Ray. Wenn du diesen letzten Artikel überleben willst, haben wir noch tonnenweise Arbeit vor uns.«
»Schläfst du nicht gut?«, bohrte Ray weiter nach, nur um diesem Thema aus dem Weg zu gehen. »Hält dein Hund dich immer noch wach?«
»Tucker geht jetzt zu einem Hundetherapeuten«, teilte Deborah ihm mit.
»Dann also Oscar? Redet er wieder im Schlaf?« Ray wusste, dass Deborah sich häufig über ihren Mann beklagte.
»Oscar redet nicht im Schlaf, er schnarcht … nun, ein bisschen … aber ich habe ihm zum Hochzeitstag Nasenspreizer geschenkt.«
Ray konnte ein Auflachen nicht unterdrücken, obwohl sich das schmerzhafte Pochen in seinem Schädel dadurch steigerte. »Entschuldige«, meinte er und berührte seine Beanie-Mütze aus grauer Wolle. An der Stirn und rings um die Ohren lugte dunkelbraunes Haar hervor, das inzwischen ein wenig struppig war und einen Friseurbesuch bitter nötig hatte. »Sicher trägt es zur Romantik bei, wenn man ausgeschlafen ist.« Er überlegte einen Moment. »Was hat Oscar dir denn zum Hochzeitstag geschenkt?«
Deborah begann, an der Serviette herumzuspielen, auf der ihre Tasse mit Masala Chai stand. »Eine Anleitung zum Basteln von Glückwunschkarten auf DVD.«
Er wusste, dass er nicht wieder hätte lachen sollen. Doch die Vorstellung, wie sich seine toughe Agentin eine Bastelsendung ansah und sich anschließend mit Schleifen, Pailletten und Klebepistole an einen Tisch setzte, war einfach zu komisch. Aber sosehr er sich auch bemühte, sich ein Grinsen zu verkneifen, wusste er, dass sein Gesichtsausdruck ihn verriet.
»Das war mein Wunsch«, stellte Deborah klar. »Sehr romantisch.«
Der Lacher war nicht mehr aufzuhalten. Ray griff nach seinem Kaffee, um etwas im Mund zu haben, ganz gleich, wie stark es auch nach Zimt schmeckte.
»Wie dem auch sei, Ray, wir haben uns nicht getroffen, um über mein Privatleben zu sprechen. Deines hingegen ist bekanntermaßen so öffentlich, dass sämtliche Klatschblätter auf der Titelseite darüber berichten.«
Von irgendwoher förderte Deborah eine Zeitung zutage und knallte sie vor ihn auf den Tisch. Ray war so verkatert, dass selbst dieses Geräusch die Wirkung hatte, als trampelte eine plattfüßige Revuetänzerin in seinem Kopf herum. Außerdem brauchte er die Schlagzeile nicht noch einmal zu lesen. Er hatte bereits alles in den sozialen Medien gesehen und in Good Morning Britain aus dem Mund von Piers Morgan gehört.
Also trank er einen weiteren Schluck Kaffee und blickte Deborah achselzuckend an. »Keine Ahnung, was du jetzt von mir erwartest.« Er wollte nicht darüber sprechen, sondern wünschte sich nur, es wäre nie passiert.
»Ich möchte, dass du mir die Wahrheit sagst«, erwiderte Deborah leise. »Ich bin deine Agentin, Ray. Und in dieser Situation deine beste Freundin. Aber ich kann dich nicht verteidigen, solange ich nicht weiß, was stimmt und was nicht.« Sie holte tief Luft. »Begreifst du das?«
»Eigentlich steht in dem Artikel doch nichts wirklich Schlimmes …« Er würde diesem Bericht nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Ebenso wenig wie den vorherigen Storys, die Ida, seine Exfreundin, an die Presse verkauft hatte. Schließlich hatte er schon öfter harte Zeiten durchgemacht. Gut, die damaligen Berichte waren nicht so rufschädigend gewesen wie dieser hier. Doch er würde es überstehen.
»Du wirst als, und ich zitiere, ›zwanghaft und dominant‹ bezeichnet. Als ›Mann mit einer Schwäche für alle Laster des Lebens‹.«
»Was soll ich dazu sagen?«, fragte Ray. »Ich trinke eben gern mal einen über den Durst.« Er schluckte, und es gelang ihm irgendwie, weiter zu lächeln. Wie es in seinem Inneren aussah, war hingegen eine völlig andere Geschichte. Es kostete ihn alle Mühe, sich seine wahren Gefühle nicht anmerken zu lassen. Bleib geerdet. Sei stark. »Und da bin ich mit Sicherheit nicht der einzige Promi.«
»Ray, die Lage ist ernst. Wir werden kaum noch für Auftritte angefragt. Saturn Records drängt mich dazu, das Problem aus der Welt zu schaffen. Und ich muss zugeben, dass ich keinen Schimmer habe, wo ich anfangen soll.«
»Ich weiß immer noch nicht, was du von mir erwartest.« Das war seit dem Beginn von Idas Kreuzzug seine Strategie: den Kopf einziehen und zu allem schweigen. Hoffen, dass bald ein anderer Promi in Ungnade fiel oder die Serie EastEnders eingestellt wurde, damit sein Fall endlich aus den Schlagzeilen verschwand. Nur, dass Ida offenbar auf dem Kriegspfad war. Jede Woche gab es eine neue »Enthüllung«, mit der er sich herumschlagen musste. Vielleicht brauchte sie Geld. Ihre Trennung im vergangenen Jahr hatte sie anscheinend noch immer nicht verkraftet. Dass Ida Probleme hatte, lag jedenfalls auf der Hand. Möglicherweise war es wieder einmal Zeit, dass er einen Schritt auf sie zuging. Allerdings sträubte sich sein Bauchgefühl beim bloßen Gedanken daran wie ein zu früh aus dem Winterschlaf geweckter Bär.
»In dem Artikel heißt es nicht ausdrücklich, dass du sie geschlagen hättest«, fuhr Deborah fort. »Es wird nur angedeutet. Gerade genug, um die Leute auf solche Gedanken zu bringen. Aber für eine Klage reicht es nicht. Natürlich könnte ich einen Anwalt anrufen, falls du das möchtest, um zu prüfen, wie er die Sache sieht.«
Ray schüttelte den Kopf. So weit wollte er nicht gehen. Welchen Sinn hätte das gehabt? So war Ida nun mal. Besonders erfolgreich war sie als Künstlerin gerade nicht. Möglicherweise hatten die Zeitungen sie bezahlt, und sie hatte das Geld gebraucht. Es musste mehr dahinterstecken als einfach nur der Wunsch, ihm das Leben zur Hölle zu machen. Oder etwa nicht?
»Außer« – Deborah beugte sich ein Stück vor – »es ist ein Körnchen Wahrheit dabei. Ja, ich weiß, dass Ida zum Dramatisieren neigt. Und niemand würde es dir verübeln, wenn dir der Druck in der Musikbranche zu viel geworden wäre. In den letzten Jahren war es eine Achterbahnfahrt. Von null auf … nun, an die Spitze der Charts und …«
»Wieder zurück auf null«, ergänzte Ray mit einem Seitenblick. Bildete er es sich nur ein, oder wurde die Weihnachtsmusik, die im Café lief, lauter? Außerdem hatte er von Deborah bis jetzt kein Wort der Anteilnahme gehört. Und auch keinen Widerspruch. Lag er mit seiner Bemerkung, er sei wieder ganz unten angekommen, womöglich gar nicht so falsch? Stand es denn wirklich so schlimm?
»Ich sage es einfach geradeheraus, Ray: Das macht dich nicht unbedingt zum Kandidaten für den britischen Popmusik-Preis.«
Ray atmete tief aus. Allmählich wurde ihm klar, dass er etwas unternehmen musste. Aber was? Als er sich ans Kinn fasste, berührten seine Fingerspitzen einen inzwischen recht buschigen, ungestutzten und borstigen Bart.
»Ray«, versuchte Deborah es noch einmal.
»Kein bisschen davon ist wahr«, beteuerte Ray ernst. »Überhaupt nichts. Mehr kann ich nicht dazu sagen.« Er schob die Kaffeetasse von sich. »Komm schon, Deborah, du kennst mich doch. Du weißt, dass ich manchmal vielleicht ein Glas zu viel trinke und in den letzten Monaten viel gefeiert habe. Aber ich würde niemals die Dinge tun, die in diesen Interviews angedeutet werden.«
»Also lügt Ida einfach jedem, der ihr zuhört, etwas vor.«
»Tja …« Selbst jetzt wollte er verhindern, dass Ida in die Schusslinie geriet. Obwohl es darum ging, seine eigene Haut zu retten. Was war denn bloß los mit ihm? Sein Dad hätte ihn als Waschlappen und als Schwächling bezeichnet. Er sei nicht der Junge, den er damals nach einem deftigen Frühstück mit zum Hunderennen genommen hatte. Ein Frühstück wäre ihm im Moment übrigens sehr willkommen gewesen.
»Ray! Bitte! Mach endlich den Mund auf!« Inzwischen übertönte Deborahs Stimme das Gesäusel von Frank Sinatra, sodass ein junges Paar, das bei einem glasierten, von einem goldenen Stern gekrönten Eclair Händchen hielt, sich umdrehte und sie anstarrte. Ray griff nach Deborahs Hand. Doch seine Agentin machte sich sofort los und entzog sie ihm mit einem missbilligenden Zungeschnalzen.
»Du hast mich gebeten, den Mund aufzumachen«, konstatierte Ray.
»Damit meinte ich: keine neue Geschichte. Das wäre nichts als wieder Futter für die Presse.« Sie wies mit dem Kopf auf das beschlagene Fenster des Cafés. »Du weißt, dass auf der anderen Straßenseite Reporter lauern. Im Moment stopfen sie sich vielleicht noch mit Speckbrötchen voll, aber nachdem sie ihr Frühstück vertilgt haben, werden sie fotografieren, wie du mit mir hier sitzt.«
Ray wischte die Scheibe mit der Hand blank und spähte durch den stetig fließenden Verkehr zum Gehweg gegenüber. Er entdeckte zwei Männer, eindeutig Fotografen, die ihre dampfenden Kaffeebecher auf einem Verteilerkasten aus Metall abgestellt hatten. Ihre Hände lagen an den Kameras, die sie um den Hals trugen. Er sah Deborah an.
»Ich kann meine Miete nicht bezahlen«, gestand er. »Und meine Kreditkarten sind am Limit.«
»Was?«, rief Deborah entsetzt aus.
»Du weißt ja, was alles los war«, sprach Ray weiter. »Die Trennung von Ida und … der Sam-Smith-Faktor.«
»Du kannst deine Kreditkartenausgaben nicht auf den Erfolg eines anderen Sängers schieben. Außer, du hast dein Plastikgeld zusammen mit Sam Smith auf den Kopf gehauen.«
»Inzwischen lässt er sich am Telefon verleugnen«, antwortete Ray mit einem gezwungenen Grinsen. In Wirklichkeit war es nicht seine finanzielle Lage, ja, nicht einmal sein Problem mit Ida, das ihn am meisten beschäftigte. Er hatte am Nachmittag einen Arzttermin und war immer noch nicht sicher, ob er hingehen sollte.
»Gut, dann werde ich jetzt schonungslos ehrlich zu dir sein, Ray, denn ich habe keine Lust, meinen Tag damit zu vergeuden, hier zu sitzen und mir deine Ausflüchte anzuhören.« Deborah seufzte auf. »Von nun an kriegst du von mir nur noch die nackten Tatsachen.« Sie holte tief Luft. »Du hast zwei Möglichkeiten: Du kannst den Kopf in den Sand stecken, hoffen, dass Gras über die Sache wächst, und der Möglichkeit ins Auge sehen, dass deine Karriere als Musiker endgültig vorbei ist. Oder du gehst an die Öffentlichkeit, streitest Idas Vorwürfe ab und erzählst deine Version der Dinge.« Deborah griff nach ihrem Tee. »Ich könnte dich bei Frauenzimmer unterbringen.«
»Frauenzimmer?«, wiederholte Ray kopfschüttelnd.
»Das optimale Forum für dich, um der Welt mitzuteilen, dass an diesen Geschichten nichts, aber auch gar nichts Wahres dran ist. Betone, dass du Idas Einschätzung eurer Beziehung respektierst, dass sie aber in … großen Schwierigkeiten steckt. Der Ausdruck ›große Schwierigkeiten‹ stellt dich als anteilnehmend und mitfühlend dar, weist jedoch auch darauf hin, dass Ida ein bisschen durchgeknallt ist.« Sie nippte an ihrem Tee. »Und dann fügst du hinzu, du hoffst, dass Ida sich die Hilfe sucht, die sie braucht. Daraus werden die Leute schließen, dass sie kurz vor der Einweisung in eine psychiatrische Klinik steht.«
Viele wahre Worte wurden schon im Scherz ausgesprochen. Oder, wie in diesem Fall, als Teil einer Strategie. Dennoch sagte Rays Bauchgefühl ihm, dass das nicht in Ordnung war. Ja, Ida brauchte wirklich Hilfe, doch tief in seinem Innersten wusste er, dass es nicht die richtige Vorgehensweise war. Sie zu zwingen, öffentlich Farbe zu bekennen, konnte durchaus zur Folge haben, dass sie eine Dummheit machte. Und trotz allem, was sie ihm antat, wollte er sein Gewissen nicht damit belasten.
»Ich weiß nicht«, erwiderte er zögerlich.
»Du weißt es nicht?«, entgegnete Deborah. »Du weißt es nicht? Ray, wenn du nicht irgendetwas sagst oder tust, wird die Welt aus der Berichterstattung in der Sun und dem Daily Mirror ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen.«
Er schob die Kaffeetasse weg. »Eines kann ich dir mit Sicherheit sagen, Deborah. Ich trete nicht bei Frauenzimmer auf.«
KAPITEL DREI
Grundschule Stretton Park
»Tropifrutti?«
Ehe Emily Gelegenheit zu einer Antwort hatte, wurde ihr eine Maxi-Tüte Haribos unter die Nase gehalten, und zwar von Dennis Murray, Mitte vierzig und Lehrer der fünften Klasse. Als er die Tüte schüttelte, stieg Emily der Geruch der verschiedensten Gummiteile in die Nase. Sie nahm sich etwas, einfach nur, damit die Tüte wieder verschwand. Als sie das Teil in den Mund steckte, traf der künstliche Geschmack ungebremst ihre Geschmacksknospen, sodass sie das Gesicht verzog. Ein Auge zugekniffen, beobachtete sie, wie Dennis fünf Gummiteile auf einmal verschlang, sodass sein Doppelkinn wabbelte. Obwohl er bekanntermaßen süchtig nach Süßigkeiten aller Art war, erstaunte es sie immer wieder, wie viel Zuckerzeug er vertilgen konnte. Simon hatte Süßigkeiten geliebt: Malteser-Schokokügelchen, Minstrels-Schokolade, Marsriegel, ach, überhaupt alles mit Schokolade. Doch Emily hatte eine ähnliche Schwäche, allerdings für Käse.
»Worum, glaubst du, geht es diesmal in dieser Budgetbesprechung?«, fragte Dennis und stieß Emily an, während die anderen Lehrer nach und nach den Saal betraten, der für Versammlungen, Aufführungen, für das Mittagessen und für Sitzungen wie die heutige genutzt wurde. »Wird Weihnachten abgesagt? Keine überflüssigen Ausgaben, bis im Januar die Schule wieder anfängt?«
»Keine Ahnung«, antwortete Emily. »Doch ich muss mich bedeckt halten, ganz egal, was passiert.« Sie senkte die Stimme und beugte sich näher zu Dennis hinüber. »Susan hat mich heute Morgen dabei erwischt, wie ich Jayden Jackson bei seinem Projekt geholfen habe. Außerdem habe ich ihm einen Bagel gekauft, weil ich weiß, dass er zu Hause kein Frühstück bekommt.« Sie selbst frühstückte fast nie, doch das lag daran, dass die Küchenschränke seit Jonahs Auszug immer leer zu sein schienen. Und ein wirklich starker Kaffee zählte doch fast als Frühstück, oder?
Dennis sog Luft durch die zerquetschten Gummifrüchte ein, die zwischen seinen Zähnen klebten. »Doppeltes Pech.«
»Schon gut«, seufzte Emily. »Beinahe wäre das Sprichwort wahr geworden, dass aller guten Dinge drei sind. Das Klebeband an den Weihnachtssternen hat nur so lange gehalten, bis Susan zur Tür hinaus war.« Es machte sie nervös, dass sie unter Beobachtung stand. Sie zupfte an den Seiten ihres dunkelbraunen Cordrocks und rutschte mit dem Po auf dem zu kleinen Stuhl herum. Hatte sie einen für Kinder erwischt? Zu ihrer aktuellen Pechsträhne hätte das gepasst.
»Und in diesem Jahr gibt es ganz bestimmt keine zusätzlichen Christbaumkugeln für den Baum der sechsten Klasse«, spottete Dennis und kaute weiter auf seinen Gummiteilen herum.
Plötzlich meldete sich Emilys Telefon mit einem vogelähnlichen Zwitscherkonzert aus ihrer buntgemusterten Gobelintasche. Die Tasche war ein Schnäppchen gewesen. Gut, zugegeben, sie hatte verhältnismäßig viel gekostet, doch immerhin handelte es sich um ein Originalstück aus den Fünfzigern. Außerdem war Emily bei ihrem Besuch in der Vintage-Boutique emotional ziemlich aufgewühlt gewesen. Gefühle und ihre Liebe zu Antiquitäten waren eine gefährliche Mischung.
»Schalte das besser ab, bevor Susan kommt«, warnte Dennis, knüllte seine inzwischen leere Süßigkeitentüte zusammen und stopfte sie in die Hosentasche seines Anzugs aus Polyester.
Emily warf einen Blick aufs Display. Es war Jonah. Seit sie nicht mehr zusammenwohnten, schrieb er ihr noch öfter als vorher. Sie fragte sich, ob er befürchtete, sie würde verhungern, weil er nicht mehr da war, um für sie zu kochen. Ein Glück, dass er nichts von ihren leeren Küchenschränken wusste.
Jonah war ein ausgezeichneter Koch und Küchenchef in einem nahe gelegenen Hotel. Sie vermisste sein superscharfes Chili und sein mariniertes jamaikanisches Hühnchen fast noch mehr als ihn selbst.
Wann bist du heute Abend zu Hause?
Emily runzelte die Stirn. Bildete sie es sich nur ein, oder klangen die Wörter »zu Hause« so, als wären damit sie beide gemeint? Wie in »ihr gemeinsames Zuhause«? Vielleicht hatte Jonah es sich ja anders überlegt, war zurückgekommen, hatte ausgepackt und bereitete in diesen Minuten ein karibisches Gericht zu. Die Vorstellung heiterte sie sofort auf.
»Emily«, sagte Dennis.
»Gleich«, erwiderte Emily und tippte eine Nachricht.
Sitzung in der Schule. Hoffentlich um sechs. Ziehst du wieder ein?
Als er verkündet hatte, dass er ausziehen würde, hatte sie mindestens zehnmal nachgehakt, ob er auch wirklich sicher sei. Und danach noch bestimmt zehn weitere Male. Sie musste sich noch immer daran gewöhnen. Jonah war nicht mehr da, und Simon hatte sie auch verloren. Die Trauer um ihn machte ihr am meisten zu schaffen.
Sei pünktlich. Ich koche thailändisch
Jonah kochte. Er würde dafür sorgen, dass sie nicht verhungerte. Sie freute sich wirklich darüber. Eigentlich sollte sie ihm ein Weihnachts-Emoji schicken. Dann würde er vielleicht auch ein paar von den festlich eingewickelten Schokoladentäfelchen mitbringen, die sie im Hotel inzwischen vermutlich auf die Kopfkissen legten. Denn nach dem göttlichen grünen Curry, das er zaubern würde …
»Miss Parker!«
O Gott. Das war Susans Stimme, lauter als am Spieltag im Twickenham-Rugbystadion. Als sie von ihrem Telefon aufblickte, stellte sie fest, dass die Rektorin sie von ihrem Podium vorn im Raum aus finster ansah. Hinzu kam, dass besagtes vordere Ende des Raums nur zehn Sitzreihen entfernt war, denn in Wahrheit befanden sie sich ja nicht im Twickenham-Stadion.
»Verzeihung, Susan, ich meine, Mrs Clark.«
»Wie ich schon sagte, die Mittel.« Susan hielt die Luft an, worauf sich ihre Bluse kurz entspannte. »Ich fürchte, Haushaltsfragen sind das Kernthema an einer modernen Schule. Vorbei sind die Zeiten, in denen man einfach hundert Radiergummis bestellt hat, weil sie im Angebot waren … oder ausgesprochen hübsch … oder gut rochen … oder …« Susan atmete ein.
»Ein Glück, dass wir über Radiergummis, nicht über Leim reden«, raunte Dennis. »Oder über Eddings. Von einem Freund an einer weiterführenden Schule habe ich gehört, dass es gerade angesagt ist, an Eddings zu schnüffeln.«
»Mann, wirklich?«, flüsterte Emily kopfschüttelnd.
»Ich als Ihre Vorgesetzte«, fuhr Susan fort, »muss für jeden einzelnen Gegenstand, für den wir Geld ausgeben, Rechenschaft ablegen. Nicht nur für jeden Packen Papier, sondern für jedes Blatt. Sogar fürs Toilettenpapier.«
»Herrje«, keuchte Dennis. »Ich hätte mehr Süßigkeiten mitbringen sollen. Das ist ja Folter. Wie eine gute Serie, die schon zu lange läuft. Und zwar, nachdem die Handlung auf den Pluto verlegt wurde.«
Emily konnte ihm nicht widersprechen. Sie mussten bereits mit sehr beschränkten Mitteln auskommen. Nach Halloween hatte sie deshalb beschlossen, den Festtagsschmuck für ihr Klassenzimmer aus eigener Tasche zu bezahlen. Jonah meinte immer, sie sei einfach viel zu gut für diese Welt. Und ihre Eltern predigten, Mitgefühl würde sie nicht weiterbringen. Ganz im Gegensatz zu einem Selbstbehauptungs-Seminar. Und Simon war nicht mehr da, um ihr den Rücken zu stärken.
Susan räusperte sich. »In dieser Woche werde ich eine gründliche Inventur Ihrer Klassenzimmer durchführen. Ich fürchte, ich werde neue Materialanforderungen äußerst sorgfältig überdenken müssen, und zwar bis …« Die Pause schien sich eine Ewigkeit hinzuziehen. »… Februar.«
»Was?« Emily hatte gar nicht bemerkt, dass sie laut gerufen hatte und dazu sogar aufgestanden war. Vielleicht war ein Selbstbehauptungs-Seminar ja doch überflüssig.
»Möchten Sie etwas sagen, Miss Parker?«, erkundigte sich Susan und ließ dabei die Mine des Stifts in ihrer Hand klicken.
Sie hätte den Mund halten und sich fügen sollen. Denn Dennis hatte zwar groß getönt, dass sie es wohl mit einer längst abschussreifen Fernsehserie zu tun hätten, war jedoch brav sitzen geblieben. Genau genommen kauerte er sich gerade auf seinem Stuhl zusammen und verkroch sich in seinem Parka, als handelte es sich um eine Tarnkappe.
»Ich wollte nur sagen«, begann Emily. Kurz geriet sie ins Stocken. Was wollte sie eigentlich sagen? Dass es Wahnsinn war, jedes Blatt Papier zu zählen? Dass man nicht richtig arbeiten konnte, wenn die Gedanken ständig um die Frage kreisten, wie viel Tinte man verbrauchte?
»Ich wollte nur sagen«, fuhr sie fort, »dass mir klar ist, welche Leistung es bedeutet, so viele Aufgaben wie Sie zu schultern, Susan … Mrs Clark. Und ich bin sicher, dass niemand hier Sie um diese Position beneidet. Damit meine ich nicht Ihre Stellung als Rektorin, denn darum beneidet sie vermutlich fast jeder.« Emily schluckte. Sie drückte sich völlig falsch aus. »Nun, vielleicht ist Neid nicht das richtige Wort, aber, wie dem auch sei, wir haben bald Weihnachten. Die Kinder waren in diesem Schuljahr wirklich fleißig. Meiner bescheidenen Meinung nach sollten wir großzügiger sein … besonders in diesem Halbjahr.« Emily spürte buchstäblich das Knistern, das von ihren Kollegen aufstieg. Ein rascher Seitenblick zu Mrs Linda Rossiter (dritte Klasse) brachte ihr nichts weiter ein als die Aussicht auf einen streng aufgesteckten, grau melierten Dutt. Die Frau starrte auf ihren Schoß und hatte die Hände wie zum Gebet gefaltet. Niemand würde Emily beistehen. Die anderen waren einfach zu bequem. Und hatten wahrscheinlich auch Angst, man könne sie aus der Schule hinaus und direkt ins Arbeitsamt bugsieren.
»Weshalb besonders in diesem Halbjahr?«, bohrte Susan in scharfem Ton nach.
»Nun.« Emily bemühte sich, Ruhe zu bewahren und sich gleichzeitig nicht von ihrer Überzeugung abbringen zu lassen. Sie zog die Ärmel ihrer cremefarbenen Strickjacke glatt. »Wir haben Weihnachten, richtig? Die Kinder lieben diese Zeit. Sie lieben es, zu basteln und alles mit Glitzer zu verzieren. Und außerdem ist da noch das Weihnachtsessen mit einem riesigen Trifle und Plätzchen für alle. Und die Weihnachtsaufführung …«
»Aha!«, unterbrach Susan lächelnd und reckte den Finger, als wollte sie Emily am Weitersprechen hindern. »Die Weihnachtsaufführung. Gut, dass Sie das erwähnen.«
»Sie wollen doch nicht etwa die Weihnachtsaufführung streichen, oder?« Endlich meldete sich jemand anderes zu Wort. Dennis hatte sich erhoben. Der Mantel hing ihm um die Schultern, und ein Paar dicke Handschuhe fiel zu Boden. »Ja, ich weiß, dass wir auf Mr Jarvis und sein fantastisches Klavierspiel verzichten müssen, aber deshalb sollten wir die Aufführung doch nicht ganz absagen. Für so etwas hat man heutzutage Spracherkennungssysteme, richtig? Sie wissen schon, Alexa, spiel eine Instrumentalversion von ›Stille Nacht‹.«
»Ich streiche die Aufführung nicht«, entgegnete Susan. »Ganz im Gegenteil. Obwohl wir an dieser Einrichtung im Alltag sparen müssen, werden wir auch in diesem Jahr dank eines großzügigen Sponsors eine Weihnachtsaufführung auf die Beine stellen.«
»Sponsor?«, hakte Emily nach.
Inzwischen war es im Saal unruhig geworden. All ihre Kollegen hoben die Köpfe, erwachten zum Leben und gaben ihren Senf dazu.
»Ja. Ahmer Dar von Dar’s Delhi Delights ist einer der Geschäftsleute, die uns eine beträchtliche Summe gespendet haben, um diesem Halbjahr nach dem Fleiß und den Bemühungen aller Beteiligten zu einem hoffentlich traumhaften Höhepunkt zu verhelfen.«
Rashids Dad. Emily schloss die Augen. Wenn er die Weihnachtsaufführung finanzierte, war es umso schwieriger anzusprechen, dass sein Sohn andere Mitschüler schikanierte. Schlimmer konnte dieser Tag kaum mehr werden.
»Die Kinder müssen doch nicht etwa alle T-Shirts mit dem Logo des Restaurants tragen, oder?« Die Frage kam von Linda Rossiter, auf deren Gesicht sich ein panischer Ausdruck breitmachte. Ihr Mann war Inhaber des Fish-and-Chips-Restaurants im Viertel, und Ahmer Dar hatte Gerüchten zufolge frittierten bengalischen Fisch und Pommes in seine Speisekarte aufgenommen, um Ralph die Kundschaft abspenstig zu machen. Allerdings hatte Ralph sich rasch revanchiert und bot jetzt am Wochenende gewaltige Bhaji-Brötchen mit Currysauce zum Sonderpreis an.
»Nein, natürlich nicht«, tat Susan die Frage ab. »Aber selbstverständlich wird das Unternehmen ausführlich im Programm und vielleicht in einigen Zeilen während der Vorstellung erwähnt.«
Das Stimmengewirr wurde lauter. Also ergriff Emily die Gelegenheit und setzte sich, solange Susan abgelenkt war.
»Ruhe«, befahl die Rektorin. »Sie führen sich ja auf wie die Kinder!« Sie schüttelte den Kopf. »Das ist eine tolle Sache. Einfach großartig. Vor allem wenn man bedenkt, was ich Ihnen gerade über unsere kleinen Sparmaßnahmen erzählt habe.« Sie ließ den Blick über sämtliche Anwesenden schweifen, bis diese sich vor Verlegenheit wanden. »Mit der diesjährigen Aufführung werden wir die Gemeinschaft zusammenschweißen. Denn es war schon immer das Ziel von Stretton Park, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Richtig?«
Gemeinschaft. So klang es schon ein wenig besser. Sie würden es eben eine Weile mit schlechten Klebestiften aushalten müssen. Zumindest würde es eine fantastische Weihnachtsaufführung geben. Vielleicht konnte sie ja bei den Kostümen helfen …
»Und, Miss Parker«, fuhr Susan fort. »Ich bin so froh, dass Sie die Aufführung angesprochen haben, denn ich möchte, dass Sie an vorderster Front stehen.«
An vorderster Front? Was sollte das jetzt schon wieder heißen? Emily brauchte Klarheit. »Verzeihung, wie bitte?« Sie schluckte. »Was genau bedeutet das?«
»Ich möchte, dass Sie in diesem Jahr eine festliche Revue organisieren, auf die die Diözese wirklich stolz sein kann. Alles sollte natürlich unter einem starken christlichen Motto stehen. Mit Liedern, Gesang und Tänzen. Sie wissen schon, wie in dem Musical The Greatest Showman oder in Mamma Mia, aber mit … mit Jesus.«
Emily wollte schlucken, aber ihre Kehle fühlte sich plötzlich an, als wäre ihr ein Stück Terry’s Orangen-Milchschokolade in der Luftröhre stecken geblieben. Das durfte doch nicht wahr sein. Festliche Revue. The Greatest Showman. Gut, sie sang manchmal, wenn niemand zuhörte, aber sie besaß nicht die Spur einer musikalischen Begabung. Die Blockflöte war das einzige Instrument, das sie je gespielt hatte, und der einzige Erfolg, den sie damit erzielt hatte, war es, ihre Eltern damit in den Wahnsinn zu treiben. Wenn sie sich richtig erinnerte, war das Instrument auf mysteriöse Weise verschwunden.
»Mrs Clark, ich glaube nicht …«, begann Emily. So etwas würde sie niemals schaffen. Plötzlich ruhten die Blicke all ihrer Kollegen auf ihr, und zwar so erwartungsvoll, als hätte sie sich auf einmal in Andrew Lloyd Webber verwandelt.
»Fantastisch! Sie haben bis zum 20. Dezember Zeit, die Show Ihrer kleinen Lieblinge auf die Bühne zu bringen. Gut, falls sonst nichts anliegt, machen wir jetzt Schluss. Bis morgen.« Susan befand sich bereits auf halbem Weg zur Tür.
Emily war fassungslos. Wie, zum Teufel, sollte sie in wenigen Wochen eine Weihnachtsshow auf die Beine stellen? Mit Liedern und Tänzen? Aufgeführt von Kindern mit eher mittelmäßig ausgeprägten künstlerischen Fähigkeiten? Am liebsten wäre sie in Tränen ausgebrochen. Außerdem hätte sie jetzt gerne eine Flasche Tonic Water mit Holunderaroma in sich hineingekippt und dabei mit vollem Ernst so getan, als wäre es Gin.
»Nun«, raunte Dennis ihr ins Ohr. »Das ist ja mal eine Überraschung. Aber ich habe volles Vertrauen in dich, Emily. Auch wenn die Fußstapfen, in die du da trittst, enorm sind. Immerhin wäre eine Komposition von Mr Jarvis beinahe der britische Beitrag zum Eurovision Song Contest geworden.«
Emily schloss die Augen und bereute, dass sie die Jahresabschlussveranstaltung überhaupt angesprochen hatte. Der einzige Lichtblick war, dass es schon die dritte schlechte Nachricht für heute war. Und aller guten Dinge waren drei, nicht vier, das wusste doch jedes Kind. Endlich war der Tag an seinem Tiefpunkt angelangt, und sie konnte sich auf ein thailändisches Essen freuen. Außerdem würde Susan die Aufgabe gewiss jemand anderem übertragen, wenn sie erst von Emilys nicht vorhandenem musikalischen Talent erfuhr. Sie musste nur Ruhe bewahren. Wenn Dennis bloß nicht einen imaginären Zylinder gelupft und die Melodie von »This Is Me« gepfiffen hätte …
KAPITELVIER
Harley Street, Marylebone
Es war bereits früher Abend, als Ray Dr. Crichtons Praxis im Herzen von London betrat, die bislang glücklicherweise vom Weihnachtsfieber verschont geblieben war. Es hatte ihm schon gereicht, durch die festlich geschmückte Marylebone High Street zu schlendern und dabei Deborahs Nachricht auf seiner Mailbox zu lauschen, die vorschlug, er könne doch auch eine Weihnachtsbeleuchtung einweihen. Es hätte allerdings an ein Wunder gegrenzt, wenn seine Agentin irgendwo in London noch ein Stadtviertel gefunden hätte, in dem nicht bereits weihnachtliche Lichtlein brannten. Oder einen Menschen, der nach den jüngsten Veröffentlichungen in der Presse noch Interesse daran gehabt hätte, Ray zu seinem Markenbotschafter zu ernennen. Und so saß er jetzt hier in dem vertrauten Schalensitz aus Leder und betrachtete das ebenfalls vertraut blubbernde Aquarium mit seinem Schwarm schwarzer Fische, die allesamt aussahen, als hätten sie Zähne. Er selbst hatte als Junge nur ein einziges Haustier besessen, eine Rennmaus namens Scoot. Lange hatte sie nicht durchgehalten.
Ray schluckte. Sein Blick wanderte ins Leere, und seine Hände klopften beim Warten links und rechts auf die Armlehnen des grünen Sessels. Am liebsten hätte er an dem Lederbezug gekratzt, um seine Ungeduld zu bekämpfen, doch er hatte den Verdacht, dass der Sessel wie fast jedes Stück in dieser Praxis antik war. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zusätzlich zu dem Medienrummel fehlte ihm gerade noch. Deborah würde ihn als Klienten vor die Tür setzen. Oder ihn zum Gehorsamkeitstraining verdonnern wie ihren Hund. Er wusste nicht, was schlimmer war.
Endlich öffnete sich die Tür hinter ihm, und Ray wandte ein wenig den Kopf. Herein kam ein strahlender Dr. Crichton, wie immer in einem dreiteiligen grauen Anzug. Der Mann schwankte stets zwischen überschäumender Glückseligkeit und an Wahnwitz grenzender rasender Wut. Ray wusste noch nicht, was heute an der Reihe war. Doch da es sich nun einmal um seinen Arzt handelte, konnte er nur hoffen, dass er nicht mit Letzterem zu tun haben würde.
»Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten, Ray. Sie wissen ja, wie es mit diesen Prominenten ist.« Er lachte über seinen eigenen Witz und ließ sich in den etwas größeren grünen Ledersessel hinter seinem massiven Schreibtisch fallen. Dann griff er zu einem Briefbeschwerer aus Glas und warf ihn zwischen seinen Händen hin und her, als wollte er das Gewicht eines Kricketballs abschätzen.
»Ariana Grande?«, fragte Ray mit einem hämischen Grinsen.
Dr. Crichton lachte dröhnend und schlug sich mit dem Briefbeschwerer in die Handfläche. »Die, die ich meine, wäre es wohl gerne. Doch um das zu erreichen, müsste ich Zauberkunststücke vollbringen.« Er tippte sich an die Nase. »Aber verraten Sie mich nicht.«
Der Grund seines Besuchs kratzte an Rays Verstand wie der inzwischen allzu oft auftretende Schmerz in seinem Hals.
»Nun zu Ihnen«, begann Dr. Crichton, legte den Briefbeschwerer weg, beugte sich über den Schreibtisch, stützte die Ellbogen auf die Tischplatte und legte die Handflächen aneinander. »Tja, Ray, ich fürchte, ich habe keine guten Nachrichten.«
Er hatte es geahnt. Etwas stimmte nicht mit ihm, und er hatte viel zu lange nicht darauf geachtet. Deborah hatte er es verheimlicht. Nicht einmal sich selbst hatte er es wirklich eingestanden. Und jetzt?
»Aber schlechte Nachrichten sind es meiner Ansicht nach auch nicht«, fuhr Dr. Crichton fort. Mit einem übertriebenen Grinsen schob er seine goldgeränderte Brille hoch. »Laut Spiegelung ist da nichts, was sich nicht mit etwas Schonung und einer kleinen Operation in Ordnung bringen ließe.«
»Eine Operation?« Eigentlich hatte er es nur denken wollen, doch die Worte waren einfach so aus ihm herausgesprudelt, mit überschnappender Stimme. Im nächsten Moment sprang Dr. Crichton auf. Plötzlich hatte er eine wie aus dem Nichts herbeigezauberte Taschenlampe in der Hand und schaltete sie ein.
»Mund aufmachen«, befahl er. »Passiert das öfter?«
Ray wusste nicht, ob er wie beim Zahnarzt den Mund öffnen oder zuerst die Frage beantworten sollte. »Ob was öfter passiert?« Als die Taschenlampe sich näherte, riss er den Mund weit auf. Der Arzt beugte sich über ihn, hielt das Gesicht dicht an seines und spähte ihm neugierig in die Kehle.
»Dass Ihnen die Stimme wegkippt. Halten Sie still.« Der Arzt legte Ray die Hand auf den Scheitel und musterte weiter seinen Hals, bevor er die Taschenlampe ausschaltete und sich an den Schreibtisch lehnte.
»Ich weiß nicht«, erwiderte Ray. »Wahrscheinlich … manchmal … Ich habe es immer darauf geschoben, dass es am Abend vorher wieder mal spät geworden ist.«
»Hm«, brummelte Dr. Crichton. »Es sieht wieder mal ziemlich entzündet aus, Ray. Haben Sie seit unserem letzten Termin gesungen?«
Ray rang die Hände. »Ich bin Musiker. Das ist mein Job.« Er arbeitete gerade an einem neuen Album, denn schließlich hatte er noch einen Plattenvertrag zu erfüllen. Diesmal musste es etwas ganz Neues, Gefühlvolleres werden. Keine Soulmusik, sondern etwas, das tief aus seiner Seele kam. Seine besten Stücke waren immer die persönlichsten gewesen. Sie handelten davon, wer er war, woher er stammte und wohin er wollte. Bis jetzt war er zwar knapp an den dunkelsten Abgründen vorbeigeschrammt, doch einige seiner Liedtexte kamen der Sache schon ziemlich nah. Und ausgerechnet jetzt war er stimmlich nicht in Topform. Zusätzlich forderten die Schwierigkeiten mit Ida ihren Tribut, alles Dinge, die seinem Ideenreichtum und seiner Kreativität schadeten.
»Wie sieht es mit Drinks aus?«, erkundigte sich Dr. Crichton, wobei sich eine Augenbraue scheinbar wie von selbst hob. »Und nur damit es klar ist, ich meine damit kein aromatisiertes Mineralwasser.«
Ray schwieg. Manchmal war Alkohol das Einzige, was dafür sorgte, dass er sich besser fühlte, wenn ihm die Eingebung für neue Lieder fehlte. Ein Alkoholproblem hatte er allerdings nicht, er war für ihn nur Mittel zum Zweck. Wie die Atemübungen, die er eigentlich hätte machen sollen.
»Ray, das ist mein Ernst. Wenn Sie nicht auf meinen Rat hören und sich dementsprechend verhalten, werden Sie eines Tages gar keine Stimme mehr haben. Und das nicht nur beim Singen«, sprach der Arzt weiter. »Ich rede hier von einem Problem, das Ihr ganzes Leben verändern könnte.«
Der stechende Schmerz hinter den Ohren meldete sich wieder, als wollte er ihn daran erinnern, dass auch seine gesamten Nebenhöhlen betroffen waren.
»Das behaupten Sie«, antwortete Ray mürrisch. Mein Gott, warum führte er sich auf wie ein Unsympath? Ließ er die Sache mit der Presse zu nah an sich heran? Nach jahrelanger Beobachtung durch die Medien perlten derartige Dinge normalerweise von ihm ab wie schmelzendes Eis vom Dach des dreistöckigen modernen Stadthauses, in dem er wohnte. Nur dass es sich diesmal ganz anders anfühlte.
»Möchten Sie eine Zweitmeinung einholen?«, fragte Dr. Crichton, der inzwischen eher wahnwitzig als überglücklich wirkte. »Denn ich habe Ihren Fall bereits mit drei anderen Kollegen erörtert.«
»Nein«, erwiderte Ray kopfschüttelnd. Seine Finger sehnten sich noch immer verzweifelt danach, sich ins Leder der Armlehne zu krallen. »Nein, so habe ich es nicht gemeint.« Was er jetzt wirklich wollte, war ein Schluck von dem Alkohol, den er nicht trinken sollte und mit dem er auch absolut kein Problem hatte.
»Sie brauchen Ruhe, Ray«, verkündete Dr. Crichton. »Ihre Stimme braucht Ruhe.«
Er nickte. Keine Ahnung, warum er es tat, denn Deborah versuchte momentan, ihm immer mehr Auftritte zu vermitteln, um den Artikeln in der Regenbogenpresse etwas entgegenzusetzen und seine Karriere zu retten. Die eine wollte, dass er sang, damit die Medien ihm nicht mehr schaden konnten. Der andere warnte ihn, er würde seine Stimme ernsthaft gefährden, wenn er das tat. Und seine Stimme war mehr oder weniger das Einzige, was ihm geblieben war.
»Mein Rat«, fuhr Dr. Crichton fort, »lautet, ganz auf Alkohol zu verzichten. Und in den nächsten Wochen keinen einzigen Ton zu singen. Machen Sie die Atemübungen, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Soll ich Sie Ihnen noch einmal ausdrucken?«
Ray hatte die Anleitung bis jetzt keines Blickes gewürdigt. Sie lag zusammengeknüllt zu Hause auf dem Couchtisch in einer Obstschale, die nur Plastikobst enthielt. Dennoch schüttelte er den Kopf. »Nein, ich weiß es noch.«
»Ich betone«, sprach Dr. Crichton weiter und bedachte Ray mit einem befehlsgewohnten Blick, der auf lange Erfahrung hinwies, »dass Sie sich operieren lassen müssen. Obwohl es sicher hilfreich ist, wenn Sie Ihr Leben ändern, lege ich Ihnen dringend ans Herz, sich den Dezember frei zu halten. Nächste Woche sehen wir uns wieder, und dann kümmern wir uns darum, dass Sie noch vor Weihnachten einen OP-Termin bekommen.«
Ray schluckte. Er fühlte sich unglaublich angespannt, war aber gut darin, sich nichts anmerken zu lassen, und lächelte seinen Arzt an. »Kein Gesang, Ehrenwort«, erwiderte er seelenruhig. »Nicht einmal unter der Dusche.«
KAPITELFÜNF
Crowland Terrace, Canonbury, Islington
Der Anblick des strahlend violetten, mit silbernem, goldenem und nicht dazu passendem rotem Lametta überladenen Miniweihnachtsbaums in der Vorhalle der in mehrere Wohnungen aufgeteilten Stadtvilla brachte Emily zum Lächeln. Sie wusste, dass es der Baum von Sammie war, dem fünfjährigen Jungen aus der Parterrewohnung. Emily hatte zufällig ein Gespräch zwischen Sammie und seiner Mum Karen Anfang November belauscht, als der Junge darauf beharrt hatte, Halloween sei nun vorbei, weshalb es eindeutig Zeit sei für Weihnachten. Hut ab vor Karen, dass sie so lange hart geblieben war. Der Baum war ein kleiner Grund zur Freude, als Emily die Treppe zu der Dachgeschosswohnung hinaufstieg, die sie früher mit Simon und zuletzt mit Jonah bewohnt hatte. Jetzt teilte sie sie nur noch mit einem Schrank voller Vintage-Klamotten, für die sie eindeutig zu viel Geld ausgegeben hatte.
Durch die geschlossene Wohnungstür stiegen ihr die köstlichen Düfte Thailands in die Nase. Emily schloss die Augen. Unverkennbar Kokosmilch und Zitronengras mit einem Hauch exotischer Gewürze. Jonah besaß noch einen Schlüssel und war einfach hereingekommen, so als hätte sich nichts geändert. Genau, wie sie es sich wünschte. Emily seufzte auf. Sie fand, dass es ihr ziemlich gut gelungen war, so zu tun, als würde sie sich freuen, als Jonah den Schritt gewagt hatte, mit seinem Freund zusammenzuziehen – dem zauberhaften Allan, oder auch Doppel-L genannt, denn nachdem er immer wieder versucht hatte, so die Schreibweise seines Namens zu erklären, war das schnell zu seinem Spitznamen geworden. Zugegeben, die beiden Männer lebten in einer traumhaften Wohnung ganz in der Nähe, doch Emily vermisste Jonah trotzdem. Kurz hatte sie überlegt, ob sie vorschlagen sollte, dass er vier Nächte pro Woche bei Allan und die restlichen drei bei ihr wohnte, allerdings nie den Mut gehabt, es anzusprechen. Außerdem hätte sie dann vereinsamt gewirkt. Und fast dreißigjährige Frauen durften nicht vereinsamt wirken.
Emily schloss die Tür auf und schlüpfte rasch aus dem Mantel, weil ihr tropische Temperaturen entgegenschlugen. Es war viel zu heiß. Bestimmt war etwas mit der Heizung nicht in Ordnung, denn gestern hatte ein Klima wie am Nordpol geherrscht, während man sich inzwischen fast auf den Bahamas wähnte.
»Bevor du etwas sagst!«, rief Jonah aus der Küche. »Ich habe die Heizung nicht angefasst. Und ich schwitze wie die Exfreundin von Bradley Cooper bei einer ganz gewissen Oscarverleihung, nur damit du es weißt.«
Sie warf ihren Mantel auf das unter einer Decke verborgene Sofa und ließ sich einen Moment Zeit, um die Sterne zu betrachten, die durch die große Glasfront des geräumigen Wohnzimmers hereinfunkelten. Dann ging sie in die Küche und sah, an den Türrahmen gelehnt, ihrem besten Freund bei der Arbeit zu. Jonah war in seinem Element. Er hatte das schwarze Haar zu einem winzigen Pferdeschwänzchen im Nacken zusammengebunden und trug über der Jeans eine Schürze und dazu einen schmal geschnittenen korallenfarbenen Designerpulli. Mit der einen Hand rührte er etwas in Emilys großem Kochtopf um, während er mit der anderen brutzelndes Gemüse in einem Wok wendete.
»Wie war es in der Arbeit?«, fragte er so laut, als befände sie sich noch im Nebenzimmer.
»Ich bin hier«, antwortete Emily. Sie trat in die kleine Küche, die nur Platz für ein winziges Tischchen und zwei Stühle bot. Jonah hatte Platzdeckchen ausgebreitet und Wassergläser und Besteck, ja, sogar einige Teelichter bereitgestellt.
»Oh, entschuldige.« Er lachte auf. »Und wie war es in der Schule? Oder seid ihr schon in dem Stadium, in dem man nichts anderes mehr macht, als Schokolade zu essen, Plätzchen zu backen und Buddy – Der Weihnachtself anzuschauen?«
»Blödmann!« Emily versetzte ihm einen Klaps auf den Arm. Als sie versuchte, sich in dem beengten Raum zu bewegen, stieß sie mit der Hüfte an einen Stuhl. Ja, die Küche war wirklich zu klein, aber sie konnte den Tisch, wenn nötig, ja jederzeit ins Wohnzimmer stellen. Nur dass ihr das Wohnzimmer leer und luftig besser gefiel, deshalb stand er eben hier. Ihre Mahlzeiten verputzte sie meistens auf dem Sofa vor dem Fernseher, während Long Lost Family mit Davina McCall lief.
Sie nahm Jonah den Holzlöffel aus der Hand, um sein neuestes kulinarisches Meisterwerk zu kosten. Mit geschlossenen Augen ließ sie sich die verschiedenen Aromen auf der Zunge zergehen. Es schmeckte einfach himmlisch und erinnerte sie an Sommerabende auf der Dachterrasse. Jonah und Simon grillten, während sie versuchte, die solarbetriebene Lichterkette in Gang zu setzen, ehe es so dunkel wurde, dass man den Wein nicht mehr fand. Die Dachterrasse war ihr Lieblingsplatz in der Wohnung. Sie war zwar nicht groß, wurde aber nur von ihr genutzt. Sie hatte einen hübschen Holzboden und bot einen traumhaften Blick über die Stadt. Dank der Terrassenstrahler konnte man sich das ganze Jahr dort aufhalten, was den beschränkten Platz in der Küche mehr als wettmachte. Emily riss sich aus ihren Tagträumen und gab Jonah den Löffel zurück. »Einfach köstlich«, seufzte sie. »Genau das, was ich nach dem Tag heute brauche.«
»Ach ja?« Jonah stellte den Wok ab, schaltete das Gas aus und holte Teller aus einem Schrank über dem Herd.
Wo sollte sie anfangen? Damit, dass Susan sich aufgeregt hatte, weil sie Jayden durchfütterte und ihm bei seinem Projekt half? Oder mit der Weihnachtsaufführung?
Sie beobachtete, wie Jonah das fertige Gericht geschickt auf zwei Tellern anrichtete und daneben getropfte Sauce wegtupfte wie im Hotel oder bei Masterchef im Fernsehen. Er tat, als handelte es sich um einen besonderen Anlass. Hatte sie etwa ein Datum vergessen? Geburtstag hatte er nicht, denn der war erst im März. Oder gab es Probleme zwischen ihm und Doppel-L? Sosehr sie sich auch wünschte, Jonah möge zurückkommen, sollte das nicht auf Kosten seines Glücks geschehen. Außerdem hatte sie Allan sehr gern.
»Was ist los?«, erkundigte sich Emily. Plötzlich war sie ziemlich besorgt.
»Setz dich«, wies Jonah sie an. »Ich hole nur das Roti-Brot.« Als er sich bückte, rammte sein Po einen Stuhl. »Vielleicht müsstest du den Tisch ein Stückchen verrutschen.«
»Du hast Roti-Brot gebacken?«, rief Emily und zog an dem Tisch, bis er ein paar Zentimeter verrückt war, bevor sie sich setzte. »Jetzt weiß ich, dass es etwas Ernstes sein muss. Was ist passiert, Jonah?«
»Hast du den niedlichen Weihnachtsbaum an der Haustür gesehen? Ich finde, dass Sammie das großartig gemacht hat.« Er kehrte ihr noch immer den Rücken zu.
»Jonah! Ich esse keinen Bissen, solange du mir nicht erzählst, warum du hier bist und in meiner Miniküche thailändisch kochst. Und das, obwohl du jahrelang über diese Küche gejammert hast und ich weiß, dass du bei Doppel-L Luxusarbeitsplatten aus Granit, ein großes Keramikspülbecken und eine eingebaute Grillpfanne hast.«
Endlich drehte Jonah sich zu ihr um und deponierte einen perfekt arrangierten Teller vor ihr auf dem Platzdeckchen. »Es ist angerichtet.«
»Du willst etwas von mir«, mutmaßte Emily. »Dir ist klar geworden, dass dir der Fernseher fehlt, den du zur Hälfte bezahlt hast, und jetzt weißt du nicht, wie du es mir beibringen sollst. Gut, Jonah, er gehört dir, wie ich schon gesagt habe. Ich kann mir den alten Fernseher an die Wand hängen oder ihn auf einen Stuhl stellen, bis ich etwas anderes finde.«
Jonah setzte sich, brachte seinen sorgfältig angehäuften Reisberg zum Einsturz und steckte sich eine Gabel mit Reis, Gemüse und Curry in den Mund.
»Du kannst nicht ewig den Mund voll haben«, verkündete Emily. Ihr Teller war noch unberührt, stattdessen fixierte sie ihren besten Freund mit Blicken.
»Sei nicht sauer«, erwiderte Jonah, offenbar unsicher, wie er sich ausdrücken sollte.
»Falls du Allan verlassen haben solltest, werde ich sauer. Doch wir können in aller Ruhe darüber reden, bis dir klar wird, was für ein Idiot du bist.« Sie griff nach der Gabel. »Aber das ist nicht der Grund, richtig?«
Lächelnd schüttelte Jonah den Kopf. »Natürlich nicht.«
»Also …« Sie verstummte, und ihre Augen weiteten sich. »Nein! Du hast doch nicht etwa meine Eltern eingeladen, oder?«
»Ich bin doch nicht lebensmüde«, entgegnete Jonah.
Emily schlug die Hand vor die Brust. Sie lud ihre Eltern nämlich grundsätzlich nicht ein. Die beiden hatten sämtliche Synonyme für »klein« auf Lager und wendeten sie genüsslich auf jeden, aber auch jeden Raum in ihrer Wohnung an. Sogar auf ihre Dachterrasse, die Alegra, ihre Mutter, bei Emilys Einzug als »nettes Fleckchen« bezeichnet hatte. Es war deshalb eine unsinnige Vermutung anzunehmen, dass sie auf dem Weg hierher waren. William und Alegra lehnten Jonah ab, seit sie ihm bei einer der Benefizveranstaltungen ihrer Mutter zum ersten Mal begegnet waren. Für gewöhnlich setzte Alegra bei solchen Gelegenheiten nur auf ihren beruflichen Einfluss und ihr Geld, nicht auf ihre tatsächliche Anwesenheit. Doch damals, als Emily zehn Jahre alt und an Mandelentzündung erkrankt war, weshalb sie nicht zur Schule gehen konnte, hatte Alegra den Besuch eines Gemeindezentrums in einem weniger wohlhabenden Stadtviertel unmöglich absagen können und daher Emily einfach mitgenommen. Wie sich herausstellte, ließ Jonahs Dad sich dort zum Mechaniker weiterbilden. Und Jonah lungerte mit seinem Fahrrad vor dem Zentrum herum, in der Hand ein stark zuckerhaltiges Sprudelgetränk, das für Emily streng tabu war. Während Alegra betonte, wie wichtig ihr ein für alle zugänglicher höherer Bildungsabschluss sei – das hieß, sie log wie gedruckt –, hatten Emily und Jonah sich angefreundet und abwechselnd auf der Skateboardrampe Kunststücke mit seinem Fahrrad vollführt. Obwohl Emily gestürzt war und sich am Knie die Jeans zerrissen und die Haut aufgeschürft hatte, hatte sie jede Minute genossen. Die beiden hatten Adressen getauscht und einander geschworen, in Verbindung zu bleiben. Und das hatten sie auch getan. All die Jahre lang.
»Du musst mein Zimmer weitervermieten«, fuhr Jonah rasch fort.