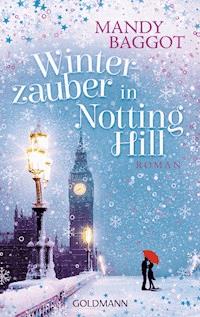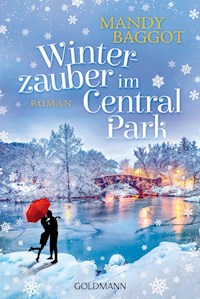8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Warmherzig, winterlich, wundervoll. Der neue Weihnachtsbestseller von Mandy Baggot.
Ava und ihre beste Freundin landen genau zur richtigen Zeit in Paris: Der erste Schnee fällt, der Eiffelturm erstrahlt in goldenem Licht, und der Duft von Zimt liegt in der Luft. Die beiden Freundinnen sind nicht ohne Grund in der Stadt der Liebe. Ava braucht nach einer hässlichen Trennung Ablenkung. Und was ist da besser als Pariser Weihnachtsmärkte, Spaziergänge an der Seine und warmes Pain au Chocolat? Gerade als Ava glaubt, dass sie gar keine Männer im Leben braucht, begegnet sie dem geheimnisvollen Fotografen Julien. Sein französischer Akzent, seine haselnussbraunen Augen – und um Ava ist es geschehen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Ähnliche
Buch
Ava und ihre beste Freundin Debs landen genau zur richtigen Zeit in Paris: Es ist Weihnachten. Der erste Schnee beginnt zu fallen, der Eiffelturm erstrahlt in goldenem Licht, und der Duft von Zimt und Glühwein liegt in der Luft. Die beiden Freundinnen sind nicht ohne Grund in der Stadt der Liebe. Debs hat fest vor, Ava endlich wieder zum Lachen zu bringen, nachdem ihr Freund Leo sie mit einer Arbeitskollegin betrogen hat. Und was ist da besser, als die festliche Stimmung der Pariser Weihnachtsmärkte, Spaziergänge an der Seine im warmen Licht der Straßenlaternen und Pain au Chocolat bis zum Umfallen. Gerade als Ava glaubt, dass man gar keine Männer im Leben braucht, begegnet sie dem geheimnisvollen Fotografen Julien. Sein französischer Akzent, seine haselnussfarbenen Augen – und um Ava ist es geschehen …
Weitere Informationen zu Mandy Baggot
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Mandy Baggot
Winterzauber in Paris
Roman
Aus dem Englischenvon Jule Schulte
Für Paris
Schön. Lebendig. Stark.
Freiheit. Gleichheit. Brüderlichkeit.
KAPITEL EINS
Salon HAARGESTECK, Kensington, London
Leo: Es tut mir leid. Können wir reden?
Mit einem vehementen Wischen nach links verbannte Ava Devlin die Nachricht von ihrem iPhone-Bildschirm. So machte man das mit Lügnern und Schwindlern, die einem, während man noch in ihren Armen lag, das eine ins Ohr flüsterten und das genaue Gegenteil davon taten, wenn man ihnen den Rücken zukehrte. Sie schluckte den bitteren Beigeschmack hinunter. Von Anfang an hatte sie befürchtet, dass Leo – erfolgreich, wohlhabend und ein Schönling – eigentlich eine Nummer zu groß für sie war.
»Chef oder Freund?«
Die Frage kam von Sissy, der Frisörin, die im Augenblick damit beschäftigt war, Avas Kopf mit Folie und einer Paste zu bedecken, die sich anfühlte, als würde sie ihre Kopfhaut auflösen.
»Weder noch«, antwortete sie und legte das Handy wieder vor sich auf den Tisch unter den Spiegel. Sie seufzte. »Nicht mehr.« Sie musste lernen, einfach alles abzuschütteln. Genau wie Taylor Swift.
Mit einem trotzigen Blick in Richtung Spiegel weitete sie ihre grünen Augen, blähte die Nasenlöcher ihrer Stupsnase auf und schürzte die Lippen auf eine Art und Weise, die ihr noch nie so wirklich gestanden hatte. Und mit diesem Gesichtsausdruck – wie ein Z-Promi in einem provokanten Twitter-Selfie – wusste sie, dass sie fertig war. Fertig mit Männern. Mit der Liebe. Mit allem. Aus den Salon-Lautsprechern erklang die butterweiche Stimme von Cliff Richard, die Wein und Mistelzweige besang. Ihre Augen schweiften von ihrem eigenen Spiegelbild zu der Deko aus Lametta und Tannenzapfen, die sich um den Spiegel rankte. Dieser kitschige Weihnachtskram konnte einen in den Wahnsinn treiben: Die ganze Nation war mal wieder besessen von Speisen, die sie in den weiteren elf Monaten einen feuchten Kehricht interessierten – Datteln, Walnüsse, Bretter voll europäischer Käsesorten – und ganze zwei Wochen Festtagsprogramm im Fernsehen, weniger Nachrichten, dafür aber unzählige Gameshows … Und nun musste sie das alles auch noch alleine durchstehen.
»Also«, sagte Sissy, während sie noch mehr klebrige Masse auf Avas Kopf verteilte, »ich fand schon immer, dass Weihnachten eine tolle Zeit ist, um jung, frei und single zu sein.« Sie kicherte, was Avas Aufmerksamkeit wieder zurück auf Sissys Bemühungen um ihre Haare zog. »Die ganzen Partys … Die Leute sind viel lockerer wegen der Feiertage und …«
»Dosenbier?«, schlug Ava vor.
»Trinkst du das etwa?«, rief Sissy, als ob Ava ihr soeben gestanden hätte, sie habe eine Schwäche für Polonium 210. »Ich hatte mal einen Freund, der war allergisch dagegen. Wenn er mehr als vier getrunken hat, wurde ihm immer schlecht.«
»Sissy, das ist keine Allergie, er war betrunken.«
»Mit Pils?«, fragte Sissy. »Verträgt sich das nicht mit Shots?«
Ava war nicht sicher, ob sie lachen oder weinen sollte. Sie schluckte schwer und konzentrierte sich wieder auf den Spiegel. Warum war sie hier und ließ sich diese Strähnchen in die Haare schmieren? Sie hatte den Termin gebucht, als sie noch vorgehabt hatte, zur Firmenfeier zu gehen. Jetzt, wo sie Leo mit Cassandra erwischt hatte, würde sie keine perfekte Frisur zu dem perfekten Kleid mehr brauchen, das Leo ihr gekauft hatte. Sie mochte das Kleid nicht einmal. Es war aus rotem Samt und sah aus wie etwas, das die Assistentin eines Magiers tragen würde. Oder noch schlimmer, ihre Mutter. Aber Leo hatte gesagt, sie würde wunderschön aussehen – sie konnte sich noch genau daran erinnern, wie sie sich dabei gefühlt hatte. Alles Lügen.
»Aufhören«, stieß Ava plötzlich hervor und setzte sich auf.
»Aufhören?«, fragte Sissy. »Womit? Mit dem Reden? Oder mit der Farbe?«
»Mit allem«, sagte Ava. Sie zog an den silbernen Folienstreifen in ihren Haaren.
»Was tust du? Nicht anfassen!«, rief Sissy, als ob eine falsche Bewegung eine Bombe hochgehen lassen könnte.
»Ich will das ab … weg … nicht in meinen Haaren haben!« Ava griff erneut nach einem silbernen Streifen.
»Okay, okay, aber nicht so, sonst rupfst du sie dir noch aus.«
»Ich will einen neuen Look.« Ava schob sich die Haare aus dem Gesicht und hielt sie hoch, um zu sehen, wie sie damit aussehen würde. Nichts würde ihren Kiefer weniger kantig oder ihre Lippen schmaler wirken lassen. Sie seufzte. »Schneid sie ab.« Gern hätte sie dabei stark und entschieden geklungen, doch ihre Stimme brach ein wenig am Ende, und als sie Sissy ansah, entdeckte sie einen Funken von Mitleid in den Augen der Frisörin.
»Aber … zuerst muss ich zu Ende tönen.« Sissy biss sich auf die Lippen.
Ava wollte kein Mitleid. »Okay. Dann tön zu Ende und schneid sie dann ab!«, wiederholte sie.
»Du meinst die Spitzen«, sagte Sissy und schaute Ava im Spiegel an.
Ava schüttelte die noch verbliebenen Silberfoliensträhnen, bis es raschelte. »Nein, Sissy, nicht die Spitzen. Schneid sie ab.« Sie holte tief Luft. »So richtig kurz. Aber mehr David Bowie in seiner Blütezeit und weniger Kelly Osborne.«
»Oh … So kurz.« Sissy verschluckte sich beinahe an den Worten.
»Du hast doch gesagt, Veränderung wäre gut für mich«, antwortete Ava, »verwandle mich.«
Sie lehnte sich wieder zurück, bis sie das Kunstleder des Stuhls an ihrem Rücken spürte. »Mach, dass mich selbst meine eigene Mutter nicht wiedererkennt.« Sie dachte nach. »Besonders meine Mutter.«
Sie schloss die Augen und blendete ihre Umwelt aus – Cliff Richard, das Lametta, die Tannenzapfen, Leo. Ein neuer Look war genau das, was sie jetzt brauchte. Etwas, das zu ihrem neuen Lebensplan passte. Ein Haarschnitt, der sagte: Schau mich ruhig an, aber wenn du mir auch nur eine Wimpernlänge zu nahe kommst und mir was vom Zauber der Weihnacht erzählen willst, wirst du es schwer bereuen. Nichts und niemand würde sie mehr berühren.
Avas Handy piepte, und sie öffnete ein Auge, um auf den Bildschirm zu linsen. Wieso gab Leo nicht einfach auf? Wieso klebte er nicht an Cassandra, wie er es schon wer weiß wie lange getan hatte? Cassandra musste wahrscheinlich nie Clearasil benutzen.
Sissy beugte sich nach vorne und studierte den Handybildschirm. »Da steht, sie ist von Debs.«
Augenblicklich besserer Laune griff Ava nach dem Handy und las die Nachricht.
Ich weiß, ich hab gesagt, du sollst nichts mitbringen, aber ich hab total vergessen, irgendwas Weihnachtliches zu kaufen. Kannst du was besorgen? Irgendwas zu essen… Diese Chips vielleicht, die wie Truthahn mit Füllung schmecken sollen oder wie geröstete Nüsse und Cranberry.
Und bring Rotwein mit, keinen weißen, ich hab heute schon drei Flaschen Weißwein gekauft. Und solltest du total vergessen haben, dass du heute für nette nachbarschaftliche Naschereien vorbeikommen wolltest, bevor ich nach Paris fahre, ist das hier deine Erinnerung.
Debs xx
Debs schrieb ihre Nachrichten, als wären sie ein Aufsatz. Bei Avas bester Freundin gab es keine Abkürzungen, kein OMG, WTF oder LOL. Und Ava hatte vergessen, dass sie verabredet waren. Das war genau das Problem mit Trennungen – sie verdarben einem das Hirn und grillten jene Windungen, die für die wirklich wichtigen Beziehungen im Leben verantwortlich waren. Das würde sich jetzt ändern! Kein Interesse an nichts und niemandem, außer ihrer besten Freundin. Männer konnten sie mal. Ende der Diskussion.
Ava sah zu Sissys Spiegelbild. »Sissy, wenn du sie abgeschnitten hast, möchte ich, dass du sie blondierst«, bekundete sie. »Und nicht so ein Honigblond.« Sie lächelte. »Ich will das Miley-Cyrus-Krisen-Blond.«
KAPITEL ZWEI
Hotel Oiseau Rouge, Viertes Arrondissement, Paris
Julien Fitoussi kniff die Augen zusammen, als sich das grelle Licht der Kronleuchter am Eingang des Ballsaales in seine Netzhaut brannte. Weiße Sterne tanzten hinter seinen Lidern. Er hätte zu Hause bleiben sollen. In seiner kleinen, kompakten Wohnung mit Blick auf die Seine – einem Fluss der sich immer wieder seiner jeweiligen Gemütslage anzupassen schien. Im Sommer kräuselte sich das Wasser voll Liebe und Licht, und jetzt, im Winter, verwandelte es sich seiner Stimmung entsprechend in ein dunkles Tal der Verzweiflung.
Er öffnete die Augen und rückte sein Revers zurecht, entspannte seine Schultern, fuhr sich mit der Hand durch das dunkle Haar und sah sich im Raum um. Wäre er in einer Ausstellung, würde sie »Weihnachtsopulenz« heißen. Alles, was glänzte, war – buchstäblich – gold. Es gab zwei Weihnachtsbäume, nicht grün, sondern golden, überladen mit Lichtern und Schmuck, der auch Busta Rhymes gehören könnte. Am anderen Ende des Saals spielte ein Streichquartett Weihnachtslieder, und die Mitarbeiter der Firma seines Vaters, allesamt benebelt von Gratis-Cocktails, sirrten durch die Gegend wie reiche Arbeiterbienen in ihrem Stock. Lauren hätte es gehasst. Julien schluckte. Er hasste es.
»Ah! Da ist er ja!«
Das war die Stimme seines Vaters, der sich kurz darauf in sein Blickfeld drängte. Julien zwang sich ein Lächeln ab, als Gerard ihm entgegenkam. Die Liebe zu seinem Vater, nicht etwa zu den Menschen, mit denen er arbeitete, oder die kostenlosen Drinks, war der einzige Grund, weshalb er sich an diesem Freitag um sieben Uhr abends aus seinem Bett und in einen Smoking gequält hatte.
Gerard küsste ihn auf beide Wangen und flüsterte in sein Ohr: »Du bist mal wieder zu spät.«
Julien biss die Zähne zusammen, als ihn eine Welle von Emotionen überrollte. Wut mischte sich mit Schuld und wirbelte in ihm herum wie die teuren Getränke in den Gläsern, die die Mitarbeiter seines Vaters fest in den Händen hielten.
Gerard machte einen Schritt zurück, und Julien erblickte Vivienne, seine Stiefmutter in spe, sowie eine füllige Frau mit einer achteckigen Brille und einem Hut, den zahlreiche Obstsorten zierten. Er schenkte den Damen ein Lächeln und ging auf sie zu. »Bonsoir.«
»Bonsoir, Julien«, sagte Vivienne und küsste ihn auf die Wangen. »Das ist Marcie, die Dame, von der ich dir erzählt hatte … Marcie, das ist mein Stiefsohn Julien.«
Julien versuchte, Verständnis vorzutäuschen, auch wenn er nicht den Schimmer einer Idee hatte, wer diese Frau war oder wann seine zukünftige Stiefmutter eine Frau mit einer halben Ananas, einer Guave und zahlreichen Satsumas auf dem Kopf erwähnt hatte.
»Vom Parisian Pathways-Magazin«, zischte sein Vater wie eine wütende Königskobra.
»Ah, natürlich«, sagte Julien, noch immer nicht schlauer. »Es ist mir eine Freude, Sie endlich einmal persönlich kennenzulernen«, log er. Sie war nur ein weiterer Grund, weshalb er den Abend nicht zu Hause unter einer Decke verbringen konnte.
»Ich habe Ihre Arbeit gesehen, Monsieur Fitoussi«, sagte die sprechende Obstauslage.
Vivienne nickte eifrig. Er wusste nicht genau, was er sagen sollte, aber ganz genau, was er gerne sagen würde.
»Ich arbeite zurzeit nicht.«
Das fühlte sich gut an. Und mit einem Blick durch den Ballsaal, wo sich Menschen um einen Champagnerbrunnen und ein Schokoladenfondue drängten, stellte er fest, dass sich die Erde, trotz seiner Worte, nicht aufgehört hatte zu drehen. Es fühlte sich wirklich gut an.
»Was er damit sagen möchte, ist … dass er sich gerade ein wenig Freizeit gönnt und … nach neuer Inspiration und … einer neuen Muse sucht«, versuchte Vivienne zu helfen.
Wäre diese Aussage nicht so wahnsinnig traurig gewesen, hätte er gelacht. Glaubte Vivienne das wirklich? Und sein Vater? Er lächelte in Richtung Marcie und ihrer Obstschale. »Was ich damit sagen möchte« – er nahm sich ein Glas Champagner vom Tablett eines vorbeieilenden Kellners –, »ist, dass ich zurzeit nicht arbeite.«
Marcie schüttelte den Kopf und schob ihre geometrische Brille nach oben. »Ich verstehe«, sagte sie. »Lassen Sie mich sagen, dass unser aller Gedanken bei Ihnen waren.« Sie sah Julien in die Augen.
»Wirklich?«, fragte Julien abrupt.
»Ja, es war ein tragischer Verlust für alle Beteiligten. Wir alle haben ihn gefühlt.«
»Auch wenn er nur einen winzigen Artikel in der Zeitung wert war.«
»Julien …«, begann Vivienne.
»Sie wurden verletzt, nicht wahr? Als Sie zurückgingen, um die anderen zu retten.«
Juliens Wangen wurden heiß. Er wollte fliehen, bevor der Drang, sie an der Gurgel zu packen und sie mitsamt ihres Früchtekorbs in das Fondue zu werfen, zu stark werden würde.
»Danke, Marcie, aber Julien war einer der Glücklichen«, antwortete Gerard.
Julien drehte sich blitzschnell um und sah seinen Vater an. »Glücklich.« Beinahe hätte er das Wort nicht über die Lippen bekommen.
Gerard reagierte nicht, konzentrierte sich einfach weiter auf Marcie, ein stoischer Blick in seinen Augen. »Unsere Familie hat sehr schwere Zeiten durchgemacht.« Gerard nahm ein mit Oliven überfrachtetes Canapé vom Tablett eines vorbeilaufenden Kellners. »Wir haben noch immer mit dem Verlust zu kämpfen.«
Wir haben noch immer mit dem Verlust zu kämpfen. Julien konnte nicht glauben, was er da hörte. Seine Schwester Lauren und fünfundzwanzig andere Menschen waren in einem brennenden Apartment in der Innenstadt eingeschlossen gewesen, zwölf von ihnen hatten es nicht geschafft. Gerade mal ein Jahr war das her. Lauren und die anderen waren nicht einmal in den Schlagzeilen erwähnt worden. Waren sie nichts wert? Diese als Werbung für gesundes Essen verkleidete Frau hatte keine Ahnung, wie düster alles seitdem war. Lauren war tot, sie würde nie wiederkehren. Juliens Leben hatte sich noch nie so leer und sinnlos angefühlt. Und das war der wahre Grund, weshalb er zurzeit nicht arbeitete.
»Ihr Name war Lauren«, sagte Julien und starrte in Richtung seines Vaters, der sich über das Canapé hermachte. »Du erinnerst dich doch an deine Tochter, oder?«
Vivienne sah ihn mitfühlend an. Vielleicht nicht verständnisvoll, aber doch mit Mitgefühl.
»Marcie«, sagte sie und fasste die Dame mit der Fünf-am-Tag-Kampagne auf dem Kopf fest am Arm. »Vielleicht sollten wir uns auf die Suche nach Jean-Paul machen. Er ist der Nachwuchsschauspieler, von dem ich Ihnen erzählt habe. Sehr gefragt! Gerard und ich haben ihn letztes Jahr in einem Stück in London gesehen!«
Julien trat ihnen in den Weg und ignorierte dabei alle Signale seiner zukünftigen Stiefmutter und nervösen Blicke seines Vaters. Er richtete sein Wort an die Dame. »Ich nehme an, Sie wollen, dass ich Fotos mache. Lächelnde, glückliche Menschen? Vielleicht ein paar Prominente? Futter für Ihr Magazin? Unechte Bilder, die allen zeigen, dass in Paris immer alles wundervoll ist?« Er legte die Hände um den Mund und rief in die Menge. »Alles ist gut! Wir haben tolle Cafés und Gerard Depardieu, non?«
Schlagartig packte sein Vater seinen Unterarm und zog ihn aus dem Weg. Vivienne und Marcie machten sich in einer Wolke aus leichtem Zitrusduft und mit schillernden Pailletten schleunigst davon. Als er den starren Blick seines Vaters traf, war nichts als Zorn in Gerards Gesicht zu erkennen.
»Was zur Hölle war das?« Gerard kochte. »Du bist hier, um die Firma zu unterstützen. Vivienne dachte außerdem, es wäre ein guter Moment für dich, um wieder auf die Füße zu kommen und einen neuen Job zu finden.«
»Wieso denkt sie, dass ich das möchte?«, fragte Julien und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Weil du, verdammt noch mal, seit über einem Jahr nicht gearbeitet hast!«
»Und?!« Julien spuckte das Wort in Richtung seines Vaters. Wut und Schmerz schossen durch seinen Körper. Das Atmen fiel ihm schwer, mehr Qual und Kummer in seiner Brust als Luft für seine Lunge. Es schüttelte ihn, und sein Körper zitterte, während Gerard bloß ein Taschentuch aus seiner Brusttasche zog und sich das Gesicht abwischte, als ob Juliens Worte seine Haut verunreinigt hätten.
»Geh nach Hause, Julien. Wenn du dich so benimmst, möchte ich dich hier nicht haben«, sagte er kalt. »Reiß dich zusammen.«
Julien ballte die Hände zu Fäusten, während das Streichquartett begann, »Vive le Vent« zu spielen. Gab es ein Zeitlimit für Trauer? Gab es einen Moment, in dem man aufwachte, vielleicht eines Morgens, und mit einem Mal alles wieder in Ordnung war?
Er konzentrierte sich auf seinen Vater, der gerade einen weiteren Klon im Smoking begrüßte und nach dem nächsten überteuerten, winzigen Canapé griff.
»Monsieur?«, fragte ein Kellner und präsentierte ihm ein Tablett voller Champagnergläser. Julien betrachtete kurz das bereits leere Glas in seiner Hand und dann den perlenden weißen Alkohol in den hohen, schmalen Gläsern auf dem Tablett. Überschäumendes Temperament in jeder Blase, die an der Oberfläche zerbarst. Es glitzerte und glänzte. Genau wie seine Schwester es getan hatte.
Schnell schüttelte er den Kopf in Richtung des Kellners, stellte sein leeres Glas ab und lief zur Tür.
Als er es endlich nach draußen geschafft hatte, begrüßte ihn die eiskalte Winterluft des vierten Arrondissements. Er hielt inne und wartete darauf, dass seine Wut sich legte. Dann schloss er die Augen und atmete tief ein. Das Aroma von Knoblauch, Grillfleisch und Tabak strömte in seine Nase, und er verlor sich in der Geräuschkulisse der Straße – Mopeds, Gelächter, bellende Hunde. Langsam öffnete er die Augen wieder, gewöhnte sich nur langsam an die Dunkelheit. Das einzige Licht ging von den schmiedeeisernen Laternen auf beiden Seiten der Straße aus. Die Brasserie gegenüber – Deschamps – schien berstend voll zu sein. Die Gäste saßen draußen, wie man das in Frankreich machte. Jetzt, im Dezember, sah man keine luftigen Kleider oder kurzen Hosen – die Nachtschwärmer waren in warme Wintermäntel und Schals gewickelt, um dem eiskalten Wind, der baldigen Schnee versprach, zu trotzen, und hielten mit behandschuhten Händen kleine Kaffeetassen oder große Gläser Bier.
Hätte Julien seine Kamera bei sich gehabt und würde er nicht noch immer um seine Schwester trauern, hätte er wahrscheinlich ein Bild von dieser perfekten Pariser Winterszenerie gemacht. Lauren hatte die Cafés und Brasserien ihres Heimatlandes geliebt. Sie hätten sich an einem Freitagabend wie diesem getroffen, nach der Arbeit, riesige Mengen Alkohol getrunken und sich im allerletzten Moment, bevor die Küche schloss, daran erinnert, noch etwas zu essen zu bestellen. Und während sie sich irgendetwas mit Huhn oder einfach eine große Portion Pommes frites und ein bisschen Brot teilten, berichteten sie einander von der letzten Woche. Er musste lächeln. Lauren hatte immer so viel zu erzählen gehabt – Geschichten aus dem Kaufhaus, in dem sie arbeitete. Von einer pingeligen Dame, der sie geholfen hatte, sich für eine Hochzeit einzukleiden, oder einem ungezogenen Kind, dem sie Grimassen geschnitten hatte, wenn die Mutter nicht hinsah. Seine Schwester war das sprühende Leben gewesen und wie ein Wirbelwind durch ihr Leben gefegt. Aber genau wie ein Wirbelwind hatte sie sich schnell und wild gedreht, und dann … war sie weg … und hatte nichts als Erinnerungen und die gebrochenen Herzen ihrer Familie zurückgelassen.
Die Kälte kroch unter seine Smoking-Jacke, und er wartete, bis die Straße frei war, bevor er sie überquerte und mit schnellen Schritten auf die Brasserie zulief. Es gab nur eine einzige Möglichkeit, diese Nacht bis zum nächsten Morgen zu überstehen.
Alkohol.
KAPITEL DREI
Waitrose, Kensington, London
Ava hasste ihre Haare. Sie sah aus wie eine Mischung aus einer Klobürste und Billy Idol. Das hier war nicht Bowie in seiner Blütezeit, es hatte überhaupt nichts mit Blüte zu tun. Es sah aus wie Stroh! Es roch auch genauso, war nur blonder und kürzer. Aber das hatte sie Sissy nicht sagen können. Stattdessen hatte sie die Miene eines Rockstars aufgesetzt und ihrem Spiegelbild trotzig die Stirn geboten. Dann hatte sie eine exorbitant hohe Summe Geld über den Tresen geschoben und war aus dem Salon geflohen, gerade rechtzeitig, um es noch zum Einkaufen zu schaffen, bevor sie bei Debs sein sollte. Leider lag nur ein Waitrose auf dem Weg, einer von Londons nobelsten Supermärkten. Sie konnte nur hoffen, dass, nachdem sie so viel für ihren neuen Haarschnitt hingeblättert hatte, noch genug Geld für Snacks übrig war.
Waitrose schien luxuriöse Weihnachtsknallbonbons am Ende jedes Ganges zu haben – die enthaltenen Überraschungen variierten von Nagelklippern und Golftees bis hin zu Plastikschnurrbärten und Holzpuzzles. Ava hatte Probleme, die Dinge zu finden, die sie brauchte. Die weihnachtlichen Chips waren ganz unten auf ihrer Liste, als Allererstes wollte sie Schokolade – Milchschokolade, am besten die größte Tafel, die es gab – und Rotwein. Und zwar dringlichst welchen mit über dreizehn Umdrehungen.
Sie schlängelte sich um einen Stand mit luxuriösen Weihnachtskuchen und festlichen Desserts. Alles war luxuriös, inklusive der Preise. Sie würde anfangen müssen, mehr aufs Geld zu achten, jetzt, wo sie Leo gesagt hatte, er könne sich zum Teufel scheren und der Job, den er ihr vermittelt hatte, gleich mit. Sie hatte nie viel Spaß daran gehabt, Wohnungen zu verkaufen, auch wenn sie gut darin zu sein schien. Es war eigentlich immer nur eine Zwischenlösung gewesen, und sie hatte ihn nur angenommen, um sich von ihrer Mutter und deren Modelagentur zu distanzieren. Ständig hatte ihre Mutter versucht, ihr das Modeln doch noch schmackhaft zu machen, bis Ava sich ein offenbar apokalyptisches Tattoo zugelegt hatte, das durch kein Make-up mehr abzudecken war. Sie konnte die Stimme ihrer Mutter noch jetzt hören: Dubai, Schätzchen! Eine Nacht im Burj Al Arab. Sie wollten Tina, aber die ist in L. A. Wenn du nur diese tolle Saftkur ausprobieren würdest, die alle Mädels gerade machen, könntest du in zwei Wochen wieder eine Topfigur haben– allerhöchstens in einem Monat.
Und das war das Herzstück ihrer Beziehung. Rhoda Devlin, ehemaliges Model, inzwischen Partnerin in einer Agentur, die auch Ava unter Vertrag hatte, seit sie alt genug war, um zu lächeln, versuchte immer noch, ihr Leben zu bestimmen. Ihre Mutter wollte – buchstäblich – eine Vorzeigetochter aus ihr machen. Sie konnte es kaum erwarten, ihr ihre neuen Haare zu präsentieren. Vielleicht würde sie dann endlich verstehen, dass sie, abgesehen von den kleinen Marketingjobs für die sozialen Netzwerke der Agentur, nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben wollte.
Ihr Handy klingelte, und Ava wühlte hektisch in ihrer schwarzen Lederhandtasche, bis sie es gefunden hatte.
Rhoda Rhinestone.
Es war ein alberner Spitzname für ihre Mutter, und doch musste sie jedes Mal grinsen, wenn er auf ihrem Handy aufleuchtete. Rhinestone – Strass – war einfach zu passend, ihre Mutter hatte sich schon immer für etwas Besonderes gehalten. Ava las die Nachricht, die anscheinend schon vor einer Stunde eingetrudelt war.
Großartige Neuigkeiten, Schätzchen! Tolle Chance für dich an einem Strand auf den Azoren – du müsstest nur vorher entschlacken. Ich hab uns in ein schickes Hotel in Goa eingebucht. Ashtanga und Spa-Behandlungen.
Hab dir die Details schon per E-Mail geschickt …
Prompt traf die E-Mail in ihrem Postfach ein. Die Frau war unfassbar. Ava hatte keine Ahnung, was Ashtanga heißen sollte, und Spa-Behandlungen war doch auch bloß ein Code für Schlammpackungen und Darmspülung. Mit einem weiteren Piepen erschien eine zweite Nachricht auf ihrem Handy.
Leo könnte auch mitkommen. Sonne, Sand und Räuchertofu dürften die Wogen glätten!
Ava biss die Zähne zusammen – die Worte verschwammen vor ihren Augen, als sie begriff, dass sie offensichtlich nicht die Einzige war, die Leo heute kontaktiert hatte. Er hatte mit ihrer Mutter gesprochen, und Ava hätte ihren Hintern darauf verwettet, dass er mit keinem Wort erwähnt hatte, dass er mit der Frau schlief, die die Penthouse-Suiten verkaufte.
»Ich will einfach nur an die Käsekräcker.«
Ava bekam einen Ellenbogen in die Rippen und erblickte einen Mann in grüner Tweedjacke, Gummistiefeln und einer Schiebermütze. Er war mitten in London, sah aber aus, als wäre er soeben dem Cover einer Angelzeitschrift entstiegen – und er hatte sie gerade allen Ernstes aus dem Weg geschubst.
»Geht’s noch?«, keifte Ava zurück. Ihr ganzer Körper prickelte vor Wut über sein Verhalten und die Nachrichten von Rhoda Rhinestone.
»Das Gleiche könnte ich Sie fragen«, antwortete er. »Ich versuche, an die Kräcker zu kommen.«
»Soso«, Ava stemmte die Hände in die Hüften. »Ich bewege mich keinen Zentimeter, solange Sie nicht ein bisschen Benehmen an den Tag legen.«
»Was haben Sie gesagt?«, fragte der Mann und plusterte sich auf.
Ava kniff die Augen zusammen und war sich ihrer inneren Anspannung allzu bewusst – wegen Leo, ihrer Mutter und ihrer fürchterlichen Stroh-Frisur. »Ich sagte, wenn Sie nicht ein bisschen höflicher sind, hole ich die luxuriösen Käsekräcker aus dem Regal und schiebe sie Ihnen in Ihren …«
»Gibt es hier ein Problem, Madam?«
Auf dem Namensschild des jungen, fröhlich lächelnden, von Weihnachtsvorfreude erfüllten Mitarbeiters stand JUSTIN in großen Buchstaben.
»Ja!«, sagte Ava laut. »Ja, es gibt ein Problem! Dieses traurige Exemplar von einem Gentleman hat auf dem Weg zu den Luxus-Käsekräckern seine Manieren vergessen!«
»Diese Dame, auch wenn ich den Begriff sehr vorsichtig verwende, hat mich soeben völlig grundlos verbal angegriffen«, antwortete der grüne Mann.
»Sie!«, sagte Ava und zeigte mit dem Finger auf ihn. »Sie denken, Sie können hier einfach reinstolzieren in Ihrer Landadel-Aufmachung und … und Ihren versnobten Stiefeln … Ich wette … Ich wette, Sie haben vor der Tür einen Land Rover geparkt, den Sie nicht mal brauchen!«
»Wie können Sie es wagen!«
»Wie kann ich was wagen?!«, schimpfte Ava weiter. »Meine Meinung auszusprechen? Ein Bitte oder Danke zu erwarten? Gutes Benehmen ist doch Vorschrift, wenn man hier einkaufen will, oder, Justin?« Sie nickte in Richtung des Verkäufers, wobei sich ihre blonden Stacheln, dank der Menge an Spachtel, die Sissy ihr in die Haare geschmiert hatte, keinen Millimeter bewegten.
»Also, ich …«, stammelte Justin, während sich eine kleine Gruppe von Kunden am Ende des Ganges versammelte, um den Streit zu beobachten.
»Alles, was ich wollte«, schrie der Mann nun, »waren meine Käsekräcker!«
»Bitte«, warf Ava wütend ein.
»Um Himmels willen … bitte«, sagte der Mann mit einem verärgerten Schnauben.
Zufrieden griff Ava nach der Kräckerdose und händigte sie dem Mann aus. Er riss sie ihr so stürmisch aus der Hand, dass Ava beinahe das Gleichgewicht verlor.
»Zu Ihrer Information«, zischte ihr der Mann ins Ohr, »ich fahre einen Nissan Navara, und wenn ich mir Ihre Haare so ansehe, sind Sie wohl eine dieser Kampflesben, die sich wünschen, sie wären ein Mann.«
Ava kochte vor Wut. Sie langte neben sich ins Regal. Das Erste, worum sich ihre Finger schlossen, war eine Jumbopackung Knäckebrot, gefolgt von Keksen und einer durchaus schweren Plastikbox mit Kräckern. Sie warf alles, eins nach dem anderen, in Richtung des Grünrocks, der schimpfte und wütete, aber nichts weiter tun konnte, als seinen Kopf mit den Händen zu schützen, während Ava ihre Attacke fortführte.
Die glutenfreien Laugenstangen waren für Cassandra – wahrscheinlich aß sie die sogar –, die ach so gesunden Grünkohlchips für Leo, weil er diesen vornehmen Quatsch mochte – sie trafen den Mann im Auge –, und der letzte Artikel, als krönender Abschluss, bevor sie die Sicherheitsmänner an den Armen packten, waren Reiswaffeln aus Thailand.
»Das war Körperverletzung!«, brüllte der Mann mit hochroten Wangen. »Ich will, dass sie angeklagt wird! Sie haben es gesehen! Sie alle haben es gesehen!«
Ava versuchte, die Sicherheitsmänner abzuschütteln. »Ach, gehen Sie doch zurück zu Ihrem Nissan Navara und Ihrer Jagd … oder was auch immer Sie in diesem Outfit in London vorhaben!«
»Ava?«
Ava drehte ihren weißblonden Kopf in Richtung der Stimme, die sie nur allzu gut kannte. Sie schloss den Mund und kniff die Augen fest zusammen. Auf einmal wünschte sie sich einen Polizeiwagen. Verhaftet werden wäre immer noch besser, als das hier ihrer Mutter zu erklären.
KAPITEL VIER
Brasserie Deschamps, Viertes Arrondissement, Paris
Julien signalisierte dem Barkeeper, ihm nachzuschenken. Er hatte bereits drei Bier getrunken, und obwohl er inmitten der Freitags-Feierabend-Meute saß, war ihm kein bisschen nach Feiern zumute. Er war da und doch nicht da – eine einsame Insel, nicht erreichbar, unberührt und abgeschnitten vom Rest der Welt.
»Merci«, sagte er, als der Barmann ein weiteres Bier vor ihm abstellte. Er nahm einen Schluck, und der Schaum blieb an seiner Oberlippe hängen. Er drehte sich auf seinem Barhocker um und sah in den Raum. Das fröhliche Gelächter der Nachtschwärmer übertönte die Musik aus den Lautsprechern. Paare hielten Händchen, rauchten, aßen Muscheln, Crêpes und Gougères, eine Gruppe junger Männer in der Ecke spielte Luftgeige, und vier Frauen in kurzen Röcken, Wollstrumpfhosen und Ugg-Boots – die Designerhandtaschen zu ihren Füßen – lachten ausgelassen bei einer Karaffe Rotwein. Von den Fensterrahmen hingen an rot-weiß karierten Bändern Strohsterne, die von oben bis unten mit glitzerndem Kunstschnee besprüht waren. Tannenzapfen an goldenem Klebeband baumelten in Fülle zwischen den Fenstern. Weihnachten war im Anmarsch – ob man es wollte oder nicht.
»Julien!«
Er hörte seinen Namen und drehte sich um. Sein bester Freund kam ihm entgegen, der einzige, den er nicht aus seinem Leben gedrängt hatte – Didier. Julien winkte, denn obwohl er keine Gesellschaft wollte, wusste er, dass es unvermeidbar war.
»Wie geht es dir, mein Freund?«, begrüßte ihn Didier über das Stimmengewirr hinweg, küsste ihn auf beide Wangen und klopfte ihm auf die Schulter.
»Gut«, log er und lächelte. »Sehr gut.«
Didier taxierte ihn, seine schokobraunen Augen stachen aus der mokkafarbenen Haut hervor, als er Juliens Aussage zu analysieren schien. Er stemmte die Hände in die Hüften. »Und wieso bist du dann alleine hier?«
Da erkannte Julien seinen Fehler. Didier hatte eine Nachricht – nein, eine Vielzahl an Nachrichten – auf seiner Mailbox hinterlassen und ihn gefragt, ob sie heute Abend zusammen ausgehen wollten. Er hatte sie ignoriert.
»Ich hatte … eine Sache. Eine Geschäftssache mit meinem Vater«, sagte er und zeigte auf den Smoking, als würde seine Aufmachung alles erklären.
Didier zog sich einen Hocker heran und setzte sich. »Du hättest anrufen und mir Bescheid sagen können.«
Julien atmete geräuschvoll aus. »Ich wollte eigentlich gar nicht hin. Ich war auch nicht richtig da … nicht wirklich.«
»Ihr habt euch wieder gestritten«, sagte Didier und winkte den Barkeeper heran.
»Nein«, antwortete Julien und schüttelte den Kopf.
»Wieso versuchst du immer, mich anzulügen, Julien. Sind wir keine Freunde?«
»Doch, natürlich«, sagte er schnell. »Okay, vielleicht gab es eine Diskussion … aber keinen Streit.« Wie sollte er erklären, dass er seinen Vater, seine Stiefmutter und eine Frau, die einen Obstkorb als Couture trug, angeschrien hatte?
»Du hättest lieber mit mir ausgehen sollen«, sagte Didier und zog eine Schachtel Zigaretten aus der Jackentasche. Er holte mit den Zähnen eine heraus und zündete sie an.
Julien hatte keine Antwort darauf. Er hob schnell sein Glas und nahm einen tiefen Schluck.
»Also, wollen wir ausgehen?«, fragte Didier wieder.
»Tun wir doch schon«, antwortete Julien.
»Nicht hier«, sagte Didier und blies Rauch in Juliens Gesicht. »In einen Club. Tanzen. Mehr Drinks, bis die Sonne aufgeht.«
Ausgelassenheit sprühte aus all seinen Poren. Didier war immer so gewesen, schon seit sie zusammen studiert hatten. Er war klug, sowohl intellektuell als auch kreativ, lebte in den Tag hinein und fällte Entscheidungen nach seinem Bauchgefühl.
Julien schüttelte den Kopf. »Heute nicht. Ich bin müde.«
Didier sah ihn schon wieder ungläubig an.
»Müde?«, fragte er, »weil du den ganzen Tag geschlafen hast?«
»Was?«, er hatte nicht den ganzen Tag geschlafen. Er hatte ein paar Wiederholungen von St. Tropez geschaut und von seinem Fenster aus zugesehen, wie die Gendarmerie einen singenden Papa Noël verhaftete.
»Du kannst mir nichts vormachen, Julien«, sagte Didier und runzelte die Stirn. »Wann hattest du das letzte Mal deine Kamera in der Hand?«
Was hatten denn alle auf einmal? Er hatte Jahre mit einer Kamera um den Hals verbracht, für seine Kunst gelebt, nicht ein einziges Mal hatte jemand gesagt: Julien, wann hast du das letzte Mal deine Kamera weggelegt?
»Worauf willst du hinaus, Didier?«, schoss er zurück. »Lässt du mich mit dem Tanzen in Ruhe, wenn ich dir antworte?«
»Lauren würde das alles hier nicht wollen«, sagte Didier.
Julien seufzte, sein Atem mischte sich mit dem Rauch und dem Duft der Crème brûlée, die in der Luft hingen. »Wenigstens traust du dich, ihren Namen auszusprechen.«
»Was meinst du?«, fragte Didier und legte seine Zigarette in dem Aschenbecher auf der Bar ab.
Julien schüttelte den Kopf. »Mein Vater tut … er tut so, als hätte sie nie existiert.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen«, sagte Didier bestimmt. »Ich habe ihn gesehen … bei der Beerdigung … er konnte kaum aufrecht stehen.« Er aschte ab, bevor er wieder an seiner Zigarette zog. »So benimmt sich kein Mann, dem das alles egal ist.«
Er hatte recht. Sein Vater hatte es nicht leicht gehabt auf der Trauerfeier. Gerard hatte eine Rede halten und den versammelten Gästen erzählen sollen, was für ein erfülltes Leben Lauren in ihren fünfundzwanzig Jahren geführt hatte. Stattdessen hatte er sich an Vivienne geklammert, sein von Trauer verzerrtes Gesicht in ihrer Schulter vergraben, und es dem Pfarrer überlassen, seine Worte vorzulesen.
»Er hat es hinter sich gelassen«, sagte Julien geistesabwesend.
Didier lächelte, sodass ein wenig Rauch durch seine vollen Lippen quoll. »So funktioniert unsere Welt, Julien. Wir müssen die Dinge hinter uns lassen.« Er drückte seine Zigarette aus. »Ich weiß, Lauren würde dich nicht so sehen wollen. Wie du alles aufgibst«, sagte er weiter. »Deine Fotografie aufgibst.« Er stupste Julien an. »Sie hat deine Bilder geliebt«, sagte er. »Und sie hat sie definitiv besser verstanden als ich.«
Julien musste lächeln. Didier mochte die einfachen Dinge – den Eiffelturm bei Nacht, den Place de la Concorde, Boote auf der Seine. Sein Freund hatte schon immer Probleme gehabt, seine künstlerischeren Schnappschüsse zu verstehen – Blumen in den Händen eines kleinen Mädchens, das zu seinem Großvater aufschaut, zwei aneinandergelehnte Fahrräder vor dem Louvre. Diese Art von Bildern war der Fokus seiner letzten Ausstellung gewesen. Er war von Presse und Kritikern zugleich gelobt worden, hatte mehr Drucke als je zuvor verkauft und eine Fülle an Aufträgen bekommen. Das alles fühlte sich nun so unendlich weit weg an.
Julien sah sich um. Lächelnde Gesichter, angeregte Unterhaltungen, der Klang eines Akkordeons drang von draußen ins Lokal. Sein Magen zog sich zusammen, als eine Kellnerin zwei Teller Croque Monsieur aus der Küche trug. Beinahe hätte er Lust gehabt auf den weichen, geschmolzenen Käse und den geräucherten Schinken. Wann hatte er zuletzt Hunger gehabt?
»Du solltest mehr Fotos machen«, sagte Didier und nippte an seinem Bier. »Sie wieder ausstellen.«
Julien atmete aus. »So einfach ist das nicht. Ich kann nicht einfach losgehen und Fotos machen, eine Galerie buchen und hoffen, dass jemand aufkreuzt.« Er seufzte. »Sowas braucht Planung … und Inspiration.«
Das war es, woran es ihm am meisten fehlte. Inspiration. Motivation für seine Arbeit und so ziemlich jeden anderen Aspekt seines Lebens.
»Du könntest Fotos von mir machen«, sagte Didier, riss die Augen auf und präsentierte, was er wohl für eine Modelpose hielt.
»Du willst meine neue Muse sein?«, fragte Julien.
»Wieso nicht!«, sagte Didier durch einen Schmollmund, die Hände auf den Hüften. »Meine Mutter sagt, ich sehe aus wie Sébastien Foucan, und der war mal in einem James-Bond-Film!«
Julien schüttelte den Kopf und versuchte, nicht zu lachen.
»Bin ich etwa nicht gut genug für deine Kamera«, fragte Didier. Er klang verletzt.
»Du würdest dich langweilen und die Konzentration verlieren, sobald ein hübsches Mädchen vorbeiläuft oder du noch einen Grand Crème brauchst.«
»Dann üb an mir!«, schlug Didier vor. »Wir könnten morgen losgehen! Ich könnte mich nackt auf die Stufen der Sacré-Cœur legen. Mit einem Kätzchen im Arm.«
»Mach das, und du endest im Knast«, antwortete Julien.
»Dann halt kein Kätzchen«, lenkte Didier ein. »Aber morgen. Lass uns losgehen und Bilder machen, ich spendiere dir so viel Kaffee, wie du willst.«
Julien seufzte. »Ich kann nicht.«
»Julien …«
»Es tut mir leid, Didier.« Er schluckte. »Ich bin einfach noch nicht bereit.«
KAPITEL FÜNF
Kensington, London
»Was hast du dir nur dabei gedacht?« Rhoda atmete schwer. »Stell dir vor, einer der Sicherheitsmänner will ein bisschen Geld nebenbei machen, und schon sind du und dein Kräcker-Ausraster ein viraler Internet-Hit. Das kann die Firma nun wirklich nicht gebrauchen.«
Am liebsten hätte Ava gesagt, dass sie niemand als Rhoda Devlins Tochter wiedererkannt hätte und sich höchstwahrscheinlich auch niemand dafür interessieren würde. Aber sie wusste, dass nichts zu sagen um einiges sicherer war. Sie kniff die Lippen zusammen und biss sich so fest auf die Zähne, als wolle sie Werbung für Haftcreme machen. Kein Wort hatte sie gesagt, seit Rhoda mit überschwänglichen Entschuldigungen und einer Fünfzig-Pfund-Note (Mal ganz im Ernst, wer trug heutzutage noch so viel Bargeld mit sich herum?) zu ihrer Rettung geeilt war und sie anschließend in den Audi gescheucht hatte. Absolute Stille war eine Taktik, mit der sie seit dem Armageddon-Tattoo recht gut fuhr.
»Und außerdem brauche ich dringend den Namen von dem Haarsalon, der dir das angetan hat, damit wir rechtliche Schritte einleiten können.«
Ava biss sich inzwischen heftig auf die Zähne, der Schmelz begann schon wehzutun. Wieso war ihre Mutter ausgerechnet in diesem Waitrose gewesen? Was fiel Leo überhaupt ein, Rhoda zu schreiben? Und wieso konnten sie nicht einfach alle in Frieden lassen?
»Ava, hörst du mir überhaupt zu?«
Mit einem kurzen Blick in den Rückspiegel sah Ava, dass ihre Mutter sie musterte. Erst jetzt fiel ihr auf, dass Rhoda sie auf den Rücksitz gedrängt hatte. Nicht wie einen Promi. Wie ein Kind.
Sie hörte ihre Mutter atmen, als wäre sie mitten in einer Reiki-Stunde. Ihr Vater hatte die Abdominal-Atmung in den Scheidungspapieren aufgelistet, und sogar damals hatte Ava verstanden, wieso man das als unüberbrückbare Differenz werten könnte.
»Keine Sorge, wir kriegen das schon wieder hin. Ich kenne da jemanden, der solche entsetzlichen Haar-Katastrophen retten kann. Glaub mir, da gehen alle Topmodels hin.«
Es war an der Zeit, etwas zu sagen. »Ich bin kein Topmodel, Mum, war ich auch noch nie.«
»Nein, könntest du aber sein, wenn du dich nur an all die Dinge halten würdest, die ich dir bereits seit Jahren rate.« Rhoda seufzte. »Ich weiß, dass du dich nicht an den Diätplan hältst, den ich für dich geschrieben habe.«
Ava schloss die Augen. Neben braunem Reis sah Magersucht beinahe erstrebenswert aus, und sie war sich ziemlich sicher, dass man mit einer Grapefruit auch Kalkablagerungen aus der Toilette schrubben könnte.
»Ava, hörst du mir zu?«, fragte Rhoda bissig.
Sie nickte.
»Wir schaffen das schon. Wir bringen dich zurück auf Kurs, okay?«, sagte Rhoda vermeintlich ermutigend.
Sie musste einfach nur ruhig bleiben. Vielleicht ein paar angemessene, vage Antworten murmeln.
»Der Job auf den Azoren könnte dein großer Durchbruch werden«, redete Rhoda einfach weiter. »Aber dafür müssen wir dich erst einmal in Form bringen.«
Natürlich. Weil sie noch nie gut genug gewesen war. Ihre Ohren waren zu groß und ihre Brüste zu schlaff. Wenn sie vor einem Fotoshooting frühstückte, sah sie aufgebläht aus … Die Liste war endlos. Und genau deshalb hatte sie angefangen, sich Unfälle und Verletzungen auszudenken und dem öffentlichen Nahverkehr die Schuld in die Schuhe zu schieben, wenn sie mal wieder einen Termin versäumte. Als sie noch in der Schule war, hatte das die meiste Zeit auch funktioniert. Es kamen immer weniger Aufträge, auch wenn ihre Mutter nach wie vor ihr Portfolio an Gott und die Welt schickte. Und irgendwann, nachdem sie angefangen hatte, Rhodas Diätpläne zu zerreißen und ihr Maniküre-Geld lieber für Essen auszugeben, kamen gar keine mehr. Ava war zurzeit einfach nur das Twitter-Mädchen. Aber auch vier Jahre nach ihrem letzten Katalog-Shooting schien Rhoda nicht aufgeben zu wollen.
»Du kannst mich einfach hier rauswerfen«, sagte Ava und schaute aus dem Fenster. Sie hatte keine Ahnung, wo sie waren.
»Was? Red keinen Blödsinn, Ava. Ich fahre dich nach Hause.« Rhodas Augen erschienen wieder im Rückspiegel. »Wir müssen uns für Indien und die Azoren fertigmachen.«
»Mum …«
»Ich hab diese tollen kleinen Pillen, die den Appetit zügeln.«
Ava fing an, am Türgriff zu rütteln. Es war ihr völlig egal, dass sie gerade durch die weihnachtlich dekorierten Straßen Londons fuhren. Sie wollte raus, auch wenn das bedeutete, dass sie sich unter bunten Lichterketten und beleuchteten Engeln mitten auf den Asphalt werfen müsste. Nichts passierte. »Hast du die Kindersicherung aktiviert?«
»Herrgott noch mal, Ava!«, platzte es aus Rhoda heraus, während sie den Audi links ranfuhr.
Ava gab nicht auf und riss verzweifelt am Griff herum.
»Beruhig dich«, befahl Rhoda, schaltete den Wagen ab und drehte sich in ihrem Sitz um. »So kriegst du nur Stressflecken und Falten auf der Stirn.«
»Ist mir egal!«, jammerte Ava. »Wieso sollte mich das interessieren?«
Sie wollte raus aus dem Auto. Die Luft wurde immer dünner, als ob sie 10 000 Meter über der Erde in einer Boeing säße und jemand das Fenster offengelassen hätte. Sie drückte noch einmal gegen die Tür.
»Genau wie dein Vater«, seufzte Rhoda.
Ava schloss die Augen. Nicht das schon wieder. Im Zweifelsfall konnte man ja immer dem Mann die Schuld zuschieben, der klug genug gewesen war zu verschwinden. Sie schluckte. Das hier war grausam. Die Trennung ihrer Eltern war nicht alleine Rhodas Schuld gewesen. Ihr Vater hatte nicht versucht, mit ihrer Mutter zu reden und die Ehe zu retten, nur seine Tasche gepackt und sich aus dem Staub gemacht. Rhoda war gut darin, Menschen zu erschöpfen. Aber weit weg von all dem Stress war ihr Vater fleck- und faltenfrei. Er lächelte mehr und ging alle zwei Wochen ins Stadion, um Tottenham spielen zu sehen. Er hatte eine Freundin namens Myleene, und sie verbrachten die Sommermonate auf den Philippinen. Sie ahnte, dass jegliches schwere Atmen seitens Myleene mit tantrischen Ritualen verbunden war, über die sie, in Verbindung mit ihrem Vater, lieber nicht intensiver nachdenken wollte.
Nachdem ihre Wut ein wenig abgeebbt war, seufzte Ava. »Kannst du mich zu Debs fahren?«
»Wieso?«
»Weil wir verabredet sind. Ich war auf dem Weg zu ihr, als der Mann in Tweed aufgetaucht ist und rumgepöbelt hat und ich die Kräcker geworfen hab und … du aufgetaucht bist.«
»Ich mag das Mädchen nicht«, sagte Rhoda, rümpfte die Nase und klappte die Sonnenblende herunter, um sich im Spiegel betrachten zu können.
»Wieso nicht?«, fragte Ava.
»Sie ist so …«, begann Rhoda. »So …«
Ava wartete, und doch wusste sie schon ziemlich genau, welche Art von Vorurteil aus dem Mund ihrer Mutter kommen würde.
»Gewöhnlich«, sagte Rhoda.
Die Haare in Avas Nacken stellten sich auf, sie musste ihre beste Freundin verteidigen. Sie öffnete ihren Mund, um ihrer Mutter zu erklären, dass an gewöhnlich nichts auszusetzen war, dass gewöhnlich sicher und wohlig und tröstlich bedeutete. Doch dann realisierte sie ein für alle Mal, was sie schon seit Jahren gewusst hatte, und schloss ihn wieder. Ihre Mutter empfand gewöhnlich als Todsünde. Wieso sollte man sich mit gewöhnlich zufriedengeben, wenn man sein Leben doch mit streng riechenden Tränken aus dem Reformhaus und Hähnchenbrustfilets im BH aufbessern konnte.
»Ich weiß, was du vorhattest, Ava«, sagte Rhoda plötzlich. »Und ich möchte, dass du weißt, dass es in Ordnung ist.«
Meinte sie das ernst? Ein Hauch von Hoffnung stieg in Ava auf.
»Du wolltest eine coole Kurzhaarfrisur – wie Natalie Portman.«
Der kurze Anflug von Hoffnung endete in einem katastrophalen Absturz irgendwo in ihrer Magengrube.
»Aber die Sache ist die, Ava, dafür hast du einfach nicht die richtigen Wangenknochen. Und ich glaube, das weißt du auch. Also war das hier einfach nur ein Schrei nach Hilfe.«
Instinktiv griff Ava dorthin, wo einmal ihre rotblonden, schulterlangen Haare gewesen waren. Gute fünfundzwanzig Zentimeter weiter oben fand sie die platinblonden Stacheln. »Das ist kein Hilfeschrei.«
Rhoda atmete aus. »Aber du hast Leo verloren.«
Ava runzelte die Stirn. Sie wusste genau, was ihre Mutter damit sagen wollte. Sie hatte Leo verloren. Nicht Leo sie. Und Leo war kein süßer Welpe, der vom Weg abgekommen war und sich in den Vororten Londons verlaufen hatte. Leo war ein verlogenes Arschloch, das sie betrogen hatte. Und das über Monate. Sie war ohne ihn eindeutig besser dran. Auch wenn das bedeutete, dass sie Weihnachten allein verbringen würde … Vielleicht für den Rest ihres Lebens.
Sie konnte nicht länger in diesem Auto sitzen und die über Jahre aufgestaute Frustration ihrer Mutter über sich ergehen lassen. Und alles nur, weil sie nicht die nächste Cindy Crawford geworden war. Mit einem Satz nach vorne kletterte sie über den Schaltknüppel und auf den Beifahrersitz.
»Was machst du da?!«, schrie ihre Mutter entsetzt. »Du zerkratzt die Ledersitze.«
Der Satz sagte doch eigentlich alles. Ava öffnete die Tür und krabbelte aus dem Wagen. Der eiskalte Wind stach wie eintausend kleine Nadeln auf ihrer frisch geschorenen Kopfhaut. Sie würde mit der U-Bahn fahren oder sich ein Taxi nehmen. Ganz egal, Hauptsache, keine weitere Minute in diesem Auto sitzen.
»Ava, steig sofort wieder ein«, rief ihre Mutter und lehnte sich so weit vor, wie es ihr der Sicherheitsgurt erlaubte.
»Nein«, antwortete sie.
»Wir fliegen nach Goa. Da gibt es nichts außer Meditieren und Mungobohnen. Deine Seele wird genauso gereinigt sein wie deine Haut, versprochen!«
Ava wollte keine gereinigte Seele. Das Einzige, was sie von sich abschrubben wollte, war das ständige Gefühl, nicht gut genug zu sein.
Nur hatte sie ihrer Mutter noch nie etwas ausschlagen können, sondern immer versucht, einen anderen Weg zu finden, um ihr aus dem Weg zu gehen. Einen verstauchten Knöchel oder eine Überdosis Chips, sodass die Kleider nicht mehr passten. Und auch dieses Mal war es nicht anders.
Zähneklappernd zog Ava ihren Mantel vor der Brust zusammen. Die Kälte kroch ihr unter die Kleider. »Ich rufe dich morgen an«, sagte sie so ruhig wie möglich.
»Wann?«
Ava schluckte und krallte sich an der Tür des Audi fest, während ihre Mutter sie, aus von falschen Wimpern umrahmten Augen, erwartungsvoll anblickte.
»Um elf«, antwortete Ava. »Wiedersehen, Mum.«
Ohne auf eine Antwort zu warten, warf sie die Tür zu und ließ ihre Mutter, deren Mund sich unentwegt öffnete und schloss, und ihre roségoldenen Ohrringe, die sie unweigerlich an Grace Jones in den Achtzigern erinnerten, hinter sich. Dann setzte sie eine entschlossene Miene auf und machte sich auf in Richtung der glitzernden Plastikschneeflocken, die von der Eisenbahnbrücke baumelten.
Am Freitagabend ein Taxi zu erwischen konnte man eigentlich vergessen, und auch nach endlosem Kramen hatte Ava keine Monatskarte in ihrer Tasche finden können. Als sie also, nach einer Wanderung von einer Seite des Stadtteils zur anderen, an Debs’ Tür auftauchte, war ihr so kalt wie noch nie in ihrem Leben.
Sie klopfte – ihre Hände schon rot und geschwollen von der kalten Luft –, und nach einem kurzen Moment flog die Tür auf. Debs trug einen Weihnachtspullover und einen Rock mit funkelnden Lichtern. Auf dem Pullover prangten zwei Rentiere mit Schlittschuhen, die aussahen, als würden sie eine recht aufwendige Choreographie zum Besten geben. Die Lichter am Rock wechselten laufend die Farbe, und für einen kurzen Moment wurde Ava geblendet.
»Ava!«, rief Debs, als wäre Ava der Weihnachtsmann höchstpersönlich. »Herrje, du hättest dir nicht solche Mühe machen müssen! Soll die Perücke für Cruella De Vil oder Elsa aus Die Eiskönigin sein?«
Bevor Ava irgendetwas antworten konnte, hatte Debs schon einen großen Schritt nach vorne gemacht und sie für eine feste Umarmung zu sich gezogen. Ihre großen Plastik-Zuckerstangen-Ohrringe stachen Ava beinahe ein Auge aus. Sie schloss sie und genoss den Geruch von LUSH-Produkten und billigem Prosecco, während Debs sie an sich drückte.
»Es ist keine Perücke«, flüsterte sie.
Debs ließ sie los, trat einen Schritt zurück und starrte ihre Freundin fassungslos an, ihre Augen schienen nach dem Ansatz eines Haarnetzes zu suchen.
»Nicht?«, fragte sie misstrauisch
Ava schüttelte, was von ihrem Haar übrig geblieben war. »Leo hat mich wirklich betrogen«, begann sie, »mit dem Mädchen, von dem ich dir erzählt habe.« Sie schniefte. »Die mit den großen Brüsten, die aussieht, als wäre sie direkt aus dem Fernseher gesprungen. Und …«, sie sah Debs an, »ich war im Supermarkt, um Rotwein und weihnachtliche Chips zu kaufen, und dann hab ich Sachen nach einem sehr unfreundlichen Mann geworfen, und dann kamen die Sicherheitsmänner und meine Mutter und …« Mit jedem Wort wurde es schwerer zu atmen, während sich all die Dramen der letzten Tage zu einem einzigen riesigen Kloß in ihrem Hals zusammentaten. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, während aus dem Haus Greg Lakes »I Believe in Father Christmas« tönte. »Meine Mutter will mit mir nach Goa und dann auf die Azoren«, redete sie weiter. »Aber erst nachdem sie mich mit Linsen vollgestopft, mit Clinique zugeschmiert und einer Haartransplantation unterzogen hat.«
»Kein Wort mehr«, sagte Debs und umhüllte Ava in der Art Umarmung, die ihr schon so oft durch harte Zeiten geholfen hatte – ob zu Hause, in der Schule oder wann immer die reiche Rotzgöre Nicola aus dem Jahrgang über ihnen sie wieder einmal beleidigt hatte. »Ich weiß, was zu tun ist.«
Ava schloss die Augen und genoss den Moment, bevor sie Debs losließ. »Cider trinken, bis er uns aus den Ohren wieder rauskommt?« Schnell wischte sie sich die immer noch munter fließenden Tränen vom Gesicht, bevor sie festfroren.
»Ganz genau!«, antwortete Debs enthusiastisch. »Warte ab, bis du den hausgemachten Zwetschgenwein probiert hast, den Ethel mitgebracht hat. Sie sagt, sie hat ihn 1988 gemacht, und ich glaube ihr total aufs Wort.«
Ava lachte. »Vielleicht bringt er meine Haare zum Wachsen!«
»Ich mag deine Haare«, sagte Debs und legte einen Arm um Ava, bevor sie sich Richtung Haus drehte. »Der Schnitt ist so … europäisch!«
»Ach ja?«
»Ja! Und das ist prima, er wird super zu Paris passen«, antwortete Debs. »Du kommst jetzt erst mal rein, sagst allen Hallo und fängst an, deine inneren Organe zu marinieren.« Sie lächelte. »Und dann buchen wir dir im Internet ein Ticket für meinen Eurostar. Was du brauchst, ist Veränderung. Frankreich, um genau zu sein.« Debs fuchtelte mit den Händen, als versuchte sie, eine Landschaft in die Luft zu malen. »Französische Luft, französisches Essen … französische Männer.«
»Brauchst du jemanden, der dir bei deinem Artikel hilft?«, riet Ava.
Debs’ Lächeln wurde unsicher. »Ist das so offensichtlich?«, fragte sie mit einem Seufzen.
»Ein wenig.«
»Ich wollte dich ohnehin fragen. Schon vor …«, Debs hielt inne, »… der vollbusigen Fernsehfrau und dem weltgewandten Haarschnitt.«
Ava lächelte ihre Freundin an. »Wenn das so ist … hast du noch Dosenbier?«
KAPITEL SECHS
Rue de Rivoli, Viertes Arrondissement, Paris
Julien stand vor dem Tour Saint-Jacques, um ihn herum fiel Schnee. Seit Monaten war er nicht mehr so früh aus dem Haus gekommen. Nicht nur, dass es noch hell war, es war noch nicht einmal Mittag, und das Stadtleben war in vollem Gange. Busse und Autos glitten über eine dünne Schicht Schnee, die sich auf die Straßen gelegt hatte, während Scheibenwischer unermüdlich Schneeflocken von den Windschutzscheiben fegten.
Die letzten Tage waren ohne nennenswerte Ereignisse vergangen. Didier hatte angerufen. Er war nicht rangegangen. Stattdessen hatte er vom Fenster aus die Menschen auf den Straßen beobachtet, aus Dosen gegessen, wenn sein Magen zu sehr protestierte, zu viel getrunken, wenn die Erinnerungen drohten, ihn zu übermannen. Aber jetzt war er hier, Kamera um den Hals, vor einem Denkmal, das er schon immer bewundert hatte. Letzte Nacht hatte er es auf einem Foto gesehen, welches er am Boden einer Box mit Laurens Dingen gefunden hatte. Versteckt unter ihrer roten Lieblingsmütze und einer abgegriffenen Ausgabe eines Jackie-Collins-Romans. Der Anblick seiner strahlenden Schwester auf dem Foto war wie ein Schlag in die Magengrube gewesen. Er hatte sie angestarrt, bis ihm die Augen wehtaten, und gehofft, dass sie, wenn er nur lange genug hinsah, ein winziges Stück näher kommen würde.
Er legte den Kopf auf die Seite und schaute am Gebäude hoch. Es war wunderschön. Ein cremeweißer Schutzengel über den Straßen, die auffällige gotische Architektur so repräsentativ für das Leben in Paris. Der Turm war reich verziert. Neben Skulpturen von Heiligen und den vier Evangelisten – Löwe, Stier, Adler und Mensch – an jeder Ecke schnitten gruselig aussehende Wasserspeier Grimassen. Julien hob seine Kamera ans Auge und drückte auf den Auslöser.
Sein Magen zog sich zusammen, als es leise klickte. Es war das erste Mal seit langem, dass er dieses Geräusch gehört hatte – dabei war es einst so präsent in seinem Leben gewesen wie Atmen. Er senkte die Kamera und sah sich um. Die Stadt hörte nie auf, sich zu bewegen. Unverwüstlich, mutig, voller Leben. Er schaute einer Gruppe Schulkinder hinterher, die, angeführt von ihrer Lehrerin, über den Bürgersteig liefen. Ihr Atem tanzte in der Luft, während sie mit geröteten Wangen aufgeregt plapperten. Unerschrocken und unberührt von der sich ständig verändernden Welt um sie herum.
Könnte das ein gutes Motiv für ihn sein? Kontraste? Die Nacht im Gegensatz zum Tag? Licht und Dunkel? Die alte Extravaganz des Tour Saint-Jacques verglichen mit dem modernen Centre Pompidou, nur ein paar Straßen weiter? Er war nicht sicher, was er vom Pompidou, mit seinen stählernen Stützen und den Luftkanälen, halten sollte. Ja, vielleicht störten diese Dinge im Museum – aber sie nach draußen zu verfrachten … War es schön in seiner Andersartigkeit oder schlichtweg hässlich?
Schönheit. Das wäre ein gutes Motiv. Sie bedeutete verschiedene Dinge für verschiedene Menschen. Der Blick eines einzelnen Mannes, beeinflusst durch seinen Blick und sein Herz. Es war definitiv eine bessere Idee als ein nackter Didier mit einem Kätzchen. Er lächelte, als er sich vorstellte, wie sein Freund völlig sorgenfrei und unbekleidet über die Stufen einer französischen Kirche hüpfte. Und mit einem Mal überkam es ihn. Ein Gefühl, das sich in ihm ausbreitete und jeden Zentimeter seines Körpers erfüllte – unkontrollierbares Gelächter. Ein Strahl der Wintersonne erfasste sein Gesicht, und mit einem Mal war es, als würde er wieder erwachen. Er war hier. Er lebte. Er breitete die Arme aus in Richtung Himmel und ließ die Schneeflocken auf sein Gesicht fallen. Glück. Natur. Leben. Es war alles noch da. Die kleinen Dinge. Die Schönheit des Alltags. Er hatte sein Motiv gefunden.
KAPITEL SIEBEN
Debs’ Haus, London
»Also Mädchen, seid ihr sicher, dass ihr alles habt?«
Debs Mum Sue hatte die Frage gestellt, und Ava antwortete, indem sie ihren Reisepass hochhielt. Sue war vorbeigekommen, um den beiden Snacks für die Fahrt zu bringen – Sandwiches, Kekse und Käsestangen. Außerdem sollte sie Debs’ Fische füttern, während sie weg waren.
Sue lachte und schüttelte den Kopf, was ihre blonden Locken zum Tanzen brachte. »Klamotten, Ava? Irgendetwas, um dich warm zu halten?«
»Durch Zufall weiß ich, dass deine Tochter eine große Auswahl an Pullovern hat, an der ich mich bedienen werde, sollte mir kalt sein. Abgesehen davon kann ich einfach noch nicht nach Hause.«
Seit zwei Tagen ging sie den Anrufen ihrer Mutter aus dem Weg und schlich sich nur nachts aus dem Haus, um zu vermeiden, von Rhoda gekidnappt und in den nächsten Flieger nach Indien verfrachtet zu werden.
»Willst du deine Mutter nicht doch lieber anrufen, Ava? Sie macht sich bestimmt Sorgen um dich«, sagte Sue vorsichtig.
Ava sah Sue an. Ihr Haar wurde nur mit einem Clip aus dem Gesicht gehalten, und ihr Make-up war natürlich und mindestens drei Nuancen weniger orange als Rhodas. Sie trug einen Bleistiftrock und eine bunte Bluse. Modern, geschmackvoll, keine Markenkleidung, und ein liebevolles, ungekünsteltes Lächeln auf den Lippen. Debs’ Mutter hatte Ava gewissermaßen adoptiert und ihr seit der Oberstufe, wann immer sie es wollte, ein behagliches Zuhause geboten und sie mit echter Nahrung versorgt. In ihrem Haus gab es kein Kalorienzählen, nur eine immer volle Keksdose und Pizza am Samstagabend. Es gab auch keine Erwartungen an sie, sondern stattdessen ein herzliches Willkommen, ein gemütliches altes Sofa und ein offenes Ohr, wenn sie eins brauchte.
»Ich könnte sie vom Bahnhof aus anrufen«, schlug Ava vor. Sie hatte nicht vor, das wirklich zu tun, aber sie wollte nicht, dass Sue sich verantwortlich fühlte. Doch dafür musste sie ihr erst einmal glauben.
»Versprich es mir, Ava«, sagte Sue und schaute sie misstrauisch an.
Was sollte sie sagen? Sie konnte kein Versprechen abgeben.
»Ich kann sie nicht anrufen«, gab Ava schließlich zu. »Wenn ich sie anrufe, wird sie mich zwingen, nach Indien zu fliegen.«
»Ich bin sicher, das ist nicht …«, begann Sue.
Debs kam in die Küche. Sie trug einen riesigen Rucksack auf dem Rücken und schob einen kleinen Rollkoffer vor sich her. »Sie hat total recht, Mum. So ist es am besten. Ava muss verschwinden.«
»Verschwinden ist vielleicht ein bisschen extrem«, meldete Ava an.
»Soll ich sie anrufen?«, schlug Sue vor. »Vielleicht, wenn ihr im Tunnel seid. Schon unter Wasser …«
»Nein!«, riefen Ava und Debs gemeinsam.
Sue schien ein wenig erschrocken, und Ava ging schnell zu ihr, um ihr den Arm um die Schultern zu legen. »Tut mir leid«, sagte sie und lehnte ihren Kopf an Sues. »Ich weiß, dass ich dir viel abverlange, aber sie darf nicht wissen, wo ich bin, bis es zu spät und Goa keine Option mehr ist.«
»Bis du auf goa keinen Fall nach Goa fliegen kannst«, grinste Debs.
»Aber«, warf Sue ein, »wenn du ihr sagst, wie du dich fühlst, dann …«
Ava seufzte. »Meine Mutter ist kein Gefühlsmensch.« Sie lächelte und ließ Sue los. »Wahrscheinlich würde sie schon der Schlag treffen, wenn sie wüsste, was für Essen du uns für den Weg eingepackt hast.«
Debs schlug die Hand vor den Mund. »Ich glaube, ich hab vergessen, meinen Weihnachtspulli mit dem sprechenden Elf einzupacken.«
»Was?!«, rief Ava. »Los! Hol ihn!«
Debs machte kehrt und lief wieder in Richtung Flur, wo sie in ihren schweren Stiefeln die Treppe hinaufstapfte.
Bevor Ava irgendetwas anderes tun konnte, hatte Sue sie gepackt und in ihre Arme gezogen. Sie drückte Ava fest an sich und tätschelte liebevoll ihren Rücken. Der vertraute Geruch von Drogerie-Parfum, nichts übermäßig Exotisches oder Teures, war tröstlich.
»Debs hat mir das mit Leo erzählt«, sagte Sue sanft.
Ava schluckte. »Ach so?«
»Er hat dich nicht verdient«, sprach Sue weiter. »Und du hast es nicht verdient, so behandelt zu werden. Du bist ein tolles, tolles Mädchen und ohne ihn viel besser dran.«
»Ich …«
»Jemanden so zu betrügen … und so zu belügen … dein Vertrauen zu nehmen und darauf herumzutrampeln, als wäre es nichts wert …«
Sie drückte Ava noch ein bisschen fester.
»Ich …«
»Sowas hat niemand verdient.« Sue schniefte und drehte sich weg. Sie griff nach der Küchenrolle und riss ein Stück ab.
»Er mochte nicht einmal Coldplay. Ich hätte es wissen müssen«, erwiderte Ava. Sie schluckte. Sie war nicht einmal sicher gewesen, ob Leo der Eine war. Aber erfahren zu müssen, dass ihm die Beziehung so wenig bedeutete, dass er, ohne zweimal darüber nachzudenken, mit einer Kollegin schlief, die aussah wie Heidi Klum und für Büro-Donuts am Freitag nichts als verachtende Blicke übrig hatte, tat weh. Sie war nicht gut genug gewesen. Die Erinnerungen daran, wie er sie in den Armen gehalten und ihr gesagt hatte, wie schön sie war, waren nun für immer getrübt.
»Ich präsentiere: den Weihnachtself-Pullover«, sagte Debs und hielt ihn hoch in die Luft, bevor sie ihn in ihren Koffer stopfte.
»Ihr werdet eine wundervolle Zeit haben, aber vergesst nicht zu essen. Ich weiß noch ganz genau, wie das in Paris ist«, sagte Sue mit einem Seufzen. »Ihr zwei werdet so überwältigt sein von all der Schönheit und den Klängen der Akkordeons, dem Kaffee, der …«
»Minibar in unserem Zimmer«, fügte Debs mit einem Grinsen hinzu.
»Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich da war, habe ich zwölf Stunden lang vergessen zu essen, und als ich auf das Karussell mit den grinsenden Pferden gestiegen bin, wurde mir direkt ein bisschen schummrig.«
»Merke, keine grinsenden Pferde!«, stellte Ava fest.
»Und denkt dran, ihr braucht genug Energie zum Shoppen!«, fügte Sue hinzu.
Ava musste daran denken, was ihre Mutter ihr geraten hätte. Rhodas Rat wäre eher in Richtung Pass auf, dass du vor dem Shoppen nichts isst, damit du in die XS-Klamotten passt gegangen. »Shoppen!«, rief Debs. »Total mein Lieblingswort!«
»Abgesehen von total«, zog Ava sie auf.