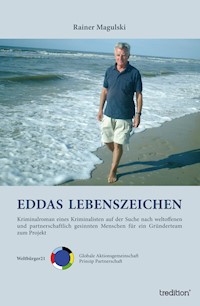3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rainer Magulski, Jahrgang 1941, heute Rentner und Kriminaloberrat a.D., zuletzt neun Jahre Leiter der Kripo in Konstanz/Bodensee. Sein Traumberuf. Dennoch hat er ihn aus politischem Protest aufgegeben, um sich selbst treu zu bleiben. Er hat seine episodenreiche Vergangenheit in dieser Autobiografie selbstkritisch rückblickend vorgelegt, damit vor allem Menschen, die an seinem Projekt Weltbürger21 interessiert sind, mehr über seine persönliche Entwicklungsgeschichte mit allen Ecken und Kanten erfahren können. Dazu hat er diesen außergewöhnlichen Kriminalroman geschrieben: EDDAS LEBENSZEICHEN - Kriminalroman eines Kriminalisten auf der Suche nach weltoffenen und partnerschaftlich gesinnten Menschen für ein Gründerteam zum Projekt Weltbürger21. In dem Kriminalroman gelingt es dem Autor, einen spannenden Fall als Fiktion zu schildern. Er nützt darin die Chance, seine politischen Überzeugungen, Hoffnungen und Aktivitäten nicht nur zu erläutern, sondern auch kritisch hinterfragen zu lassen. Zwei in vielerlei Hinsicht unterhaltsame, spannende und zum Nachdenken anregende Bücher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
www.tredition.de
Gewidmet
meinen Enkelkindern
Rainer Magulski
Wirklichkeit und Traum
Autobiografie eines Kriminalisten
www.tredition.de
© 2016 Rainer Magulski
3. überarbeitete Auflage
Umschlaggestaltung:
Angela Herold, www.herolddesign.de
Umschlagbild:
Marianne Magulski
Verlag: tredition GmbH
ISBN:
978-3-7345-2473-8 (Paperback)
978-3-7345-2474-5 (Hardcover)
978-3-7345-2475-2 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung
1. Kindheit und Jugend
Gezeugt
Gezeugt wurde ich Weihnachten 1940. Das jedenfalls habe ich mir nach meinem Geburtsdatum ausgerechnet. Geboren bin ich in Koppalin im Landkreis Lauenburg in Pommern. Es liegt im damaligen deutschen Hinterpommern an der Ostseeküste. Heute heißt mein Geburtsort Kopalino und ist jetzt ein kleines polnisches Dorf mit vielen Ferienwohnhäuschen an der Ostseeküste und dem nahen Hinterland. Ich kam als fünftes und jüngstes Kind meiner Eltern Rudi und Gerda Magulski, geborene Hüttner, auf diese Welt voller Wunder. Koppalin zählte bei meiner Geburt nur etwa 170 Einwohner. Damals lebten in diesem Dorf wenige Bauern, Fischer, Landarbeiter und Handwerker. Meine Eltern stammen beide aus Lauenburg in Pommern. Dort hatten sie auch geheiratet. Die Geburtsorte von uns fünf Kindern zeigen, wie häufig meine Eltern nach der Heirat aufgrund des Berufs unseres Vaters den Wohnort wechseln mussten. Die Geburtsorte lauten Lauenburg 1934, Leba 1936, Lübtow 1937, 1939 und dann mein Koppalin 1941.
Es war Kriegszeit. Adolf Hitler belog das deutsche Volk und behauptete am Tag des Kriegsbeginns, dem 01.09.1939: „… seit 05.45 Uhr wird zurück geschossen…“. Damit machte er wahr, was er in seinem rassistischen Buch „Mein Kampf“ während seiner Festungshaft in Landsberg bereits 1924 aufgeschrieben hatte. Und viele Deutsche wählten ihn ab 1932, wählten seine NSDAP (National-Sozialistische-Deutsche-Arbeiter-Partei) als stärkste Partei in den Reichstag. Der Reichpräsident von Hindenburg ernannte Hitler zum Reichskanzler. Hitler suchte angeblich für das beengte Gebiet von Deutschland neuen Lebensraum im Osten. Als Folge entfachte er den Zweiten Weltkrieg. Seinen Hass auf die Juden und andere Minderheiten kann ich bis heute nicht verstehen. Seine Hasstiraden in „Mein Kampf“ sind menschenverachtend. Nach dieser NS-Ideologie waren alle slawischen Völker „minderwertig“, also vor allem Russen und Polen. Schon mein Name sagt mir, dass ich ganz sicher auch slawische Wurzeln habe.
Der systematische staatliche Terror und Mord an Millionen Menschen – vor allem Juden, aber auch Sinti und Roma und “Nichtarier“, die in Ghettos und Konzentrationslager verbracht, enteignet, gepeinigt und ermordet (vergast, erschossen, gehängt oder zu Tode geschuftet) wurden – und die in den KZ-Vernichtungslagern verübten Gräueltaten sind für uns Deutsche die schlimmste Schmach unserer Geschichte. Nach dem Überfall auf Polen 1939 folgten die Überfälle auf Frankreich, die Niederlande, Belgien, Finnland, Schweden und Großbritannien. Dann unternahm Hitler 1941 sogar noch Feldzüge gegen seinen ursprünglichen Bündnispartner Russland. Das war der Anfang vom Ende und Untergang. Hitler machte sich mit Ausnahme von wenigen Verbündeten (Italien und Japan) die ganze Welt zum Feind. Nach dem Überfall der Japaner auf die US-Basis von Pearl Harbor erklärte Deutschland auch den USA den Krieg. Zum Glück für die Welt hat dieser fürchterliche Diktator mit seinen ihm zujubelnden Volksmassen diesen schlimmsten Krieg aller Zeiten verloren. Als er begreifen musste, dass er total gescheitert ist, entzog sich Hitler durch Selbsttötung seiner irdischen Verantwortung.
Mich persönlich hat die Tatsache tief betroffen gemacht, dass am 19.09.1941 (mein Geburtstag) für alle Juden die Kennzeichnungspflicht in der Öffentlichkeit in Kraft trat. Alle Juden mussten den „Judenstern“ tragen. Die Vernichtungsstrategie der Nazis gegen die Juden wurde damit öffentlich sichtbar. Auch Polen mussten sich ein „P“ an die Brust heften.
In diesem schrecklichen Jahr 1941 gab es im Stillen trotz allem auch positive Entwicklungen. Das habe ich erst kürzlich erfahren. Im Herbst 2010 besuchten meine Frau Marianne und ich während einer Reise in die Rhön das Konrad Zuse-Museum in Hünfeld. Zuvor hatten wir begeistert das Buch von Friedrich Christian Delius „Die Frau, für die ich den Computer erfand“ gelesen. Wir waren erstaunt, mit welcher Präzision dieser geniale Erfinder Konrad Zuse verschiedene Rechner und auch einen Graphomaten hergestellt hatte. Und er war es, der in meinem Geburtsjahr 1941 mitten in den Kriegswirren den ersten funktionstüchtigen und vollautomatischen Computer – die Z 3 - der Welt entwickelte, der schon über einen Speicher und eine Zentralrecheneinheit verfügte. Konrad Zuse war damals ein 31 Jahre alter Bauingenieur und nach meiner Einschätzung ein ganz großer Geist.
Weihnachten 1940 war mein Vater beim Reichsarbeitsdienst im Lager Lübtow, Kreis Laubenburg, als Truppführer beschäftigt, bevor er als Soldat in der Ukraine und auch in Russland an Feldzügen teilnehmen musste. Nach seiner Erzählung wurde er meist als Quartiermeister eingesetzt. Genau sind mir seine Kriegseinsätze nicht klar. Er redete wenig darüber. Über diese schreckliche Zeit wollte er partout mit uns Kindern nicht ausführlich sprechen.
Jedenfalls habe ich mich manchmal gefragt, welchem Zeitgeist und welchen Umständen ich meine kleine Existenz wohl zu verdanken habe. Immerhin legten die Nazis auf sogenannten arischen Nachwuchs großen Wert. Wenn ich mir heute die Vorbemerkungen in dem Ahnenpass meines Vaters durchlese, dann verstehe ich das alles immer noch nicht wirklich. Da mein Vater in den Reichsarbeitsdienst (RAD) eingetreten war, musste er irgendwann einen Ahnenpass vorlegen, um seine arische Abstammung zu belegen. Sinn der ganzen Ahnennachweise war es, dass künftig in Deutschland nur Personen als Beamte, als Mitglieder der NSDAP sowie in bestimmten (auch untergeordneten) Führungspositionen von Reichswehr und Reichsarbeitsdienst angehören durften, die einen arischen Abstammungsnachweis führen konnten. Die sogenannte arische Abstammung bedeutete: frei von jeder fremden (z.B. jüdischen oder negriden) Blutsbeimischung. Das galt auch für die Ehepartner dieses Personenkreises. Eine menschenverachtende Vorschrift. Jedenfalls musste mein Vater beim RAD als damaliger Truppführer in der Abteilung 3/40 in Lübtow ebenfalls diesen Nachweis führen.
Nach dem Reichsarbeitsdienstgesetz von 1935 sollte der RAD ein sogenannter Ehrendienst am deutschen Volk sein. Alle jungen Deutschen beiderlei Geschlechter waren damit verpflichtet, ihrem Volke im RAD zu dienen. Die deutsche Jugend sollte so erzogen werden im Geiste des Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft und zur wahren Arbeitsauffassung, vor allem zu gemeinnützigen Arbeiten und zur gebührenden Achtung der Handarbeit. Der RAD war deshalb Teil des Nazi-Erziehungssystems. Die Ableistung der Arbeitsdienstpflicht im RAD war Voraussetzung für die Zulassung zum Studium und sollte zudem der Arbeitslosigkeit entgegenwirken.
Für ihre familiäre Fürsorge in den widrigsten Zeitumständen während und nach dem Kriege bin ich unseren Eltern noch heute herzlich dankbar. Sie haben für uns Kinder alles getan. Aber ich bedaure, weil es mir nie wirklich gelungen ist, mit meinen Eltern und vor allem meinem Vater offen über seinen Schicksalshintergrund und seine persönliche Geschichte im „Dritten Reich“ ausführlich zu sprechen. Diese Thematik wurde nicht gründlich diskutiert. Immer mal wieder hatte ich nachgefragt, wie ein ganzes Volk einem solch schrecklichen Tyrannen verfallen konnte. Wie in vielen deutschen Familien wurde ein verdrängendes Schweigen praktiziert. Oder die Antworten liefen darauf hinaus: „Ihr könnt das heute sowieso nicht verstehen.“ Meine Eltern sind beide längst verstorben. Ich habe ihr Verdrängen und Verschweigen akzeptiert. Es gibt aber wenige Momente, in denen ich einen minimalen Einblick erhielt: Dann spürte ich bei den Schilderungen meines Vaters, wie ihn die grauenhaften Kriegserlebnisse ein Stück weit offenbar traumatisiert hatten.
Mein Vater war 1911 in Lauenburg/Pommern geboren und gelernter Tischler. Beim RAD fing er an, weil er infolge der damaligen Weltwirtschaftskrise 1929 (er war 18 Jahre alt) sonst keine Arbeit finden konnte. Meine Großeltern und Urgroßeltern väterlicherseits hatten auch handwerkliche Berufe als Tischler, Zimmerer, Schuhmacher, Tapezierer. Sie stammten aus Lauenburg in Pommern, aus Neustadt in Westpreußen und aus Kelpin bei Danzig. Meine Mutter war 1913 ebenfalls in Lauenburg/Pommern geboren und ab der Heirat mit 20 Jahren Hausfrau und Mutter. Meine Großeltern und Urgroßeltern mütterlicherseits waren gleichfalls Handwerker und stammten von Lüpow bei Stolp und Lauenburg. Mein Urgroßvater mütterlicherseits kam aus Berlin, wo er einen Delikatesswarenhandel betrieb. Von meinen Großeltern lernte ich nur die Mutter meines Vaters, Omi Selma, kennen, die in ihren letzten Jahren bis zu ihrem Tod in Hausach in unserer Familie lebte. Jedenfalls bin ich ein Spross aus einem kleinbürgerlichen Milieu von Hinterpommern.
Vor Jahren haben wir oft Mariannes Tante Inge Kaipf, geb. Lindner in einer schönen Stadt an der Donau besucht. Sie ist inzwischen im Alter von 92 Jahren verstorben. In ihren letzten Lebensjahren sprach sie gerne von ihrer Kindheit und Jugendzeit. Ihre Erzählungen bewiesen immer wieder ihre bewundernswerte Sprachgewandtheit, die sie mit manchem Schalk zu würzen pflegte. Als wir uns über meine Herkunft aus Pommern unterhielten, hat sie diese nette Anekdote mit schelmischem Schmunzeln erzählt:
Reichskanzler Fürst Bismarck, dessen Gut in Pommern lag, besuchte einmal eine Dorfschule in der Nähe. Dieser hohe Besuch wurde vom Lehrer gut vorbereitet. Der Klassensprecher sollte sagen, wenn Bismarck erscheint: „Nun sei gegrüßt, mein großer Fürst, damit Du’s nicht vergessen wirst – (und dann sollte der ganze Chor lauthals rufen)aus Vorder- und aus Hinterpommern soll Dir ein Gruß entgegendonnern.“ Soweit der Plan.
Als Bismarck kam, waren alle sehr aufgeregt. Der Klassensprecher machte seine Sache gut, aber im Chor riefen die Kinder: „Wie der Gruß aus Vorderpommern, soll er aus dem Hintern donnern“.
Der eiserne Kanzler soll es mit Humor aufgenommen haben.
Kindheitserinnerungen
Meine flüchtigen Kindheitserinnerungen setzen sich aus wenigen Bildern zusammen, die ich in meinem Gedächtnis bewahrt habe:
In Koppalin sehe ich mich an unserem kleinen Mietshaus entlang der vorbeiführenden Dorfstraße vor einer ganzen Reihe von Hasenställen sitzen, die mein Vater gebaut hatte. Den Häschen schaue ich bei ihrem mümmelnden Fressen zu und spreche mit ihnen. Gegenüber stehen einige schwarze, weiße und braungescheckte Pferde auf einer grünen Wiese, die von einem Wald umrahmt wird.
Als unauslöschliches Geschehen erlebe ich mich als etwa Dreijähriger auf der schmalen Bettkante vom Bettende meiner Eltern sitzen und dann drauf reiten und rufen: „Gleich macht der Reiter plumps und dann kommt der Rettungswagen!“ So war es denn auch. Ich hatte mich wohl fallen lassen und mir dabei mein rechtes Schlüsselbein gebrochen. Ich kam ins Krankenhaus. Dort fühlte ich mich gar nicht wohl. Weil ich im Krankenhaus ins Bett machte, wurde ich von den Schwestern ausgeschimpft. Mir wurde angedroht, mich in einen Besenschrank zu sperren, wenn das nochmals passiert. Als ich dann trotzdem erneut ins Bett gemacht hatte, versuchte ich das Malheur zu vertuschen – und steckte die Exkremente einfach dorthin, wo kleine Kinder alles reinstecken - in den Mund. Ich weiß nicht mehr, was mir dann geschehen ist. Jedenfalls hat mir der erste fremde Aufenthalt weg von meiner Familie nicht gut getan.
Auf einem anderen bleibenden Bild sehe ich meine Geschwister und mich in bitterer Kälte bei Schnee und Eis auf einem mit Möbeln vollgepackten Pferde-Fuhrwerk sitzen. Damals habe ich nicht begriffen, dass die Flucht gleich beginnen würde. Wie ich später von meiner ältesten Schwester Christel erfahren habe, war unser Vati im Januar 1945 vom Lübtower Lager aus kurz nach Hause gekommen. Er berichtete unserer Mutti ganz aufgeregt: „Unser Lübtower Lager wird aufgelöst. Das ist die Flucht vor dem Russen. Nichts wie weg. Ich lasse Euch nicht alleine zurück!“
Nicht nur für unsere Familie begann damit die Flucht mit dem zwangsweisen Verlassen unserer Heimat. Wir reihten uns auf einem Pferdefuhrwerk in einen Treck ein und kamen so bis zu einer Bahnstation. Dort wurden wir in einer langen Güterwaggon-Reihe verladen. Die Waggons waren mit Stroh ausgelegt und hatten keine Fenster. Menschen wie Vieh eingepfercht. Ich habe in Erinnerung, wie die Frauen und Kinder um uns herum dichtgedrängt standen oder lagen. Eimer dienten den Menschen als Klo, die ihren Toilettendrang nicht zurückhalten und nicht warten konnten, bis der Zug irgendwann mal auf freier Strecke kurz anhielt. Dann stürmten viele in die Büsche. Wenn der Zug wieder anfuhr, hatten einige der Flüchtlinge große Mühe, noch aufzuspringen. So erging es auch meiner Schwester Brigitte, die neben dem anfahrenden Zug weinend herlief und im letzten Moment von hilfsbereiten Armen in unseren Waggon gezogen wurde. In meiner Erinnerung sehe ich viele Flugzeuge und andere dunkle Punkte am Himmel, bei denen es sich um niedergehende Fallschirmspringer handelte. Und unvergessen sind die erlebten Tieffliegerangriffe. Nicht weit von uns schlugen die Geschosse ein.
Meine Bilder von Ladelund an der dänischen Grenze in Schleswig-Holstein, wo wir nach der Flucht die ersten Jahre untergekommen waren, sind mir trotz der deprimierenden Umstände in guter Erinnerung. Obwohl wir zuerst ein beengtes Lagerleben erdulden mussten mit Hunger und Mäusen und Läusen und anderem Ungeziefer. Wie ich vor wenigen Jahren in Ladelund folgerte, wo wir die würdige Erinnerungsstätte besucht haben, wurde das Lager, in dem wir nach unserer Flucht zuerst in Ladelund lebten, bis zur Befreiung der darin eingesperrten Menschen als ein Außenlager des KZ Dachau genutzt.
Für unsere Familie wurde es erst besser, als wir dieses Lager verlassen konnten. Wir erhielten in einem Häuschen beim bäuerlichen Anwesen Jepsen eine Wohnung mit einem kleinen Gartengrundstück, das wir für eigene Zwecke bepflanzen durften. Dort konnte mein großer Bruder Hans-Joachim Tabak anbauen. Ich half ihm dabei. Und welches Glück: Die Kinder der Familie Jepsen waren etwa in unserem Alter in der Geschwisterreihe. Günther Jepsen wurde damals mein Freund und blieb es für die Zeit in Ladelund bis zu unserem Wegzug nach Hausach im Schwarzwald in dunkler Silvesternacht von 1948 auf 1949.
Als Michail Gorbatschow, der damalige neue russische Generalsekretär, im Februar 1986 in einem fast revolutionären Akt seine politischen Vorstellungen Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umstrukturierung) umzusetzen begann, erfasste dieser hoffnungsvolle Zeitgeist auch die Menschen in der DDR. Sie forderten nun für ihr Land ebenfalls solche Rechte und erreichten 1989 mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ und „Wir sind ein Volk“ die Überwindung der Mauer und die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands. Deshalb fuhren Marianne und ich im Juni 1990 nach Pommern und Ostpreußen durch die noch bestehende DDR ins heutige Polen. Wir wollten endlich unsere alte Heimat noch einmal sehen. Marianne stammt aus Ostpreußen. Für diese Reise bin ich dankbar. Sie hat uns damals sehr bewegt und viel gegeben. Wie wir in Koppalin vor meinem Geburtshäuschen standen, hatte ich nicht den Mut, einfach zu klingeln und mir das Haus vielleicht auch von innen anzusehen. Eine innere Hemmnis waren für mich die fehlenden polnischen Sprachkenntnisse.
Wie wir danach zehn Jahre später nochmals in Pommern und Ostpreußen Urlaub machten, fand ich am Eingang zu meinem Geburtshaus ein amtliches Schild. Aus meinem Geburtshäuschen war jetzt ein kleines Forsthäuschen geworden. Vermutlich wohnte ein Forstbeamter darin. Auch bei diesem Besuch habe ich nicht das eingezäunte Grundstück betreten. Ich hatte erneut Bedenken. Ich wollte die Bewohner nicht beunruhigen. An einer anderen Stelle hatten wir erlebt, dass die jetzt hier heimischen Menschen beim Auftauchen von den Deutschen sehr misstrauisch waren. Deshalb die Zurückhaltung von Marianne und mir.
Wir gingen bei beiden Besuchen durch den kleinen verschlafenen Ort an alten Bauernhäuser und Wiesen vorbei, auf denen viele Blumen und Mohn und Kornblumen blühten. In Koppalin habe ich mit meinen Sinnen mein Geburtsdorf bildlich nicht wirklich wiedererkannt. Aber ich habe meine Heimat gerochen! Erstmals in meinem Leben ist mir die prägende Wirkung des Geruchssinns sehr bewusst geworden. Wohl nicht von ungefähr an meinem Geburtsort. Und es war ein beglückendes Gefühl, durch den Kiefernwald zu Fuß zur Ostsee zu gehen, den herzhaften Waldesduft zu riechen und einzuatmen und schon das Ostseerauschen zu hören. Und dann die Ostsee zu sehen, in ihr zu baden, im weißkörnigen Sand am Strand zu liegen und dem bewegenden Rauschen der unendlichen Brandung zu lauschen.
Kopalino hatte sich bei unserem zweiten Besuch zu einem Ort mit einer ansehnlichen Anzahl von Ferienhäuschen erstaunlich gut entwickelt. Uns hat das gefallen. Ich wünsche den jetzt dort lebenden Menschen, dass sie in ihrer neuen Heimat ein gutes Leben haben können – und nicht irgendwann flüchten müssen.
Auch wenn ich in meinen Erinnerungen sicher viel Schlimmes verdrängt habe und die Bilder mit zunehmendem Alter immer nebulöser und flüchtiger werden. Ich blicke auf eine glückliche Kindheit zurück. Im Kreise unserer Familie fühlte ich mich wohl. Es war schließlich ein Glück: Wir sind alle am Leben geblieben. Unsere Eltern haben ihr Mögliches mit viel persönlicher Entbehrung getan und sich bemüht, uns die Tür für ein lebenswertes Leben zu öffnen. So gut es unter diesen armseligen Umständen ging, haben sie uns Chancen geboten und uns eine freie Selbstfindung ermöglicht. Dafür bleibe ich ihnen dankbar.
Lernen
Lernen hat mich mein Leben lang begleitet. Zuerst einmal habe ich vier Jahre die Volksschule besucht. In angenehmer Erinnerung ist mir in diesen ersten Jahren unsere Klassenlehrerin Frau Teuber in Hausach geblieben. Mir fiel die Schule leicht. Zu Hause habe ich meistens nicht viel getan. Aber wir hatten zudem fast keine Bücher. Das Geld reichte nicht, um alle notwendigen Lehrbücher und Hefte zu beschaffen. Dennoch muss ich eingestehen – ich war oft ganz schön faul. Ich vertrieb mir die Zeit lieber mit meinen Freunden. Am Anfang war das Willi Kienzler, der in Hausach Am Hinteren Bahnhof in unserer Nachbarschaft wohnte.
In der Volksschule habe ich ohne viel für das Lernen zu investieren gute Noten erhalten. Ich durfte deshalb aufs Gymnasium wechseln. Dort herrschte ein anderes Milieu. 1953 war ich in unserer Klasse das einzige Flüchtlingskind. Die anderen Kinder stammten aus der gutbürgerlichen Mittelschicht. Als Kind aus einer armen Familie war es ein unmögliches Handicap, alle notwendigen Bücher zu beschaffen. Die Bücher meiner älteren Geschwister waren meistens schon überholt oder nicht mehr ganz vollständig. Ich habe mich jedes Mal geschämt, wenn ich ein neues Heft oder gar ein neues Lehrbuch benötigte. Wir waren eine arme, kinderreiche Familie. Meine Mutter musste im nahen Lebensmittelgeschäft fast ständig anschreiben lassen. Dann wurde am Monatsanfang die aufgelaufene Rechnung bezahlt. Wir Kinder bekamen das natürlich mit, weil wir oft auch zum Einkaufen mit dem Bemerken geschickt wurden: Lass anschreiben. Mir war das immer peinlich.
Wir wohnten damals in Hausach Am Hinteren Bahnhof zwischen den Gleisen. Unmittelbar am Haus fuhren die Lokomotiven vorbei, wenn sie zur nahen Drehscheibe gefahren wurden. Meine liebe Omi Selma, die Mutter von unserem Vati, lebte damals in unserer Familie. Sie geriet aus ungeklärten Umständen unter eine Rangierlokomotive. Beide Beine wurden ihr abgefahren. Der Krankenwagen hatte nur die Omi – sie ist auf der Fahrt zum Krankenhaus verstorben - ohne ihre abgefahrenen Beine mitgenommen. Mein vier Jahre älterer Bruder Hans-Joachim und ich (damals 10 Jahre alt) mussten jeder eines der verpackten Beine zur Leichenhalle ins entfernte Krankenhaus Hausach tragen. Wir nahmen den Fußweg entlang der Kinzig, um so die Stadt zu umgehen. Auf dem etwa eine halbe Stunde langen Fußweg war es mir mit dem kräftig in Packpapier eingewickelten Bein auf der Schulter ziemlich gruselig.
Da ich wusste, wie schwierig es für unsere Eltern war, uns Kinder überhaupt zu ernähren und sogar noch Schulgeld für die Ältesten zu bezahlen, war ich im Sommer wie einige andere Kinder in meiner Volksschulzeit barfuß in die Schule gegangen. Das behielt ich auch noch im Gymnasium bei, als ich schon in die Quarta ging. Ich erinnere mich noch gut an ein Erlebnis mit meinen Französischlehrer, der auf dem Flur der Schule mit zwei Lehrerkollegen sich unterhielt. Als ich nur wenige Schritte an der Gruppe vorbeigegangen war, hörte ich ihn sagen: „So etwas gehört sich einfach nicht an unserer Schule!“ Natürlich bezog ich das auf mich. Am Ende der Quarta wurde ich nicht versetzt, weil ich in Französisch eine Fünf bekommen hatte. Auch wenn ich das damals als ungerecht empfand – ich muss zugeben, in Französisch hatte ich tatsächlich nicht genug getan. Mit den in Hausach stationierten französischen Besatzungssoldaten konnte ich mich ganz gut auf Französisch unterhalten. Das genügte mir, war aber wirklich ein dummer Fehler.
Meine anderen Noten waren insgesamt durchaus zufriedenstellend. Wegen meiner Note in Französisch war ich jetzt ein Sitzenbleiber. Ich hätte die Klasse wiederholen können. Doch ich entschied mich anders. Ich wollte so schnell als möglich die Schule hinter mich bringen und finanziell meinen Eltern nicht noch mehr kosten. Deshalb wechselte ich zurück zur Volksschule in die 8. Klasse, um einen ordentlichen Abschluss zu haben und dann erst einmal einen praktischen Beruf zu erlernen.
Mein bester Freund in dieser Zeit war Wilfried Hecht. Auch er ein Flüchtlingskind. Wir verstanden uns gut und hockten viel zusammen. Uns schloss sich bald Klaus Keller an, dessen Eltern Steinbruchbesitzer in Hausach waren. Das Geschäft mit Schottersteinen boomte damals im Kinzig Tal. Die Familie Keller konnte sich einen gehobenen Lebensstandard leisten. Kellers lebten trotzdem sparsam, unkompliziert natürlich und keinesfalls abgehoben. Wir wurden dort gut aufgenommen, fühlten uns immer willkommen und haben uns als Flüchtlingskinder bei dieser gutbürgerlichen Familie sehr wohlgefühlt.
Nach der Schule verbrachten wir die meiste Zeit beim „Bierkeller“, einer aus Holzstämmen gezimmerten großen Waldhütte. Im Kellergewölbe vom Bierkeller wurden für die dort oft gefeierten Waldfeste Getränke gelagert, vor allem Bierfässer – von daher der volkstümliche Name. Wir hatten in diesem Holzhaus auch ohne Bier oder Alkohol viel Spaß – und wenn wir trinken wollten, konnten wir unseren Durst an einer nahen Quelle mit frischem Bergwasser stillen. Manchmal kamen Mädchen aus unserer Klasse vorbei. Das war dann natürlich reizvoll. Necken und Frotzeln waren angesagt. Für speziellere geschlechtliche Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht war es für uns noch nicht die Zeit. Nach dem Schulabschluss dauerte es nicht mehr lange, bis uns und mir Mädchen immer wichtiger wurden. Über dieses kleine Kapitel und meine pubertären Erfahrungen werde ich mich hier wohl besser nicht weiter auslassen.
Die Freundschaft zu Wilfried und Klaus hielt viele Jahre, auch als ich zur Polizei ging und deshalb Hausach verlassen hatte. Beide blieben viele Jahre weiterhin meine Freunde. Aber wir sahen uns immer seltener. Jeder ging seiner Wege. Wir gründeten alle Familien und unsere Kontakte wurden spärlicher. Klaus wurde selbständiger Optiker. Jetzt sehe ich ihn allenfalls beim Klassentreffen, sofern wir beide teilnehmen. Wilfried hatte erfolgreich die Inspektoren Laufbahn beim Landratsamt Wolfach eingeschlagen und ist leider zu früh verstorben.
Nach der Volksschule begann ich bei der Firma Mannesmann in Hausach eine Blechschlosserlehre. In Hausach gab es damals nicht viele Möglichkeiten, einen handwerklichen Beruf zu erlernen. Ich wollte unbedingt einen praktischen Beruf ergreifen, obwohl ich gleich nach dem Schulende erste Überlegungen angestellt hatte, mich später bei der Polizei zu bewerben. Allerdings konnte man frühestens mit 18 Jahren bei der Polizei eingestellt werden. Damals habe ich mir noch als geheimen Berufswunsch erhofft, Kriminalist zu werden. Ich hatte meine Zweifel, ob ich überhaupt die Prüfung der Diensttauglichkeit überstehen würde, weil ich die oberen Schneidezähne als Folge eines Fahrradunfalls schon in der vierten Volksschulklasse verloren hatte und eine Zahnprothese tragen musste.
Während meiner drei Lehrjahre besuchte ich die Gewerbeschule in Wolfach für metallverarbeitende Berufe. Bei der Abschlussprüfung erhielt ich ein sehr gutes Zeugnis und absolvierte die Gesellenprüfung bei der Firma Mannesmann als Jahrgangsbester. Deshalb bot man mir an, eine gute Ausbildung als Ingenieur zu beginnen. Die Firma Mannesmann wollte mich fördern. Ich hatte jedoch andere Pläne. Dennoch durfte ich als Belohnung für meinen guten Prüfungsabschluss für eine Woche zusammen mit anderen Jahrgangsbesten von weiteren Niederlassungen der Firma Mannesmann in Deutschland nach München zur gründlichen Besichtigung des Deutschen Museums reisen. Den ersten Tag hielten wir uns nur im Museum auf, am 2. Tag dann nur noch vormittags. Da wir als Nachweis der Besichtigungstour im Museum den jeweiligen Tagesstempel benötigten, sind wir an den Folgetagen nur zur Kasse, haben unsere Bescheinigungen abstempeln lassen und sind dann im Zentrum von München und im Englischen Garten auf Erkundung gegangen. Für mich das erste Großstadterlebnis. Die Stadt hat mich damals fasziniert. Jetzt im Alter fahre ich immer wieder gerne mal in Bayerns Hauptstadt München an der Isar.
Weil ich das Gymnasium letztlich aus eigenem Verschulden nicht durchgestanden hatte, war ich später gezwungen, mir nicht nur vieles autodidaktisch anzueignen sondern auch nach meinem Eintritt in die Polizei berufsbegleitend viele Jahre zu lernen. Wenn ich jetzt nachrechne, komme ich auf über zwanzig Schul- und Studienjahre. Je älter ich wurde, desto konsequenter habe ich mich bemüht, erfolgreich zu lernen.