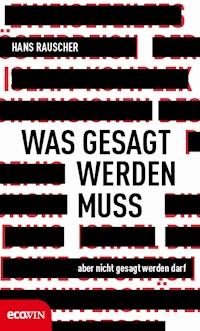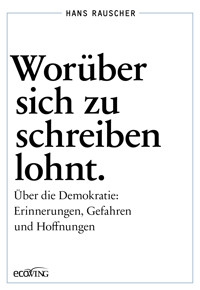
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Worüber sich zu schreiben lohnt. Über die Demokratie: Erinnerungen, Gefahren und Hoffnungen. Klarer Blick, klare Worte: Persönlicher Rückblick auf 50 Jahre kritischen Journalismus in Österreich mit tiefen Einblicken in Politik und Gesellschaft Antisemitismus, Migrationsdebatte, Machtmissbrauch: Hans Rauscher spart kein Thema aus, wenn er auf die österreichische Politik blickt, die er als Journalist hautnah miterlebt, analysiert und kommentiert hat. In einer Zeit gesellschaftlicher und politischer Krisen gewährt der erfahrene Medienexperte bemerkenswerte Einblicke in seine Erlebnisse und seine berufliche Laufbahn. - EU-Beitritt, Zusammenbruch des Kommunismus, Korruptionsskandale: 50 Jahre Innen- und Außenpolitik in Österreich - Eine fundierte Analyse der österreichischen Zeitgeschichte und der Berichterstattung durch die Medien - Ein Plädoyer für die Demokratie und das Recht auf Information Zeitenwende und Angriff auf die Demokratie: Ist der Journalismus ein Kulturgut oder am Ende? Kritisch äußert sich Rauscher zum fragilen Zustand der Demokratie in Österreich und Europa sowie zum Qualitätsjournalismus an sich. Beides hängt eng miteinander zusammen: Fake News zu entlarven wird immer anspruchsvoller, die Bedrohung von Rechts ist real und der Anspruch der Medien an die eigene Arbeit sinkt. Seine kritische Analyse der letzten Jahrzehnte österreichischer Politik aus Sicht eines Journalisten ist indes nicht hoffnungslos. Dieses erzählende Sachbuch ist ein scharfsinniges Resümee von 50 Jahren politischem Journalismus in Österreich. Zugleich ist es ein Plädoyer für die Demokratie. erhellend und aufrüttelnd!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
HANS RAUSCHER
Worüber sich zu schreiben lohnt
HANS RAUSCHER
Worüber sichzu schreiben lohnt
Über die Demokratie: Erinnerungen, Gefahren und Hoffnungen
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren beziehungsweise Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2024 ecoWing Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – Wien, einer Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Palatino, OCRFPro, Sabon LT Pro
Umschlaggestaltung: Isabel Neudhart-Haitzinger
ISBN: 978-3-7110-0360-7
ISBN: 978-3-7110-5375-6
Inhalt
EINLEITUNGWorüber sich zu schreiben lohnt in Zeiten wie diesen …
KAPITEL 1Sind wir glücklich? Ein politisches Jahr. Tatsachen und Befindlichkeiten
KAPITEL 2Was auf dem Spiel steht. Don’t worry, Hans! Woran man merkt, dass das Erreichte auf der Kippe steht.
Die Sozialpartner Sallinger und Benya
KAPITEL 3Das Personal der Republik. Zeichensetzer, Pflichterfüller und Blender
Bruno Kreisky – der wahre »Volkskanzler« mit dunkler Seite
Kurt Waldheim – der Mann, der nur seine Pflicht getan hatte
Franz Vranitzky – der Kanzler der großen Krisen, der »Technokrat« mit moralischem Gewissen
Alois Mock – nie Kanzler, aber trotzdem Weichensteller
Thomas Klestil – Macht braucht Kontrolle, aber Kontrolle braucht auch Macht
Der kalte Kanzler Wolfgang Schüssel
KAPITEL 4Die Erlöser. Österreich liebt sie, die jungen, feschen, kometenhaften Aufsteiger. Manchmal sogar noch weit über deren Absturz hinaus.
KAPITEL 5Das große digitale Geschrei. Nation der Gefühle und Kampfbegriffe. Antisemitismus reloaded.
KAPITEL 6Machtmissbrauch mit Schmäh. Eine kurze Theorie der Korruption in Österreich
KAPITEL 7Gehört Österreich zum Westen? Entscheidung für die EU – Zeuge der großen Wende in Osteuropa
Die Wahl zwischen dem Westen und dem bröckelnden Ostblock
Demokratisches Osteuropa? Treffen mit Lech Wałęsa und Václav Havel
Die Gleichzeitigkeit der Entwicklungen – der Kommunismus in Osteuropa bröckelt, Österreich wendet sich der EU zu
Ein Akteur der Geschichte namens Habsburg
Enttäuschte Hoffnungen für Russland
Die chinesische Methode
Erneut vor der Entscheidung: West oder Ost?
KAPITEL 8Das Schicksal der Ukraine ist auch unser Schicksal.
KAPITEL 9Große Medienmenschen, bange Zukunftsfragen und was man tun sollte
KAPITEL 10Zur Rettung der Demokratie.
EPILOGHat der Journalismus eine Zukunft? Und wenn ja, welche?
»In Zeiten wie diesen« hörte man Bruno Kreisky, österreichische Kanzler-Ikone, oft sagen. Was er, der oft als »Sonnenkönig« tituliert wurde, damit meinte, war, dass nur er und seine Partei, die SPÖ, Österreich sicher durch die Krisen geleiten könnte. Eigentlich sind es immer »Zeiten wie diese«. Es gibt immer wieder eine Krise, die zu bewältigen ist. Die Politik neigt zur Dramatisierung.
Heutzutage allerdings sind »Zeiten wie diese« andere als jene, die Kreisky gewärtigte. Europa erlebt einen großen Krieg, eine Migrationswelle folgt der anderen. Die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus ist nicht enden wollend. Das Gespenst der Inflation ist nicht gebannt, die Wirtschaft schwächelt. Die Coronapandemie hat den gesellschaftlichen Grundkonsens zerrissen. Die Folgen sind nach wie vor spürbar. Für die Klimakrise ist keine zeitnahe Lösung in Sicht. Die Feinde der Demokratie und die Freunde autoritärer Herrschaftsmodelle sind auf dem Vormarsch. All das rüttelt am Fundament unserer erfolgreich etablierten europäischen Nachkriegsgesellschaften.
Ich analysiere und kommentiere seit einigen Jahrzehnten die Vorgänge in Österreichs Politik und Gesellschaft. In den Magazinen trend, profil, Kurier und in der Tageszeitung Der Standard – meist mit dem Kürzel RAU im sogenannten »Einserkastl« auf Seite 1. Ich war in den Zeiten berichtend dabei, als es um große Umbrüche ging: etwa um die Entstehung einer Zivilgesellschaft in Österreich (die Auseinandersetzung um das Atomkraftwerk Zwentendorf, um die Stopfenreuther Au nahe Hainburg, beim »Lichtermeer gegen Ausländerhass«). Ich durfte den Beitritt zur EU journalistisch begleiten wie auch den monumentalen Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa und die großen politischen Korruptionsskandale in Österreich mit ihren oft menschlich sehr kleinen und vor allem sehr österreichischen Begleiterscheinungen (»Korruption mit Schmäh«). Ich habe bedeutende Politiker, in- und ausländische, kennenlernen dürfen, aber auch Blender und Scharlatane. Davon wird in diesem Buch erzählt. Merkwürdige und amüsante Begebenheiten werden nicht ausgespart.
Nun stehen wir an einer großen »Zeitenwende«. Die rechteste FPÖ, die es je gab, ist die stärkste Partei im Land. Es geht nicht nur um die äußere Bedrohung durch Kriege, sondern auch um die innere: um ein Nachlassen des Vertrauens in die Demokratie. Nicht nur hierzulande, sondern in ganz Europa. Kritischer Journalismus ist unerlässlich, aber nicht unfehlbar. Und oft hat er gegen die vorherrschende Meinung recht behalten. Die Tatsachen zu benennen, Fakten diffusen Meinungen und den daraus resultierenden Ängsten entgegenzustellen, ist das einzige Mittel, um die Basis für Vertrauen wiederherzustellen.
Dafür lohnt es sich zu schreiben.
Sind Sie glücklich? Blöde Frage, werden Sie denken, aber ernsthaft: Sind Sie glücklich? Die Antwort ist nämlich auch politisch relevant. Es gibt dazu, wie zu fast allem, Umfragen – und die besagen: Wähler von Rechtspopulisten sind unglücklich. Und Rechtspopulisten mit fragwürdigen demokratischen Ansichten und Absichten sind auf dem Vormarsch.
Aber das ist nur ein Aspekt eines größeren Themas: Wir spüren, dass wir in einer Zeit leben, in der sich die Dinge nicht unbedingt zum Besseren wenden, um es vorsichtig zu formulieren. Wir spüren, dass sich etwas dramatisch ändert, in der Weltpolitik, in der lokalen österreichischen Politik, in der Auswirkung auf unser alltägliches Leben. Das Jahr 2024 mit seinen vielen wichtigen Wahlen ist möglicherweise ein Wendepunkt gewesen, an dem sich für uns und unsere Kinder so viel entschieden hat.
Sind wir glücklich? Oder, anders formuliert, sind wir optimistisch? Wir als österreichische, europäische, westliche Gesamtheit? In diesem Jahr 2024, für das einige sehr große Entscheidungen erwartet wurden?
Worüber sich zu schreiben lohnt? Genau darüber – über die Befindlichkeiten und die Tatsachen in diesem Jahr der Verunsicherung und Verwirrung, über die Frage, wie es in einem wohlhabenden, friedlichen, scheinbar abgesicherten Land wie Österreich, aber auch in einem Kontinent wie der EU zu einer Stimmung kommen kann, in der plötzlich alles infrage gestellt scheint.
Darüber, was die Ursachen sind für dieses plötzliche Gefühl der Bedrohung, das durchaus auch mit tatsächlicher Bedrohung unterlegt ist. Und vor allem darüber, was man tun kann, um das Erreichte zu bewahren – den Wohlstand, die soziale Sicherheit, aber auch die demokratische Freiheit und einen zivilisierten Stil der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung. Aber auch, ganz dringend, um einen Stil der öffentlichen Auseinandersetzung, der sich nicht in gegenseitigem Krawall und Geschrei, in Hasspostings und Morddrohungen manifestiert. Es geht um das Österreich, in dem wir leben wollen. Und um ein Europa, in dem wir leben wollen.
Vielen scheint das in Gefahr. Schon zu Beginn des Jahres 2024 blickten sehr viele Menschen wenig optimistisch in die Zukunft. Das Linzer Market Institut hat zu Jahresanfang gefragt, ob man das Jahr eher optimistisch oder pessimistisch sehe: »Darauf bekannten sich 45 Prozent als Pessimisten – ein sehr hoher Wert, wenn man die Vergleichsumfrage von Ende 2019 (20 Prozent Pessimisten) oder auch jene von Ende 2020 heranzieht: Sogar mitten in der Coronapandemie standen nur 36 Prozent Pessimisten 37 Prozent Optimisten gegenüber. Jetzt ist der Anteil jener, die sich als Optimisten bezeichnen, auf 26 Prozent gesunken« (Der Standard, 01.01.24).
Und es wurde im Laufe des Jahres nicht besser. Im Frühsommer lieferte der Politikexperte David Pfarrhofer vom erwähnten Market Institut den Befund: »In Deutschland hat das Allensbach-Institut kürzlich erhoben, dass dort nur 28 Prozent Optimisten sind, der niedrigste Wert seit 1950. Bei uns in Österreich haben wir den Tiefstwert mit 18 Prozent vor eineinhalb Jahren gemessen – aber die derzeitigen 31 Prozent Optimisten sind natürlich auch eine Minderheit. Und in beiden Ländern geht der Mangel an Optimismus mit Konsumzurückhaltung einher, in beiden Ländern ist das Wasser auf die Mühlen von AfD beziehungsweise FPÖ. Im freiheitlichen Lager gibt es besonders wenige Optimisten, dafür aber eineinhalbmal so viele erklärte Pessimisten, nämlich 61 Prozent, wie in der Gesamtbevölkerung, in der sich 40 Prozent als ausdrücklich pessimistisch deklarieren.« Und im Juli 2024 dann: 74 Prozent der Befragten glaubten, dass »Österreich sich in die falsche Richtung entwickelt« (Market-Umfrage für Der Standard). 74 Prozent Zukunftsängstliche! 40 Prozent Pessimisten in der Gesamtbevölkerung! Aber wen wundert es? Zu viele dramatische Ereignisse drücken auf die Stimmung: die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Die Coronapandemie wirkt noch nach, viel stärker, als man es gemeinhin annimmt. Nach einer Erhebung der Statistik Austria berichten 40 Prozent von psychischen Beeinträchtigungen durch die Auswirkungen der Pandemie. Das Zuwanderungsthema ist ein eigener, riesiger Block. Die Konjunktur ist schwach, die Teuerung hoch, die Unzufriedenheit mit den persönlichen Einkommen ebenfalls. Wohnungseigentum? Unleistbar für junge Leute. Und es gibt mehrere gefährliche Grundströmungen der Grundunzufriedenheit, die bis in die Mittelschicht reichen: einerseits die zunehmende Verschärfung des politischen Diskurses, nicht nur in der politischen Blase, sondern auch im allgemeinen gesellschaftlichen Austausch, vor allem in den sozialen Medien. Über allem schwebt aber das Gefühl breitester Schichten, dass die Regierenden das Geschehen nicht mehr kontrollieren, gestalten, einfach ihren Job nicht mehr angemessen tun. Dass sie sich in Streitereien verzetteln, um Pseudoprobleme kümmern, jedenfalls eher dahindilettieren, als ordentliche Arbeit zu leisten oder gar große Weichenstellungen vorzunehmen. Dieses Gefühl ist auch nicht ganz falsch, jedenfalls in Österreich.
Es wird in diesem Buch noch darauf einzugehen sein, aber meine Erfahrung als politischer Journalist umfasst mehrere große Projekte, die von weitblickenden Politikern angegangen wurden und Österreich verändert haben. Bruno Kreisky modernisierte die Gesellschaft (Frauenrechte, Fristenlösung, Schulbuch- und Schülerfreifahrtenaktion, Homosexualität wurde straffrei) und baute den Sozialstaat aus; Alois Mock warb intensiv für den EU-Beitritt und setzte ihn gemeinsam mit Franz Vranitzky gegen nicht geringe Widerstände durch; beide bauten auch die verstaatlichte Industrie nach der Beinahepleite Mitte der 1980er-Jahre um. Erhard Busek bereitete schon zu (Spät-)Zeiten der kommunistischen Vorherrschaft in Osteuropa die Öffnung nach Ost-Mitteleuropa vor; Wolfgang Schüssel setzte dann der EU-Osterweiterung zumindest keinen Widerstand entgegen (wohl auch, weil die österreichische Wirtschaft massiv in Osteuropa investierte). Was dann kam, war größtenteils schon eine Reaktion auf Krisen: etwa auf die Finanzkrise 2008 (im Gefolge der US-Krise um den Zusammenbruch des Bankhauses Lehman Brothers) oder auf die Umsatzausfälle durch die Corona-Lockdowns, als die Regierung mit Staatssubventionen einschritt. Absolut notwendige Notmaßnahmen, aber keine Zukunftspolitik. Seither verstärkt sich der Eindruck der Unregierbarkeit noch, in Österreich und anderswo. Wer soll eine Regierung bilden, wenn die umfragenstärkste Partei, die FPÖ, nicht als koalitionsfähig gilt und die anderen nur mühsam zusammenfinden können? Noch dazu, wo das Antreten von speziellen Kleinparteien – KPÖ, Bierpartei, Liste Madeleine Petrovic – die Mehrheitsbildung erschwert?
Wofür es sich zu schreiben lohnt? Zum Beispiel, um den tiefen Pessimismus begreifbar zu machen, der offenbar Österreichs Bürgerinnen und Bürger angesichts der Lage ergriffen hat, um seine Ursachen und um mögliche Mittel auzumachen, ihn wieder in eine halbwegs optimistische Grundstimmung zu verwandeln. Über die Politik- und teilweise auch Demokratieverdrossenheit, die gefährliche Ausmaße anzunehmen beginnt. Nicht zuletzt über den neuen, unangenehmen bis hasserfüllten Ton, der nicht nur in der Politik, sondern auch in der von vielen neuen »Mitspielern« bevölkerten Welt der sozialen Medien eingerissen ist. Eine besondere Entwicklung, die auch wir Journalisten nicht richtig verstanden haben, ist das tiefe Gefühl der Bevormundung und des Übergangenwerdens, das die Coronamaßnahmen bei nicht wenigen ausgelöst haben. Das hatte Folgen. Die Pandemie ist vorbei, aber die Radikalisierung ist geblieben.
Gut, die Unglücklichen, Unzufriedenen sind in der Minderheit. Allerdings eine starke Minderheit. Angesichts der Tatsache, dass wir immer noch in einem der wohlhabendsten Staaten Europas (und damit der Welt) leben, ist das erstaunlich und sollte genauer untersucht werden. Eine durch Umfragen abgesicherte Tatsache ist, dass unter Wählern und Sympathisanten von autoritären, populistischen und nationalistischen Parteien die Unzufriedenen und Unglücklichen am stärksten vertreten sind, und zwar mit teils erschreckenden Prozentsätzen. Die Parteien, die die Unglücklichen, Unzufriedenen vertreten oder zu vertreten behaupten, stellen in Europa (und in den USA) im Grunde die Systemfrage. Sie wollen wirklich etwas anderes, ganz anderes. Und zwar ein autoritäres System.
Unter dem Titel »Ich höre ein Ungeheuer atmen« schrieb Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek im Jänner 2024: »Ich höre, wie der Atem der Demokratie schwächer wird … Orbán hat sich schon von der Demokratie verabschiedet, so leichtherzig, dass sie es dort kaum merken, sonst wären sie alle täglich gegen ihn auf der Straße.«
Auch auf der ganz großen Weltbühne scheint das Momentum, die Schwungmasse, auf der Seite der Autoritären zu sein. Sie wollen eine »neue Weltordnung«, in der sie und nicht die demokratischen Rechtsstaaten die Regeln aufstellen. Der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping versicherten einander im Frühsommer 2024 erneut der »grenzenlosen Freundschaft« und ließen keinen Zweifel über ihre Absichten, eine neue Ordnung zu schaffen, in der sie zusammen mit Gleichgesinnten – etwa dem Regime in Iran – die wirkliche Macht ausüben. Dazu gehört auch Krieg, um »abtrünnige Provinzen« wie die Ukraine oder Taiwan »heimzuholen«.
Haben sich die liberalen Demokraten verirrt und verzettelt? »Der liberale, vernünftige, mächtige Teil der Republik muss einiges gewaltig falsch machen«, schrieb Bernd Ulrich, der frühere stellvertretende Chefredakteur der Zeit, nunmehr freier Essayist, Anfang des Jahres. Er machte einen Vorschlag zur liberalen Selbstkritik: »Während die Rechten eine emotionale Antwort auf die epochalen Herausforderungen – Machtverlust des Westens, Klimakrise, Migration – haben, finden die vernünftigen Kräfte kaum noch Zugang zu den Gefühlen der Menschen. Rechtspopulisten sagen den Leuten: Euer Leben könnte genauso sein wie immer, wenn nur diese linken Eliten nicht wären, die Probleme erfinden, um euch zu gängeln. Die Liberalen sagen: Wir bringen euch eure alte Normalität zurück, wenn wir diese Krise für euch und ohne euch gelöst haben. Und dann noch diese. Und diese … Es ist die Sprache der Technokratie im Stadium der Vergeblichkeit. Worin aber besteht das liberale Projekt?«
Ganz einfach, möchte man meinen: Es geht um die Aufrechterhaltung der liberalen Demokratie, die wir nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus und des Kommunismus in Europa aufgebaut haben.
»Demokratie« allein genügt nicht? Liberal muss sie auch noch sein? Nun, es gibt Unterschiede. In einer liberalen Demokratie gibt es freie und faire Wahlen, die Opposition und die kritische Presse werden nicht von einem autoritären Regime behindert, es herrschen Gewaltentrennung, Rechtsstaatlichkeit, Menschen- und Bürgerrechte. In anti-liberalen »Demokratien« wird zwar auch gewählt, aber die Wahlen sind weder frei noch fair und die erwähnten Rechte eingeschränkt.
Nun mögen viele gerade in Österreich der Meinung sein, das sei bei uns ohnehin der Fall. Wir seien gar keine echte liberale Demokratie, sondern eine Art Zwischending, wo sich »die da oben alles richten« und »die kleinen Leute nichts zu reden haben«. Diese Sicht von Österreich bekam übrigens durch die Coronamaßnahmen gewaltigen Auftrieb.
Ein Blick zu den Nachbarn Ungarn und Slowakei zeigt uns: Von solchen autoritären Verhältnissen sind wir (noch) meilenweit entfernt. In Österreich wird niemand wegen seiner (demokratischen) politischen Meinung verfolgt, es gibt keine »starken Männer«, die seit Jahrzehnten regieren, die Justiz und die anderen staatlichen Institutionen funktionieren einigermaßen.
Vieles davon ist gefährdet, kein Zweifel. Wie man das bewahrt, was unter dem Ansturm so vieler Krisen ins Wanken geraten ist – darum geht es in diesem Buch.
In Österreich und Europa spürt man den Wandel des politischen Klimas. Wie man das Erreichte bewahrt, damit gilt es sich zu befassen. Der Leidensdruck ist vielleicht noch nicht groß genug, das Gefühl, nun müsse aber wirklich etwas geschehen, noch nicht stark genug.
Wie wir wieder auf sicheren Boden kommen – darüber lohnt es sich zu schreiben. Wie man die Errungenschaften einer bald 80 Jahre währenden Demokratie bewahrt – darüber lohnt es sich zu schreiben.
Zu zeigen, dass und in welcher Weise das Lebensgefühl in unserem Land wie auch in Europa angegriffen ist – das muss dargestellt werden. Das Mittel der Wahl hierfür ist der Journalismus. Und deshalb lohnt es sich zu schreiben.
Ich bin 2013 in einem griechischen Spital wegen einer Verletzung behandelt worden. Dort gab es mehr Ikonen und brennende Kerzen als moderne medizinische Geräte. Der junge Arzt sagte mir, man habe sein Gehalt soeben auf 1.000 Euro gekürzt. Ich war auch vor Jahren einmal kurz in einem Spital in New York. Die erste Frage dort war die nach meinem Vornamen (»Don’t worry, Hans«), die zweite nach der Privatversicherung. Seither weiß ich das österreichische Krankenhaussystem zu schätzen.
Ich habe 2016 die jungen Drogensüchtigen und Obdachlosen in den Eingängen der Luxusgeschäfte der Londoner Regent Street und der Hauptstraße der mittelalterlichen Universitätsstadt Oxford herumliegen sehen. Man sagte mir, deren Zahl sei sprunghaft angestiegen, weil die britische Regierung unter dem Konservativen David Cameron den humanitären NGOs die Mittel gekürzt habe. Seither schätze ich das österreichische Sozialsystem noch mehr.
Ich war 2005 mit dem Jesuitenpater Georg Sporschill, der sich um Straßenkinder in Rumänien und Moldawien kümmerte, in einem der von ihm betriebenen und von österreichischen Spendern finanzierten Heime in Chișinău, Hauptstadt von Moldawien. Dort leben Kinder, die von ihren Eltern einfach verlassen wurden (damals rund 50000 im ganzen Land mit 2,5 Millionen Einwohnern). Ein etwa zehnjähriger Bub ließ stundenlang die Hand des Paters nicht los. Am Flugplatz lief ununterbrochen Werbung für westliche Luxusgüter.
Vor Jahren hatte ich in Wien einen US-amerikanischen Journalistenkollegen zu Besuch, der über – was sonst – den Siegeszug des Rechtspopulismus in Österreich und Europa eine Reportage machen wollte. Er sagte zu mir: »Ich komme aus New York. Bei euch sind die Straßen sauber, die Gebäude frisch renoviert, die Müllabfuhr funktioniert, die Restaurants sind voll – warum sind alle so unzufrieden? Warum wählt ihr die Rechtsextremen?«
Eine gute Frage. Wenn man hierzulande mit Statistiken und Berichten darauf hinweist, wie vergleichsweise gut es einem in Österreich geht, stößt man oft auf Unglauben und, schlimmer, Unwillen. Eine tiefe Unzufriedenheit und Angst vor der Zukunft scheinen sich bei sehr vielen eingenistet zu haben. Die Zufriedenheit mit den tatsächlich hohen Sozialstandards – bei allen Problemen – geht zurück. Meinungsumfragen bestätigen das in regelmäßigen Abständen immer wieder aufs Neue. Der tägliche Genuss der Medien, besonders der sogenannten sozialen Medien, scheint uns zu bestätigen, dass die Gesellschaft tief gespalten ist. »Shitstorm« könnte zum »deutschen Wort des Jahres« seit mindestens zehn Jahren gewählt werden.
Der große, übergreifende Rückblick über mehrere Jahrzehnte lässt eine gewisse Zersplitterung, einen Zerfall der österreichischen Bevölkerung in verschiedene »Stämme« erkennen. »Identitätspolitik« ist eine Art, diesen Zustand zu definieren.
Die kleinteilige politische Landschaft, wie sie sich vor den Nationalratswahlen 2024 darstellte, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass es kein ausgeprägtes Streben nach Konsens und Zusammenarbeit gibt. Besonders die FPÖ unter Herbert Kickl hatte pauschal alle anderen als »Systemparteien« bezeichnet und »dem System« den Kampf angesagt. Aber auch die anderen – ÖVP, SPÖ, Grüne, Neos –, die zum Teil seit Jahrzehnten zusammengearbeitet hatten (und nicht zum Nachteil des Landes), standen einander mit tiefem Misstrauen gegenüber.
Was steht auf dem Spiel? Zunächst das bislang geltende österreichische Selbstverständnis, dass man Probleme am besten löst; dass es eine gemeinsame demokratische Grundhaltung gibt; dass politische und gesellschaftliche Auseinandersetzungen nur bis zu einem gewissen Punkt gehen dürfen. Dieser Konsens, mit dem gesamten Geflecht aus Institutionen und staatlichen Organen, wurde seit Jahrzehnten tagtäglich gelebt.
Weiters auf dem Spiel steht die mühsam errungene, ohnehin in Österreich nicht völlig umgesetzte, liberale Demokratie mit den Grundideen von Rechtsstaat, Toleranz und Pluralismus. Der autoritären Versuchung würden manche unserer Landsleute gerne nachgeben.
Konkret wäre der FPÖ des Herbert Kickl zuzutrauen, den österreichischen Staat nach dem Kickl-Motto »Machen wir es dem Orbán nach!« umzubauen. Im Juni 2024 gab eine Gruppe um den ehemaligen ÖVP-Spitzenpolitiker und Paradedenker Heinrich Neisser ihren nunmehr letzten »Demokratiebefund« heraus. Weltweit gehe die Zahl der Demokratien zurück. Die Hoffnungen, dass sich mit der Marktwirtschaft auch die Demokratie ausbreiten werde, seien dramatisch enttäuscht worden (siehe China). Der Rückbau der Demokratien zu autokratischen oder halbautokratischen Systemen sei in Österreichs Nachbarschaft (Ungarn, Slowakei) zu besichtigen.
In Österreich selbst sei ein Vertrauensverlust in die Demokratie als Instrument und in die politischen Akteure zu registrieren. Außerdem sei ein Verfall der politischen Kultur und der Diskussionskultur, vor allem in den sozialen Medien, zu konstatieren. Der Politikwissenschaftler Klaus Poier stellt in dem »Demokratiebefund« die »Henne-Ei-Frage«: »Entfernt sich das Volk immer mehr vom demokratischen Prozess und demokratischen Werten und wird damit anfälliger für autoritäre Politik – oder versagt die politische Elite, die die gemeinsame Diskursbasis verloren hat und für autoritäre Politik anfällige Führer ans Ruder bringt, die wiederum Teile des Volkes verführen?«
In der aktuellen politischen Situation Österreichs ist die Antwort wahrscheinlich: beides. Und um die Lage korrekt einzuschätzen, muss man sich mit der realen Situation beschäftigen: Der Chef der FPÖ, Herbert Kickl, kann mit praktisch keiner Führungsfigur einer anderen Partei ein vernünftiges Gespräch führen: mit Kanzler Karl Nehammer nicht, mit SPÖ-Chef Andreas Babler schon gar nicht, noch weniger mit dem Grünen-Obmann Werner Kogler und der Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Entsprechende Zitate auf Wunsch lieferbar.
Kickl kann mit ihnen nicht, und sie können mit Kickl nicht. Zumindest sagte das die gesamte Führungsriege der ÖVP von Kanzler Nehammer abwärts vor der Wahl. Das war eine ziemlich einmalige Situation in der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Das Prinzip des Konsenses und der Kooperation schien im Frühsommer 2024 ausgeschaltet worden zu sein.
In dieser Form gab es das in Österreich noch nicht.
Ich – und mit mir meine Zeitgenossen – erinnere mich an Zeiten, in denen trotz größter weltanschaulicher Gegensätze zumindest ein minimaler gesellschaftlicher Konsens herrschte. Vermutlich war dies ein Erbe der Nachkriegszeit, als man nach den Erfahrungen des Bürgerkriegs in den 1930er-Jahren, des Nationalsozialismus und angesichts des notwendigen Wiederaufbaus Zweckgemeinschaften einging. Diese hatten auch während der ziemlich langen Herrschaft von Bruno Kreisky, der ab 1971 mit dreimaligen absoluten Mehrheiten (1971, 1975, 1979) regierte, Bestand.
Davor und danach wurde Österreich über lange Zeiträume von einer »Großen Koalition« aus ÖVP und SPÖ regiert, die wiederum ihre Absicherung in der sogenannten »Sozialpartnerschaft« hatte. Diese gibt es in Ansätzen heute noch und besteht im Wesentlichen im Zusammenwirken von Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Einst verkehrten die jeweiligen Repräsentanten freundschaftlich miteinander und besiegelten per Handschlag große sozialpolitische Abmachungen. Das gibt es heute nicht mehr.
Ich hatte Gelegenheit, die beiden ikonischen Repräsentanten der Sozialpartnerschaft in ihrer Hochblüte zu erleben: nämlich den Präsidenten der Wirtschaftskammer, Rudolf Sallinger, und sein Gegenüber, den Präsidenten des Gewerkschaftsbundes, Anton Benya. Das war teilweise recht anstrengend, denn die Herren fühlten sich gegenüber Journalisten nicht recht wohl und bestellten sie zu Interviews gerne um sieben Uhr früh, wohl wissend, dass da die meisten Medienleute noch nicht richtig wach waren.
Die Sozialpartner Sallinger und Benya
Beide waren auch persönlich Originale, wie sie heute nicht mehr ins Konzept passen würden: Rudolf Sallinger, wegen seiner rundlichen Gestalt und seinem energischen Auftreten »Kugelblitz« genannt, betonte immer wieder, er sei ja nur »ein einfacher Maurerbub« (er war gelernter Steinmetz). Es gefiel ihm aber sehr, als ich ihn einmal im Kurier einen »asiatischen Despoten« nannte. Er verbreitete tatsächlich Angst und Schrecken unter seinen Untergebenen. Beides, sein Despotentum wie auch seine Fähigkeit, sich blitzschnell auf eine unerwartbare Situation einzustellen, erlebte ich einmal bei einer Reise in die USA zum Zwecke einer Messe in Los Angeles, im Rahmen welcher auch österreichische Produkte vorgestellt wurden. Am Abend gab es einen großen Empfang im exklusiven Beverly Hills Hotel, mit allerlei etwas angejahrten Hollywoodgrößen als Aufputz. Die Narration eines kleinen Österreichfilms hatte der Schauspieler Lloyd Bridges über, der in dem Satirefilm Hot Shots! einen trotteligen US-Präsidenten spielte. Dann richteten sich die Scheinwerfer auf Rudolf Sallinger. Er stand da – und brachte vor der versammelten US-Unternehmerschaft den englischen Satz »Austria salutes California« nicht heraus. Aber bevor sich monumentale Peinlichkeit ausbreiten konnte, sagte Sallinger auf Deutsch, was von einem österreichischen Dolmetscher gleich kongenial übersetzt wurde: »Tut mir leid, ich bin nur ein einfacher Maurerbub, ich kann nicht Englisch, aber ich liebe die USA, und ich liebe Kalifornien!« Der Saal raste vor Begeisterung.
Zwei Tage später konnte Sallinger wieder den Despoten herauskehren. Bei einem Trip in die texanische Öl- und Raumfahrtsstadt Houston hatte der dortige Handelsdelegierte der Wirtschaftskammer (sie hat ein weltweites Netz dieser Interessenvertreter) den schlechten Einfall, Sallinger in ein Fischrestaurant am Hafen zu bringen. Schon die steile Holzstiege verärgerte den bandscheibengeschwächten Präsidenten. Als er dann merkte, dass es Fisch gab, verlangte er ein Steak. Als dieses gebracht wurde, rief er nach den fehlenden Kartoffeln. Worauf sich spontan eine »Potato-Eingreiftruppe« bildete, bestehend aus dem damaligen Wirtschaftsbund-Generalsekretär Wolfgang Schüssel, später Bundeskanzler, und dem damaligen Konsul in Los Angeles Thomas Klestil, später Bundespräsident, die den mitreisenden Mitarbeitern und Journalisten die Kartoffeln für den Herrn Präsidenten vom Teller nahmen.
Sallinger traf sich mit seinem Gegenüber auf der Arbeitnehmerseite, ÖGB-Präsident Anton Benya, gerne auf ein Glas Wein, um die großen Rahmenbedingungen für die österreichische Sozial- und Wirtschaftspolitik auszuhandeln. Meist wurde dabei der Regierung schon ziemlich viel vorgegeben – Löhne, Preise, Beamtengehälter, Sozialgesetzgebung et cetera. Es war im Großen und Ganzen gut für den Staat Österreich und seine Menschen. Es war nicht sehr demokratisch, unter anderem deshalb, weil Benya jahrelang nicht nur Chef der größten Arbeitnehmervertretung, sondern auch Präsident des Nationalrats war.
Heute undenkbar. Der heutige ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian legte mit Amtsantritt sein Abgeordnetenmandat zurück, der heutige Präsident der Wirtschaftskammer, Harald Mahrer, war nie Mitglied des Nationalrats.
Benya liebte die Öffentlichkeit abseits von Gewerkschaftsversammlungen noch weniger als Sallinger. Aber ein Präsident des Nationalrats hatte auch protokollarische Pflichten, und so kam es einmal anlässlich des Besuchs des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi in Österreich zu einem denkwürdigen Zusammentreffen. Gaddafi war zu Beginn der 1980er-Jahre nach Österreich eingeladen worden, weil sich Kreisky davon erstens gute Wirtschaftsbeziehungen mit dem ölreichen Land und zweitens (fälschlich) eine Unterstützung für seine Friedensbemühungen rund um Israel, die Palästinenser und die arabischen Staaten versprach. Beim Bankett zu Ehren von Gaddafi war ich zugegen und konnte beobachten, wie Kreiskys Kopf immer tiefer in seine Hände sank, als Gaddafi in seiner Tischrede mit seiner monotonen Stimme die »blutigen Lakaien und Hunde des amerikanischen Kapitalismus und Imperialismus« verurteilte.
Aber das Protokoll verlangte eben auch, dass der »Revolutionsführer« Gaddafi mit dem Präsidenten des Nationalrats zusammentraf. Der hochgewachsene Wüstensohn begegnete beim Einzug ins Parlament durchaus wohlwollenden Blicken der neugierigen Klub-Mitarbeiterinnen (»Fesch ist er schon …«). Dann wurde ihm von Benya die österreichische Sozialpartnerschaft erklärt und eine entsprechende Schrift überreicht. Die legte der libysche Diktator fast verächtlich zur Seite, holte ein Büchlein heraus und erklärte Benya eine Viertelstunde lang, dass dieses von ihm persönlich verfasste Grüne Buch die Lösung für alle Probleme der Politik und des Lebens sei. Die Demokratie werde durch die »Macht des Volkes« abgelöst, und was die Frauen beträfe: Die Frau sei zart und schön geschaffen, der Mann hingegen stark und widerstandsfähig. Daraus ergäben sich verschiedene Aufgaben der beiden Geschlechter.
Nicht undenkbar, dass damals auch manche österreichische Männer oder sogar Gewerkschafter ähnliche Ansichten hatten, aber das war natürlich mit der sozialdemokratischen Programmatik unvereinbar. Benya war sichtlich erleichtert, als Gaddafi davonzog.
Aber es kamen andere Zeiten: Die Macht des Gewerkschaftsbunds im Sozialgefüge ist seither stark beschnitten worden, schon unter der ersten schwarz-blauen Koalition von Kanzler Wolfgang Schüssel und dann noch einmal massiv unter Kanzler Sebastian Kurz. Krankenkassen wurden zusammengelegt und bei der Gelegenheit auch der Einfluss der »roten« Sozialpartner auf die Institutionen der Sozialversicherung drastisch beschnitten. Große Einsparungen und »Sparen im System«, wie von Kurz & Co. versprochen, hat das nicht gebracht.
Das Ergebnis: gegenseitiges Misstrauen auf allen Ebenen. Entfremdung zwischen den jahrzehntelangen Partnern SPÖ und ÖVP. Zugleich vollzog sich eine bemerkenswerte Entwicklung: Die FPÖ, seit über einem Jahr stabil bei rund 30 Prozent in den Umfragen, setzte das auch erstmals bei bundesweiten Wahlen in die Realität um. Bei den EU-Wahlen im Juni wurde sie Nummer eins.
Zwar nicht wie vorhergesagt mit 30 Prozent, aber immerhin mit deutlich über zwanzig. Das bewog die ÖVP in einer überschießenden Reaktion, gleich das »Kanzlerduell« zwischen Kanzler Karl Nehammer und Herbert Kickl auszurufen. SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler sagte zwar volkstümlich: »Die FPÖ ist packbar«, aber in der veröffentlichten und wohl auch in der öffentlichen Meinung spielte er in dieser Liga nur bedingt mit.
Wahlentscheidend war nach einer Analyse des Foresight-Instituts (Nachfolge des früheren SORA-Instituts) die »Migrationsfrage«. 44 Prozent der Wählerinnen und Wähler diskutierten sie im Wahlkampf sehr häufig, allerdings mit 43 Prozent dicht gefolgt von Sicherheit und Krieg.
Es wurde erwartet, dass sich an diesem »Sorgenpaket« der Bevölkerung, vielleicht noch erweitert durch die Teuerung, nicht so schnell etwas ändern würde. Ein starker Einfluss auf die Wahlen zum Nationalrat wurde angenommen. Vor allem nehme die FPÖ damit Kurs auf die Spitzenposition.
Was bedeutet das für Österreich? Erstmals bei Wahlen auf Bundesebene eine Partei an der Spitze zu haben, die nach allen möglichen Definitionen rechtspopulistisch, nationalpopulistisch, rechtsextrem, extrem rechts oder »rechtsaußen« ist. Man mag über diese Einordnung streiten. Man mag die Tatsache, dass Herbert Kickl selbst gesagt hat, er trage die Bezeichnung »rechtsextrem« wie »einen Orden auf der Brust«, als paradoxe Wendung ins Groteske verstehen. Aber wer genauer hinsieht, erkennt in der Rhetorik und Programmatik der Kickl-FPÖ starke Übereinstimmungen mit den verschiedenen anerkannten Rechtsextremismus-Definitionen:
Nach der Definition des deutschen Politikwissenschaftlers Hans-Gerd Jaschke geht der Rechtsextremismus von »einer natürlichen Ungleichheit der Menschen und der Überlegenheit der eigenen (deutschen) Rasse aus. Er verlangt nach ethnischer Homogenität«. Er gibt der »Volksgemeinschaft« den Vorrang vor dem Individuum. Daher werden die Menschenrechte relativiert. Der Rechtsextremismus lehnt den Pluralismus der Demokratie ab und will das Führerprinzip.
Nach den Kriterien des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW), die wiederum auf den Arbeiten des Klagenfurter Wissenschaftlers Willibald Holzer basieren, ist das zentrale Element rechtsextremer Ideologie der Begriff »Volk« bzw. »Volksgemeinschaft«, wobei primär das deutsche Volk als Bezugsgröße dient. Bedeutung erhält der Einzelne durch seine Verpflichtung auf die Ganzheit des Volkes. Gewünscht wird ein starker Staat, der nach innen und außen verlorene Stärke und Geschlossenheit rekonstruiert. Gefordert wird eine völkisch legitimierte, im Gegensatz zur herrschenden angeblich »wahre« Demokratie sowie die Identität von Volk und Führung.