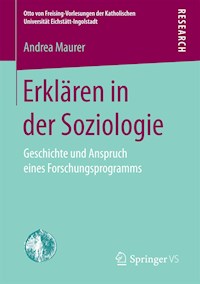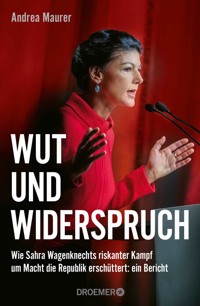
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein brillantes Porträt Sahra Wagenknechts in rasanten Wahlkampfzeiten: Andrea Maurer blickt hinter die Kulissen des BSW Sahra Wagenknecht ist mehr als eine Politikerin – sie ist ein politisches Phänomen. ZDF-Journalistin Andrea Maurer begleitet Sahra Wagenknecht seit 2023 exklusiv und hat Zugang zu ihrem innersten Zirkel. Aus unmittelbarer Nähe gelingt ihr das tiefenscharfe und hochaktuelle Porträt einer Machtpolitikerin, die die Menschen in Deutschland in ihren Bann zieht. So beantwortet diese Politik-Reportage die Frage, die sich jetzt mit aller Macht stellt: Was will Sahra Wagenknecht? »Wer ist Sahra Wagenknecht? Andrea Maurer entschlüsselt die Extrempolitikerin in diesem klugen, unterhaltsamen Buch.« Melanie Amann Andrea Maurer ist dabei, wenn Sahra Wagenknecht und ihre Mitstreiter Wahlkampf auf den Marktplätzen führen. Sie spricht exklusiv mit ihrem Ehemann Oskar Lafontaine, mit neuen und alten Weggefährten sowie mit politischen Gegnern. Die Journalistin spürt dem großen Erfolg nach, den Wagenknecht in Ostdeutschland hat und analysiert, wie Wagenknechts Kompromisslosigkeit ihre größte Stärke und größte Schwäche zugleich ist. »Man legt dieses spannende Buch nicht mehr aus der Hand – so verblüffend ist der Blick hinter die Kulissen des BSW. Andrea Maurer schreibt fair, kritisch und so präzise, dass es sich liest wie ein Roman über unsere Zeit.« Nils Minkmar Mit der Gründung des BSW und den Wahlerfolgen im Jahr 2024 hat Sahra Wagenknecht die deutsche Parteienlandschaft neu geordnet. Sozialpolitisch links, in der Migrationspolitik rechts lässt sich Wagenknecht nicht mehr eindeutig verorten. Die Grünen sind ihr Feindbild, die AfD ist ihr politischer Konkurrent. Wer muss sie am meisten fürchten? Die Bundestagswahl am 23. Februar ist das Ziel, dem sie alles untergeordnet hat. Bei ihrem riskanten Machtkampf kommt niemand an ihr vorbei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Andrea Maurer
Wut und Widerspruch
Wie Sahra Wagenknechts riskanter Kampf um Macht die Republik erschüttert: ein Bericht
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sie ist mehr als eine Politikerin – sie ist ein politisches Phänomen. Mit der Gründung des BSW hat Sahra Wagenknecht die deutsche Parteienlandschaft neu geordnet, manche sagen: zersplittert. ZDF-Journalistin Andrea Maurer begleitet sie und ihr umstrittenes Parteiprojekt seit 2023 exklusiv und hat Zugang zu ihrem innersten Zirkel. Aus unmittelbarer Nähe gelingt ihr so das tiefenscharfe Porträt einer Machtpolitikerin, die die Menschen in Deutschland wie wenige andere in ihren Bann zieht.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
»Gekommen, um zu bleiben.«
1. Anders sein: Das Wagenknecht-Phänomen
Die Außenseiterin
Wut und Widersprüche
Das Medienphänomen
2. Sahra und Oskar: Ein politisches Paar
Die »Frau von Oskar«
Die Kompromisslosen
Populäre Populisten
Aufstehen und Scheitern
3. Ein Bündnis nach ihrem Bild: Die Wagenknecht-Partei
Der Bruch
Der Aufbruch
Partei unter Kontrolle
Das Bündnis
Woher kommt das Geld?
4. Wut und Wahlen: Was will Sahra Wagenknecht?
Erfolge im Osten
Wahlkampf um »Frieden«
Wut auf Wagenknecht
Die Alternative zur Alternative
Verhandeln mit Wagenknecht
Vertrauen in der Krise
Danksagung
Bildteil
Bildnachweis
»Gekommen, um zu bleiben.«
Am Mittwoch, den 13. November 2024, bin ich am frühen Abend mit Sahra Wagenknecht in Berlin Mitte zu einem Gespräch für dieses Buch verabredet. Das Café, in dem wir uns sehen, liegt im Zentrum des Regierungsviertels und ist als Treffpunkt für Politiker, Publizisten und Journalisten bekannt. An diesem Tag kommt es mir vor, als säße Sahra Wagenknecht in einem Bühnenbild jener krisenhaften Lage, in der sich Deutschland gerade befindet. Der Status quo ist ein Land in der Regierungskrise, das auf einen harten Winterwahlkampf und vorgezogene Neuwahlen am 23. Februar 2025 zusteuert. Seit einer Woche hat Deutschland eine rot-grüne Minderheitsregierung, die in ihren letzten Amtstagen um Mehrheiten für letzte Gesetzesprojekte kämpfen muss. Ein ähnliches Ringen um Mehrheiten droht auch in Sachsen und Thüringen nach den Landtagswahlen im September 2024. Seit einer Woche ist zudem klar, dass Donald Trumps Wiederwahl das transatlantische Bündnis auf die Probe stellen wird und die von Russland angegriffene Ukraine nachlassende Unterstützung durch den Westen befürchten muss. Kurzum, es ist eine Zeit schwerer politischer Erschütterungen, und das wird für mich an der Szenerie, auf die ich treffe, erkennbar.
Als ich das Café betrete, sitzt am Tisch in der hinteren Ecke Marco Buschmann, der bis vor einer Woche noch FDP-Justizminister in der gescheiterten Ampelregierung war. Er kommt gerade aus dem Parlament, wo der Kanzler mit seiner Regierungserklärung den Wahlkampf eingeleitet hat. Der Ton war scharf. Am Nachbartisch ist der Unions-Außenpolitiker Norbert Röttgen mit dem Historiker Timothy Garton Ash ins Gespräch vertieft. Sie reden über die Rückkehr Trumps ins Weiße Haus, das dritte Kriegsjahr in der Ukraine und die politische Lage in Deutschland.1 In der Mitte des Raumes sitzt Sahra Wagenknecht im roten Kostümkleid und trinkt grünen Tee mit Honig. Auch sie war eben noch im Parlament und hat in ihrer Rede ein »verunsichertes Land«2 beschworen, dem sie sich selbst als politische Lösung verspricht. Die Chefin des »Bündnisses Sahra Wagenknecht«, das sich Anfang 2024 aufgemacht hat, Mehrheitsverhältnisse zu verändern, scheint ihre Umwelt kaum wahrzunehmen. Auch die anderen grüßen sie nicht.
Sie sei »gekommen, um zu bleiben«3 – das war die Ansage, mit der Wagenknecht Anfang 2024 jene Partei an den Start brachte, in der sie Name, Gesicht und Programm ist: das »Bündnis Sahra Wagenknecht«. Das Gründungsjahr war eine rasante Erfolgsgeschichte. 6,2 Prozent holte das BSW bei der Europawahl; bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst wurde es aus dem Stand zweistellig. Doch schon am Ende des Jahres schwächelt die junge Partei wieder in den Umfragen. Bei der Bundestagswahl 2025 geht es für Wagenknecht nun um alles. Etabliert sich die Partei als Bundestagsfraktion, könnte sie die Tektonik im Parlament und in der Parteienlandschaft verschieben. Scheitert sie an der Fünfprozenthürde, könnte Wagenknechts riskantes Parteiprojekt schon nach einem Jahr wieder Geschichte sein.
Was also will diese Frau, die schon seit über 30 Jahren in der deutschen Politik ist, aber noch nie in Regierungsverantwortung war? Wie weit werden die ersten Erfolge sie tragen? Kann Sahra Wagenknecht die Hoffnungen, die sie bei vielen Menschen geweckt hat, erfüllen? Oder muss Deutschland Angst haben vor der Wut, die sie schürt und dem Widerspruch, den sie einsammelt?
Seit 2020 kenne ich Sahra Wagenknecht. Als Hauptstadtkorrespondentin desZDF bin ich ihr zuerst in ihrer Rolle als Politikerin der Linkspartei begegnet, dann als ihre Spalterin, und schließlich als Gründerin einer linkskonservativen Protestpartei, die ihren Namen trägt. Von den ersten Planungen im Sommer 2023 bis zu den Erfolgen bei den ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst 2024 haben meine Kollegin Christiane Hübscher und ich das Parteiprojekt für die 5-teilige ZDF-Dokumentation »Inside Bündnis Wagenknecht« exklusiv begleitet.4 Was wir dort über ein Jahr vor und hinter den Kulissen erlebt haben, ist Teil dieses Buches. Hinzu kommen zahlreiche weitere Gespräche mit Vertrauten, politischen Weggefährten, Gegnerinnen und Gegnern, die ich bis Mitte Dezember 2024 geführt habe. Auch mit ihrem Ehemann Oskar Lafontaine habe ich mich für dieses Buch unterhalten. Keiner meiner Gesprächspartner hat das Buch vor Erscheinen gelesen oder konnte Einfluss nehmen.
Klar ist für mich: Sahra Wagenknecht ist ein politisches Phänomen, das einerseits aus ihrer Person und Geschichte heraus erklärt werden kann und andererseits untrennbar verbunden ist mit den multiplen Krisen und erschütterten Gewissheiten unserer Zeit. Sie pflegt ein politisches Außenseitertum, zielt aber gleichzeitig ab auf Popularität und Aufmerksamkeit. Sie hat alleine geschafft, wofür andere im modernen Medienzeitalter teure Imageberater engagieren: Sie hat aus ihrer Person eine Marke gemacht und aus dieser Marke eine Partei. Sahra Wagenknecht behauptet, die Stimme einer Bevölkerung zu sein, die sich in der politischen Landschaft der Bundesrepublik nicht mehr repräsentiert sieht. Ihre Gegner dagegen nennen sie die »Putin’sche Stimme in Deutschland«5. Im dritten Kriegsjahr nach Beginn der russischen Großoffensive in der Ukraine hat Wagenknecht das Wort »Frieden« vereinnahmt und Wählerstimmen gesammelt gegen eine weitere militärische Unterstützung des angegriffenen Landes. Bei alldem strebt sie weniger die Macht in Form von Ämtern und realpolitischer Verantwortung an als die Macht über Diskurse. Indem sie mit Wut und Widerspruch die Debatten bestimmt, will sie Mehrheiten verschieben und andere Parteien vor sich hertreiben. Wut und Widerspruch sind dabei aber vor allem Krisensymptome; Lösungen für die großen Zukunftsfragen unserer Zeit sind sie nicht.
Der Tag, der bei meinem Treffen mit Wagenknecht erst eine Woche zurückliegt und sinnbildlich für viele der politischen Erschütterungen steht, ist der 6. November 2024: Am Morgen wird klar, dass Donald Trump als US-Präsident wiedergewählt ist. Am Mittag lässt das BSW in Sachsen die Sondierungsgespräche mit CDU und SPD platzen und das Land steuert auf eine Minderheitsregierung zu. Am Abend feuert Olaf Scholz seinen Finanzminister Christian Lindner, die Bundesregierung ist damit gescheitert. Es ist ein Tag, dessen internationale und nationale Folgen noch lange nachwirken werden. Die Thüringer BSW-Spitzenkandidatin Katja Wolf wird die Ereignisse dieses Tages mir gegenüber später als einen Grund nennen, warum sie den Machtkampf mit Parteichefin Wagenknecht um eine Koalition mit CDU und SPD in Thüringen aufgenommen hat: »Das war ein Tag, wo wir früh wach geworden sind mit dem Trump-Ergebnis, und wo man abends gedacht hat: Was war das für ein Irrsinn heute?«, sagt sie, »Trump in den USA, keine Koalition in Sachsen und das Ampel-Aus in Berlin. Meine Mutter schrieb mir abends: ›Jetzt brauchen wir wenigstens in Thüringen Stabilität.‹ Wir hatten alle das Gefühl, die Welt gerät gerade aus den Fugen. Und für mich war dann klar: Jetzt haben wir tatsächlich noch mal eine andere Verantwortung für Thüringen.«6
Wagenknecht selbst ist am Abend des 6. November 2024 mit ihrem Ehemann nach Berlin zum 70. Geburtstag von Klaus Ernst eingeladen. Oskar Lafontaine hält die Festrede auf den langjährigen politischen Weggefährten, mit dem er 2007 die ostdeutsche PDS und die westdeutsche WASG zur Linken vereinigt hat, der wie er Parteichef der Linken war und nun bayerischer Landeschef und stellvertretender Gruppenvorsitzender in der neuen Partei von Sahra Wagenknecht geworden ist. Lafontaine hat einen anderen Blick auf die Wiederwahl von Donald Trump als Katja Wolf. Er sieht darin ein politisches Anti-Establishment-Phänomen, für das er und seine Frau auch Sympathien haben. Von allen Ereignissen dieses Tages habe ihn Trumps Rückkehr ins Weiße Haus am wenigsten überrascht, sagt Lafontaine zu mir: »Dass Trump gewählt wurde, war für mich keine so große Überraschung, weil ich schon seit Jahren beobachte, dass Trump etwas getroffen hat, was die Arbeiterschaft anspricht. Er ist der Gegenpart zu dem Establishment, das jahrelang regiert hat und das von den Arbeitern als verlogen und abgehoben abgelehnt wird.«7
Ein Gegenpart zum Establishment will auch Sahra Wagenknecht mit ihrer neuen Partei sein und dabei zugleich: eine Alternative zur »Alternative für Deutschland«, zu jener Partei also, die bisher am erfolgreichsten Anti-Establishment-Politik gemacht hat. Die Konkurrenz, in die sie sich so begibt, ist riskant. Sie sucht Auseinandersetzung und Abgrenzung – und es ist noch nicht klar, ob sie Bollwerk gegen die Rechtspopulisten ist, oder deren »Vorfeldpartei.«8
Auch der Soziologe Andreas Reckwitz sieht »einen tiefer liegenden Zusammenhang« im Zusammentreffen von Trumps Erdrutschsieg und dem Ampel-Aus am 6. November 2024: »Den Wahlsieg von Trump kann man nicht mehr als Betriebsunfall der Geschichte abtun. Dahinter steckt eine soziale Dynamik, die sich in anderer Weise auch beim Zusammenbruch der Ampel gezeigt hat.«9 Reckwitz erkennt darin die Folgen von Verlusterfahrungen. Das Versprechen von Wachstum und Fortschritt, so Reckwitz, und damit »die optimistische Grunderzählung der Moderne«, funktioniere nicht mehr: »Die Coronapandemie war für viele mit Traumatisierungen oder einem Verlust an persönlicher Freiheit verbunden, der Ukrainekrieg mit einem Verlust der Sicherheit in Europa, steigende Energiepreise mit Wohlstandsverlusten; die Klimakrise weckt Ängste vor Verlusten durch klimatische Veränderungen oder beim Konsum.«10
Aus all diesen Verlusten, könnte man hinzufügen, hat Sahra Wagenknecht ein Programm gemacht: Corona-Untersuchungsausschuss, Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine, billige Energie, auch aus Russland, und eine politische Aversion gegen die Grünen. Wagenknecht gibt zu verstehen, dass sie die Ängste erkannt hat, und polemisiert gegen die, die jahrelang in politischer Verantwortung waren und die sie auf ihren Wahlplakaten zur Bundestagswahl 2025 nur »die alten Parteien« nennt, die »versagt« hätten und »taub« seien.11 Populisten, so erklärt Reckwitz, hätten im Gegensatz zu SPD, CDU, FDP und Grünen ein Vokabular für die verstörenden Verlusterfahrungen und -ängste. Sie seien »aus der Verlust-Idee geboren.«12 In diesem Sinne hat auch Sahra Wagenknecht ein populistisches Programm.
Das seismografische Gespür für die Ängste und Verlusterfahrungen unserer Zeit teilt Sahra Wagenknecht mit ihrem Ehemann Oskar Lafontaine. Die Gründung des BSW ist meiner Meinung nach auch deshalb ohne einen Blick auf das politische Paar Wagenknecht-Lafontaine nicht zu verstehen. Beide zusammen haben die Parteienlandschaft verändert. Der Soziologe Steffen Mau formuliert es mir gegenüber so: »Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine sind prägende Gestalten in der Parteiengeschichte, beide übten auch eine destruktive Wirkung auf das Parteiensystem aus. Wir kommen ja aus einer geordneten Welt mit großen Volksparteien, die auch große Milieus integriert haben. Und jetzt haben wir doch eine Aufspaltung, eine Zerfaserung des Parteiensystems mit kleineren Parteien, durchaus auch mit mehreren Parteien und auch eine größere Beweglichkeit der Wählerschaften.«13 Das Ehepaar hat die Parteienlandschaft links der Mitte durch Parteiaustritte und Parteigründungen verändert. Mit dem BSW versuchen sie nun, die Mitte von links und rechts gleichermaßen in die Zange zu nehmen. Die Repräsentationslücke, die Sahra Wagenknecht dabei für ihre neue Partei sieht, hat sich auch deshalb aufgetan, weil passiert ist, was der Politologe Frank Decker schon 2018 beobachtete: Durch den Drang der Volksparteien zur Mitte unter Vernachlässigung des eigenen Markenkerns konnte »ein Vakuum an den rechten und linken Rändern des Parteiensystems entstehen, in das kleinere Parteien erfolgreich hineinstoßen konnten«.14
Noch steht das BSW am Anfang seiner Geschichte. Ein Jahr lang haben Sahra Wagenknecht und ihre Mitstreiter Erfolge gefeiert, aber auch Rückschläge und harte Kritik erleben müssen. Es ist zu früh für eine Einschätzung, wo das BSW in einem Jahr stehen wird. Aber Wagenknecht hat mit ihrer Partei etwas in Bewegung gebracht, das nicht nur mit ihrer Person und politischen Sozialisation zu tun hat, sondern auch mit der Zeit, in der wir leben, mit politischen Umbrüchen und gesellschaftlicher Verunsicherung: Die Geschichte Sahra Wagenknechts und des BSW ist nicht zuletzt die Geschichte einer Bundesrepublik, in der die politische Mitte in die Krise geraten ist und sich mit Wut und Widerspruch Wahlen gewinnen lassen.
Berlin, 3. Januar 2025
1. Anders sein: Das Wagenknecht-Phänomen
Sahra Wagenknecht sitzt in einem grauen Pullover vor dem Spiegel, der Rücken gerade, der Blick konzentriert. Mit wenigen Handgriffen flicht sie die langen dunklen Haare zu einem französischen Zopf, den sie am Kopf feststeckt und mit Haarspray fixiert. Keine Strähne bleibt ungeordnet. Zehn Minuten braucht sie für diese Frisur, die den ganzen Tag hält und die den Menschen Sahra Wagenknecht in die politische Figur verwandelt, die Deutschland seit über drei Jahrzehnten kennt. Die Frisur ist ihr Markenzeichen, sie trug sie als junge Politikerin, die Stalin und die DDR verharmloste, sie trug sie als Galionsfigur der Linken, die später vielen Genossen zu rechts wurde, und sie trägt sie auch heute als unbestrittene Autorität einer maßgeschneiderten Partei, der sie ihren Namen gegeben hat: »Bündnis Sahra Wagenknecht«.
Ich habe diese Szene festgehalten bei Dreharbeiten für das ZDF.15 Wenn von der Kontrolle die Rede ist, die Wagenknecht ungern abgibt, gehört meines Erachtens auch ihr Äußeres dazu. »Menschen lesen halt nicht Parteiprogramme als Erstes«, erklärt sie mir, während sie in den Spiegel schaut und sich die Frisur richtet, die in der öffentlichen Wahrnehmung ebenso zu ihr gehört wie die konservativen Kostüme: »Bei mir wissen die Menschen, wofür ich stehe, und sie können damit auch sehen […], dass die Partei auch für das steht, was ich verkörpere. Und deswegen wissen sie, ob sie das wählen wollen oder nicht. Das ist natürlich schon ein großer Vorteil.«16 Der Effekt dieser Imagekontrolle erinnert an das »Sie kennen mich«, mit dem Angela Merkel für sich und ihre Politik warb. Es geht um Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Markenbildung. Sahra Wagenknecht hat aus ihrer Person eine politische Marke gemacht – und aus dieser Marke ein Programm und eine Partei. Wie nur wenige andere beherrscht sie das Selbstmarketing in der Mediengesellschaft. Inzwischen gibt es auf der Internetseite ihrer Partei sogar Wagenknecht-Merchandising zu kaufen: Tassen, Taschen, Buttons, T-Shirts und Pullover, wahlweise mit dem Logo einer Friedenstaube oder einem Wagenknecht-Porträt.17
Ich habe Sahra Wagenknecht unzählige Male getroffen, in Berlin, im Saarland und während des Wahlkampfs für die Europawahlen und die ostdeutschen Landtagswahlen. Meine Gespräche mit ihr sind vergleichsweise offen. Sie versucht nie, Nähe oder Verbindlichkeit herzustellen, und wahrt von sich aus die Distanz, die auch für mich als politische Beobachterin unerlässlich ist. Wer also ist »Sahra Wagenknecht«? Das scheint manchmal offensichtlich, dann wieder rätselhaft. Für dieses Buch habe ich meine Beobachtungen gesammelt – um sie soll es im Folgenden gehen.
Die Außenseiterin
Sahra Wagenknecht ist eine Außenseiterin. Das ist das Bild, das sie selbst von sich pflegt und das sie auch zu ihrem politischen Programm gemacht hat. In ihrem Bestseller Die Selbstgerechten, einer Abrechnung mit der »Lifestyle-Linken«, schreibt sie 2021 über »Außenseiter«, die »gewinnen«.18 Sie meint damit die britische Labour-Partei unter Jeremy Corbyn, die dänischen Sozialisten, den französischen Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon und die italienische Fünf-Sterne-Bewegung. Es sind Parteien und Politiker, die mit Anti-Establishment-Politik nach Wagenknechts Geschmack erfolgreich geworden sind: »Es waren also die Außenseiter, politische Kräfte, die sich vom Weltbild der Lifestyle-Linken zumindest in wichtigen Punkten verabschiedet haben, die beim Wähler punkten konnten«,19 so Wagenknecht. Widerspruch gegen den sogenannten Mainstream und Wahlerfolge sind zwei Dinge, die sie antreiben, kurzum: populärer Populismus. Dabei ist Wagenknecht, die seit mehr als dreißig Jahren in der Politik steht, selbst Teil jenes Systems, das sie ablehnt. In einem unserer Gespräche habe ich sie nach diesem Widerspruch gefragt. »Ich bin natürlich als Berufspolitikerin auch Teil des Systems«, antwortet sie, »aber ich bin nicht Teil dieser Politik, weil ich diese Politik immer kritisiert habe.«20 Ihr Selbstverständnis ist das einer Oppositionellen, ob im politischen System oder in der PDS/Linken. Die innerparteiliche Opposition gibt sie erst mit Gründung ihrer eigenen Partei auf, denn hier ist sie das Programm.
Von Kindheit an ist Sahra Wagenknecht anders und möchte auch anders sein. Ihr Biograf Christian Schneider schildert sie als ein Kind mit einer »fast autistische[n] Tendenz«21, das seit seinem vierten Lebensjahr seine Zeit lieber mit Büchern als mit Menschen verbringt. Manchmal auch, so sagt es Wagenknecht selbst, war sie »eine kleine Terroristin«22, die sich zum Beispiel entschieden dagegen gewehrt hat, in die Kinderkrippe zu gehen.
Sahra Wagenknecht wiederholt oft die gleichen Details ihrer Biografie, und man kann davon ausgehen, dass sie genau überlegt, was sie preisgibt, um ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit von sich zu zeichnen. In Umrissen sieht es so aus: Sie wächst als Kind einer alleinerziehenden Mutter größtenteils bei den Großeltern in Jena auf. Zentral ist das schmerzhafte Fehlen des Vaters. Ein Iraner, der Ende der 1960er-Jahre in Westberlin studiert und sie und die Mutter mit 24-Stunden-Visa im Osten besucht. Irgendwann kehrt er von einer Reise in den Iran nicht mehr zurück. Seine Tochter ist da erst drei Jahre alt. Was ihr vom Vater bleibt, sind das »andersartige« Äußere, für das sie in der Schule gehänselt wird, und das ›h‹ an ungewöhnlicher Stelle in ihrem Vornamen, auf das sie Wert legt. Ihr bleibt auch eine Erinnerung: sie auf den Schultern des Vaters. Und ihr bleibt das Gefühl, verlassen worden zu sein: »Natürlich ist das ein Verlustschmerz, den man mit ins Leben nimmt. […] Wenn der Vater nicht da ist, muss man sich selbst beschützen. Es gibt niemanden mehr, der einen auf den Schultern trägt, wo ein Kind sich groß und sicher fühlt. Man erlernt früher Verantwortung, wenn man ohne Vater aufwächst.«23 Es ist nicht leicht, Sahra Wagenknecht heute auf ihren Vater anzusprechen. Lange glaubte sie, er sei in den Folterkellern des iranischen Regimes gestorben. Vielleicht ist das ihre Erklärung dafür, dass er sich nicht mehr meldet. Inzwischen ist wohl klar, dass er noch lebt, mehr ist von ihr nicht zu erfahren. Ich erlebe einmal, dass sie regelrecht versteinert, als ich sie danach frage. Aber sie erzählt immer wieder, wie sehr die Vaterlosigkeit sie geprägt hat. Diese biografische Erfahrung teilt sie mit ihrem späteren Ehemann Oskar Lafontaine (siehe Kapitel 2).
Das Außenseitertum zieht sich durch ihr Leben. Mit 13 Jahren wird sie Punk – was sie in der DDR als »politisch unzuverlässig«24 gelten lässt. Mit der Musik kann sie weniger anfangen als mit dem Anderssein. Mit 16 entdeckt sie Goethe und beginnt sich zu kleiden wie in der Weimarer Klassik. Sie liest den Kanon der Aufklärung, des Marxismus und der Frankfurter Schule: Kant, Hegel, Marx, Lukács, Horkheimer, Adorno und Marcuse. Auch am 9. November 1989 sitzt Sahra Wagenknecht lesend in ihrer Studentenwohnung in Berlin-Karlshorst, die bis heute ihr Zweitwohnsitz ist. Erst rund zwei Monate später macht sie sich auf den Weg in den Westen. Aber nicht aus Neugier auf das, was bislang hinter der Mauer lag, sondern weil sie ein Buch aus der Amerika-Gedenkbibliothek braucht.25
Auch heute, als Parteigründerin und -chefin, macht Wagenknecht im Gespräch mit mir keinen Hehl daraus, dass sie sich dieses Leben voller Organisationsarbeit, Besprechungen und innerparteilich zu moderierenden Konflikten auf Dauer nicht vorstellen kann: »Das ist in dieser Ausnahmesituation okay. Jetzt ist die Priorität, die Partei auf die Bahn zu bringen und dass sie gut läuft. Aber es ist natürlich auf Dauer nicht das Modell von Politik, das ich leben möchte, denn dann würde ich meine Substanz verlieren.«26 Lesen, recherchieren, denken – das will sie eigentlich. Es ist absehbar, dass sich Sahra Wagenknecht von der Spitze ihrer Partei wieder zurückziehen wird (siehe Kapitel 4).
Wut und Widersprüche
Politisch ist der Mauerfall ein Wendepunkt in Sahra Wagenknechts Leben, anders allerdings als bei vielen ihrer Zeitgenossen. Wagenknecht, die in der DDR nicht studieren durfte, unter anderem weil sie sich offenbar geweigert hatte, in einem Militärlager im Gleichschritt zu gehen,27 tritt noch kurz vor dem Ende des real existierenden Sozialismus in die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) ein. Bis zur Jahrtausendwende verteidigt sie trotzig das untergegangene Land, während sie das neue, vereinigte demokratische Deutschland bekämpft wie einen Klassenfeind: »Ich hätte natürlich tausend Mal lieber mein Leben in der DDR verbracht, als in dem Deutschland, in dem ich jetzt leben muss«,28 sagt sie 1994. Als sie Mitte der 1990er-Jahre eine Bluse spendet, um Geld für das ehemalige FDJ-Blatt Junge Welt zu sammeln, wird sie gefragt, wie viele Blusen sie für die Wiederauferstehung der DDR hergeben würde: »Natürlich alle, die ich habe«, war ihre Antwort.29
Die Verherrlichung der DDR erklärt Wagenknecht später als »absurde Trotzreaktion«: »Ich war einfach empört über die vielen Opportunisten, die mir am Tag vor der Mauer vor dem Mauerfall erklärt haben: Wer für den Frieden ist, der muss für Erich Honecker sein. Und am Tag nach dem Mauerfall waren sie also mit fliegenden Fahnen für die CDU.«30 In ihren Augen ist der Auftrag eines sozialistischen Staates, den Kapitalismus zu beseitigen, und dieser Auftrag endet für sie nicht mit dem Untergang der DDR. Den Westen hält sie für das grundfalsche System.
Ihre ideologische Radikalität in Kombination mit sozialistischen Idealen und einem bedingungslosen Nonkonformismus lassen Sahra Wagenknecht in den 1990er-Jahren auch Stalin verharmlosen. Jenen sowjetischen Diktator, dessen Deportationen und Zwangsumsiedlungen Millionen Menschen Tod und Leid gebracht haben. In einem Aufsatz von 1992 schreibt sie: »Und was immer man – berechtigt oder unberechtigt – gegen die Stalin-Zeit vorbringen mag, ihre Ergebnisse waren jedenfalls nicht Niedergang und Verwesung, sondern die Entwicklung eines um Jahrhunderte zurückgebliebenen Landes in eine moderne Großmacht während eines weltgeschichtlich einzigartigen Zeitraums.«31 Nicht dem Stalinismus, sondern dem Opportunismus und einer »reformistischen Sozialdemokratie«32 gibt sie die Schuld am Scheitern der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Sahra Wagenknecht ist Anfang zwanzig, als sie diese Sätze schreibt, und verweist später darauf, dass sie von »Trotz und Wut« getrieben war – um im selben Atemzug zu betonen, dass diese Gefühle nicht unbegründet waren: »Allerdings standen am Anfang dieses Artikels auch drei in Trotz und Wut über rechte Geschichtsverfälschung hingeworfene Sätze zu Stalin, die nicht minder einseitig waren als die Geschichtsschreibung des Mainstreams, nur mit umgekehrtem Vorzeichen«, so Wagenknecht 2009 auf einer Geschichtskonferenz.33 Sie distanziert sich nicht direkt von dem, was sie damals geschrieben hat, spricht nun aber davon, dass ihr Gespräche mit Opfern aus Stalins Lagern dabei geholfen hätten, »von Vereinfachungen wegzukommen«.34
Was sie schon damals antreibt, beobachte ich auch heute bei ihr: Sobald sie in einem herrschenden System Konformismus vermutet, stellt sie sich auf die andere Seite. Sie ist das, was im Englischen »Contrarian« genannt wird: eine Querdenkerin im ursprünglichen Sinne des Wortes. Sie behauptet ihre Meinung dabei mit einer Absolutheit, die einen Irrtum kaum in Betracht zieht.
Einer von Sahra Wagenknechts berühmtesten Irrtümern ist, dass sie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine für ausgeschlossen hielt. Noch am 20. Februar 2022, vier Tage vor Putins Invasion, behauptet sie bei Anne Will, dass ein russischer Einmarsch in die Ukraine »herbeigeredet« werde: »Russland hat faktisch kein Interesse, einzumarschieren«, sagt sie, denn Putin sei ein kühl kalkulierender Machtpolitiker, der sich immer relativ berechenbar verhalten habe, und kein »durchgeknallter Nationalist, der sich berauscht, Grenzen zu verschieben«.35 Wenn das so wäre, dann wäre »die Diplomatie hoffnungslos verloren«.36 Später muss sie ihren Irrtum einräumen. »In der Einschätzung seiner Person und Berechenbarkeit habe ich mich leider geirrt«, bekennt sie in der WELTeinen Tag nach dem russischen Einmarsch.37 Zwar hat sie den Krieg inzwischen mehrfach als »völkerrechtswidrig« verurteilt, doch eine militärische Unterstützung der angegriffenen Ukraine lehnt sie von Anfang an ab und pocht nun auf jene »Diplomatie«, die sie noch vier Tage vor dem russischen Großangriff bei Anne Will im Kriegsfall für »hoffnungslos verloren« hielt.
Obwohl die Frage von Krieg und Frieden heute Teil ihres politischen Markenkerns ist, war Sahra Wagenknecht noch nie in der Ukraine. Sie habe das einmal erwogen, berichtet sie mir, »allerdings muss ich ehrlich sagen, spätestens zu dem Zeitpunkt, als Herr Melnyk [Andrij Melnyk war bis Oktober 2022 ukrainischer Botschafter in Deutschland, A.M.] mir quasi per Twitter vermittelte, dass man mich eigentlich umbringen soll, würde ich das nicht mehr machen«.38