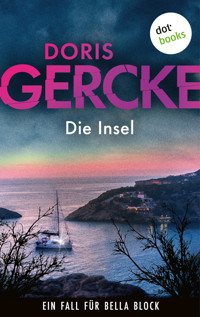Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Bella Block
- Sprache: Deutsch
Der siebte Fall der Kultermittlerin Bella Block jetzt neu im eBook!In einer Gemeinde, in der Moral keine Rolle mehr spielt … Die junge Christa Böhmer ist seit Monaten spurlos verschwunden – ihr letztes Lebenszeichen erreichte ihre Mutter aus einer kleinen Stadt in Vorpommern … Die Hamburger Privatdetektivin Bella Block wird von der verzweifelten Frau mit der Suche nach der Vermissten beauftragt. Schon bald entdeckt Bella in der Gemeinde eine verworrene Welt, in der die Grenzen zwischen Moral und Gier verschwimmen: Sie stößt auf einen skrupellosen Gastwirt und seine dunklen Geheimnisse sowie die fast vergessenen Sünden aus der nationalsozialistischen Vergangenheit. Doch der rätselhafte Fall wird zunehmend persönlicher für Bella: Hin- und hergerissen zwischen ihrem Pflichtgefühl und dem Wunsch nach Gerechtigkeit gerät sie in einen Strudel aus Ereignissen, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint … Der siebte Fall der legendären Kommissarin Bella Block, der unabhängig gelesen werden kann – ein bitterböser Kriminalroman für die Fans von Andrea Camilleri.In Band 8 begibt sich Bella Block unter der heißen Sonne Andalusiens auf die Suche nach einem Auftragskiller …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die junge Christa Böhmer ist seit Monaten spurlos verschwunden – ihr letztes Lebenszeichen erreichte ihre Mutter aus einer kleinen Stadt in Vorpommern … Die Hamburger Privatdetektivin Bella Block wird von der verzweifelten Frau mit der Suche nach der Vermissten beauftragt. Schon bald entdeckt Bella in der Gemeinde eine verworrene Welt, in der die Grenzen zwischen Moral und Gier verschwimmen: Sie stößt auf einen skrupellosen Gastwirt und seine dunklen Geheimnisse sowie die fast vergessenen Sünden aus der nationalsozialistischen Vergangenheit. Doch der rätselhafte Fall wird zunehmend persönlicher für Bella: Hin- und hergerissen zwischen ihrem Pflichtgefühl und dem Wunsch nach Gerechtigkeit gerät sie in einen Strudel aus Ereignissen, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint …
eBook-Neuausgabe Juli 2025
Dieses Buch erschien bereits 1994 unter dem Titel »Ein Fall mit Liebe« bei Hoffmann und Campe.
Copyright © der Originalausgabe 1994 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Jan Miko, Fogg.Design
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (fb)
ISBN 978-3-98952-753-9
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Doris Gercke
Zeit der Niedertracht
Ein Fall für Bella Block 7
dotbooks
Ungestorben aber
die finstere Zeit, umher
geht meine Sprache und ist rostig von Blut.
Johannes Bobrowski
Kapitel 1
Ich weiss nicht, wie Sie darüber denken, aber manchmal kommt es mir vor, als hätten unsere Eltern uns zu etwas Besonderem erzogen, sagte die Frau.
Mit einer Gabel, deren mittlere Zinken zusammengebogen waren, versuchte sie, ein Salatblatt aufzuspießen. Es gelang ihr nicht, und sie blickte auf. Bevor sie ihr Gegenüber ansah, fiel ihr Blick auf eine Reihe von Rehgeweihen, die an der Wand angebracht worden waren. Es waren sieben, und sie waren alle gleich klein.
Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick, sagte der Mann, zu dem sie gesprochen hatte. Er stand auf und verließ den Raum. Die Frau sah ihm nach, bevor sie sich wieder dem Salatblatt zuwandte. Sie legte das Messer und die verbogene Gabel sorgfältig über das Blatt, die Messerkante nach außen, und schob den Teller ein Stück von sich.
Ein Bier trinke ich noch, dachte sie. Er wird nichts mehr sagen. Aber jetzt einfach Weggehen, wäre dumm.
Sie trank das Glas leer und hielt es dem Mann entgegen, als er wieder zur Tür hereinkam. Die Tür war eine Schwingtür, und sie schlug heftig hinter ihm hin und her. Ein Bier noch, sagte sie lächelnd.
Der Mann kam zu ihr an den Tisch und nahm ihr das Glas ab, bevor er hinter den Tresen ging und sich an der Zapfsäule zu schaffen machte.
Ihr Vater war ein wunderbarer Mann, sagte er, während er darauf wartete, dass der erste Schaum im Glas zusammensank. Auf Ihre Eltern können Sie stolz sein. Ihre Mutter hat geholfen, wo sie nur konnte. Und Ihr Vater war wirklich ein wunderbarer Mann. Wissen Sie eigentlich, nein, das können Sie wohl nicht wissen, was sein Lieblingsgetränk war? Apricot Brandy! Ja, da staunen Sie, was?
Wir größeren Jungens durften manchmal an seinem leeren Glas nuckeln. Warten Sie, wir trinken ein Glas auf sein Wohl, während das Bier einläuft.
Einen Augenblick lang war nur das Ticken der Uhr über der Schwingtür zu hören. Die Uhr sah aus, als sei sie eine Kuckucksuhr. Die Zeiger zeigten genau acht Uhr an, aber die Frau wartete vergeblich darauf, dass sich die kleine Tür unter dem Zifferblatt öffnete. Wahrscheinlich war der Mechanismus kaputt.
So kaputt wie alles hier, dachte die Frau.
Der Mann kam hinter dem Tresen hervor und brachte das gefüllte Likörglas an ihren Tisch. Er stellte es vor sie hin, blieb stehen und sah von oben auf sie herab.
Weshalb setzen Sie sich nicht, sagte die Frau. Es ist so angenehm, von alten Zeiten zu reden.
Sie griff nach dem Glas und nahm einen kräftigen Schluck.
Mit dir nicht, du alte Hexe, dachte der Mann, während er zusah, wie die Frau einen sehr kurzen Augenblick nach Luft rang und dann auf der Bank vor ihm zusammensank. Er hatte noch nie einen Menschen getötet, und er war nicht sicher, wie lange er warten musste, bis die Frau wirklich tot war. Also blieb er stehen und zählte, ohne die Lippen zu bewegen, bis hundert, bevor er begann, den Oberkörper der Toten aus der Bank zu ziehen. Die Frau war zu Lebzeiten leicht gewesen, und noch hatte der Tod sie nicht schwerer gemacht.
Jetzt hab ich tatsächlich eine Leiche im Keller, dachte der Mann, während er den Körper der Toten durch die Schwingtür zog. Bisher hatte es die Leiche im Keller nur in seinen Träumen gegeben.
Kapitel 2
Bella fuhr langsamer, entdeckte eine Parklücke und lenkte den Porsche nach rechts. Sie parkte ihn sorgfältig ein, beobachtet von zwei Zwölfjährigen, die das alte Modell bewunderten. Sie stellte die Zündung ab, und die Kassette sprang heraus. Sie horchte den Versen von Alexander Block nach, die sie gerade gehört hatte.
Ich lief in bunten Lappen herum
Und trug eine hässliche Maske.
Andauernd lachte ich auf den Festen
Und erzählte Geschichten.
Es war ihm wohl nicht gut gegangen, ihrem Großvater, als er das geschrieben hatte. Der Dichter als Narr.
Sie stieg aus und schloss den Wagen ab. Die beiden Jungen waren verschwunden. Auf dem Straßenschild neben dem Wagen stand: Porschestraße.
Sie hatte einen Teil des Nachmittags in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel verbracht, die Stadt und das Lessinghaus angesehen und nach dem sorgfältig restaurierten 18. Jahrhundert, das sie gerade verlassen hatte, erschien ihr der Anblick der Wolfsburger Innenstadt brutaler, als er vielleicht wirklich war.
Nach ein paar Schritten erreichte sie die strahlend beleuchtete Beton-Fußgängerzone. Sterne hingen über ihrem Kopf. Aus verborgenen Lautsprechern waren Weihnachtslieder zu hören. Es war kurz nach sechs Uhr, und dafür, dass die Läden um diese Zeit schlossen, waren entschieden zu viele Menschen unterwegs. Während sie langsam weiterging, eine Kneipe suchend, wurde sie ein paarmal angerempelt. Sie setzte sich in das erste Café, das sie sah, fühlte sich hinter den Scheiben in Sicherheit und bestellte Glühwein.
Vor den Scheiben wurden es immer mehr Leute. Neben ihr am Tisch saß ein Pärchen, Mann und Frau im Partner-Look. Draußen liefen ähnliche Pärchen herum, meist zwischen dreißig und vierzig, teuer und geschmacklos gekleidet, mit gierigen Gesichtern. Manche hielten einander an den Händen gefasst, um sich im Gewühl nicht zu verlieren. Ein Trupp brüllender Kahlköpfe zog vorüber. Hinter ihr, in einer Ecke des Cafés, erzählte jemand einen Witz, in dem ein »Ossi« von einem »Wessi« betrogen wurde, ohne es zu merken. Der Witz war lang und dumm, ebenso wie das anschließende Gelächter. Als die Serviererin mit dem Glühwein kam, sah Bella zwei Paaren zu, die sich gegenseitig von einem Schaufenster mit Spielwaren zu verdrängen suchten. Kinder sah sie nicht. Die Serviererin stellte das Getränk auf den Tisch. Es duftete plötzlich nach Zimt und Orangen.
Riecht ja wunderbar, sagte Bella.
Ist unsere Spezialität, antwortete die Serviererin und wandte sich zum Gehen.
Sagen Sie, was ist hier los, fragte Bella, ich meine, weshalb sind so viele Leute unterwegs?
Die Frau drehte sich noch einmal um. Auch das Paar vom Nachbartisch sah auf.
Wieso, sagte die Serviererin, es ist doch langer Donnerstag. Sie hätte auch sagen können: Wissen Sie nicht, dass die Welt rund ist? Der Ton wäre der gleiche gewesen.
Bella sah wieder auf die Einkaufsstraße. Das Gewühl war so dicht, dass es ihr schwerfiel, einzelne Frauen oder Männer zu beobachten. Die Stimmung schien so aggressiv, dass sie froh war, durch die Glasscheibe von den Menschen getrennt zu sein. Wölfe, dachte sie, die Wolfsburger reißen sich gerade ihren Wohlstandsanteil aus den Läden. Dabei zuzusehen war kein Vergnügen.
Sie trank den Glühwein zu schnell, verbrannte sich die Zunge, legte Geld auf den Tisch und verließ das Café. Draußen empfingen sie Weihnachtslieder. Sie beeilte sich, das Auto zu erreichen. Als sie den Wagen anließ, begann ein Sprecher, die Themen der Abendnachrichten vorzulesen. Im Kommentar würde sich ein Journalist mit der Einführung der Vier-Tage-Woche bei VW in Wolfsburg befassen. Bella stellte das Radio ab. Vor ein paar Tagen hatte Olga sie angerufen, zu früh und zu laut, wie üblich.
Bella, mein Kind, stell dir vor, was ich eben gelesen habe: Die Nazis haben diesem Porsche neunzehnhundertsiebenunddreißig die »Goldene Fahne für Musterbetriebe« überreicht!
Bella, verschlafen und ärgerlich, hatte nicht verstanden, weshalb Olga sie deshalb wecken musste. Es blieb ihr trotzdem nichts anderes übrig, als Olga zuzuhören.
Überleg doch mal: VW damals Musterbetrieb, heute Musterbetrieb!
Mutter, wovon sprichst du?
Sag mal, liest du keine Zeitungen? Also, sie machen doch jetzt die Vier-Tage-Woche, aber ohne Lohnausgleich. Die Gewerkschaft kriecht zu Kreuze, und die VW-Belegschaft geht wieder mit gutem Beispiel voran.
Bella hatte »bis später« gemurmelt und den Hörer aufgelegt. Jetzt fiel ihr das Gespräch wieder ein. Wahrscheinlich hat Olga recht, dachte sie, mustergültiger kann zurzeit wirklich niemand von machen, wie man mit dem Trick der Vier-Tage-Arbeits-Regelung eine große Belegschaft bei der Stange hält.
Sie fuhr an und war froh, als sie die Landstraße erreicht hatte. Es waren nur wenige Autos unterwegs, erst in zwei Stunden würde der Verkehr wieder zunehmen.
Was werden die Leute tun, wenn sie mehr freie Zeit und weniger Geld haben, überlegte sie. Darüber müsste sich mal jemand Gedanken machen.
Im Schnee am Straßenrand standen die gläsernen Augen eines Fuchses. Sie fuhr langsamer, stellte das Radio an, schob die Kassette zurück und hörte Willy zu, die Gedichte von Alexander Block vortrug.
Wilhelmina van Laaken, genannt Willy, war Bellas Sekretärin, Mitarbeiterin, Diskussionspartnerin, Putzfrau – sie war unentbehrlich und fühlte sich auch so. Bella hatte sie über eine Vermittlung studentischer Arbeitskräfte kennengelernt. Willy studierte Astrophysik und hörte nebenbei Vorlesungen über Literatur, im Augenblick gerade bei den Slawisten. Sie war klein, blond, pummelig und ungeheuer lebendig und klug. Die Kassette war eine Überraschung »für unterwegs«. Willy gab sich beim Sprechen große Mühe, und Bella lächelte. Sie war froh, bald zu Hause zu sein.
Kapitel 3
Seit Olga, Kommunistin und hoch in den Achtzigern, eingesehen hatte, dass sie den Sieg des Sozialismus nicht mehr erleben würde, stand sie morgens nicht mehr um sieben Uhr, sondern erst um acht auf. Der Entschluss war nicht plötzlich gefasst worden, sondern das Ergebnis längerer sorgfältiger Überlegungen. Sie hatte beschlossen, der großen Müdigkeit, die sie, wie viele andere, nach dem Zusammenfallen der DDR überkommen hatte, nicht nachzugeben. Das einzige Zugeständnis, das sie zu machen bereit war, hatte darin bestanden, morgens eine Stunde später aufzustehen.
Es war ihr nicht schwergefallen, sich zu beschäftigen, auch als die Genossen immer weniger wurden und sie schließlich das Parteibüro aufgeben mussten, weil die Zuschüsse aus dem befreundeten Ausland ausblieben. Als Beschäftigung hatte sie allerdings nicht die üblichen Tätigkeiten gewählt, mit denen Frauen im Alter gemeinhin ihre Zeit totschlagen.
Ich bin keine Köchin und keine Putzfrau, pflegte sie Bella zu antworten, wenn die, was hin und wieder vorkam, über die Unordnung in der Wohnung ihrer Mutter oder deren Vorliebe für Pommes frites mit Mayonnaise ein Wort verlor.
Früher hat sie ihre Unordnung mit der notwendigen Arbeit für die bevorstehende Revolution begründet, dachte Bella, lächelte und schwieg. Sie bewunderte Olgas Fähigkeit, flexibel auf die Veränderung der Welt zu reagieren, ohne ihre Prinzipien aufzugeben.
Olga hatte ihren Glauben an den Sieg des Sozialismus nicht verloren. Nur über den Zeitraum, der dazu noch durchmessen werden musste, machte sie keine genauen Angaben mehr. Sie wurde auch von niemandem mehr danach gefragt. Regelmäßig traf sie sich mit einigen alten Freunden. Gemeinsam analysierten und kritisierten sie, was das Zeug hielt. Aber auch in dieser Runde war niemand mehr bereit, Prognosen abzugeben, wann die ersehnte grundsätzliche Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse Wirklichkeit werden würde.
Eine Zeit lang waren sie ohne Anleitung von oben geblieben, als die Strukturen der Partei zerfielen und sich niemand darum kümmerte, was die wenigen noch existierenden Mitglieder dachten, geschweige denn zu denken hatten. Trotzdem war Olga immer sehr gut über innen- und außenpolitische Ereignisse informiert gewesen und sicher, wie sie zu beurteilen waren. So hatte es sich ergeben, dass Olga bei diesen Zusammenkünften der Vorsitz zugefallen war.
Sie hatte ihre neue Tätigkeit mit Vergnügen aufgenommen. Mit diesem Amt hing zusammen, dass sie sich nicht langweilte. Olga las Zeitungen und wertete sie aus. Die Unordnung, die Bella gelegentlich kritisierte, hing damit zusammen, dass sie ein ungewöhnliches System entwickelt hatte, die Ausschnitte, die ihr wichtig erschienen, zu archivieren. Sie hatte sich, Sonderanfertigung eines mit ihr befreundeten Mannes, der sich nach einigen Jahren erfolgloser politischer Arbeit auf seine eigentlichen Fähigkeiten besonnen hatte und wieder Tischler geworden war, über zwei Wände ihres Wohnzimmers Archivkästen bauen lassen. Die Anregung dazu hatte sie aus einem Buch über Peter Weiss entnommen, dessen Werk sie bewunderte. Der Bau der Kästen war so teuer geworden, dass Olga sich zu der Bemerkung veranlasst sah: Bella, mein Kind, ich werde dir kaum Bargeld hinterlassen können.
Bevor die Ausschnitte in die sorgfältig beschrifteten Kästen gelangten, hatten sie die Zwei-Monats-Prüfung zu überstehen, die Anlass für die Unordnung in Olgas Wohnung war. Die Ausschnitte wurden, nach Themen sortiert, auf jeder sich anbietenden Fläche gelagert.
Im Lichte der Geschichte, pflegte Olga erstaunten Besucherinnen zu erklären (sie hätte übrigens auch gern männliche Besucher empfangen, es gab aber kaum noch Altersgenossen), verlieren manche Ereignisse sehr schnell an Bedeutung. Aber das ist nicht entscheidend. Das Wichtigste ist, dass viele Lügen sich schon nach kurzer Zeit als das herausstellen, was sie sind. Oder wollt ihr, dass ich meine teuer bezahlten Archivwände mit den Lügen der Politiker anfülle?
Das Argument überzeugte immer. Die Besucherinnen versuchten, zwischen der angeblichen oder wirklichen Trunksucht des russischen Präsidenten, gerade bekannt gegebenen Arbeitslosenzahlen der europäischen Länder, Prognosen über die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik oder zum Waldsterben in der Tschechischen Republik ein Plätzchen zu finden. Ihre Kaffeetassen hielten sie in den Händen, vergnügt und mit dem Bewusstsein, ihren Nachmittagskaffee in einer Wohnung zu sich zu nehmen, in der den Regierenden in aller Welt auf die Finger gesehen wurde.
Jetzt allerdings hatte Olga ihr Tagewerk noch nicht begonnen. Sie war wach, hatte sich vorsichtig und langsam auf den Rücken gelegt und horchte auf die Geräusche aus dem Treppenhaus. Ihre Wohnung lag im Parterre. Sie wusste, ohne es zu sehen, wer gerade die Treppe herunterkam, wer das Haus verließ und wer zurückkehrte; ein Ergebnis des Umstandes, dass sie seit mehr als dreißig Jahren in diesem Haus wohnte. Ende der fünfziger Jahre war sie, gemeinsam mit Bella und sieben anderen Familien, in das von Bomben beschädigte und wiederhergestellte Haus eingezogen. Zuerst nahm man im Haus an, dass Olga Kriegerwitwe sei, was sie bei jeder passenden Gelegenheit richtigzustellen versuchte. Sie begann dann mit ausführlichen Erklärungen darüber, dass sie Russin sei, vor Stalin nach Spanien geflohen, also eigentlich Spanienkämpferin. Deshalb habe Bella auch keinen bestimmten Vater (und sie sei nicht Witwe), sondern sei ein »Kind der Republikaner«. Selbstverständlich verwirrte diese Erklärung die Hausbewohner nur. Diese Tatsache und ihre kommunistische Überzeugung hatten ihr Verhältnis zu den anderen Mietparteien im Laufe der Jahre erheblichen Schwankungen unterworfen. Inzwischen waren die Ehemänner im Haus gestorben, begraben und lebten nur noch in der Erinnerung der zurückgelassenen Frauen. Olgas äußere Existenz unterschied sie nicht mehr von der der anderen. Jetzt schienen sie vor der Zeit alle gleich zu sein. Die Folge war, dass sich im Haus unter den acht alten Frauen eine friedliche, ein wenig wehmütige Atmosphäre entwickelt hatte, in der es sogar möglich war, einander Trost zu spenden. Auch Olga, in manchen Dingen im Alter eben doch ein wenig nachlässiger geworden, wäre durchaus bereit gewesen, sich dieser Atmosphäre, über alle Klassenschranken hinweg, hinzugeben. (Die Witwe eines Regierungsrates und eine, allerdings sehr arme, Tiermalerin, deren Mann ebenfalls Tiere bei jeder Beleuchtung gemalt hatte, gehörten nach Olgas Vorstellungen nicht unbedingt zur arbeitenden Klasse.) Nur die Person, die gerade jetzt die Treppe heruntergehumpelt kam, hinderte sie daran. Selbst in diesem Augenblick, durch Bettdecke, Flur und Wohnungstür von der Person getrennt, mit der sie in Dauerfehde lag, kniff Olga die Augen zusammen und verzog verächtlich den Mund. Die unzähligen Runzeln in ihrem Gesicht und die auf dem Kopf zusammengebundenen weißen Haare ließen sie dabei aussehen wie die Hamburger Zitronenjette auf einem alten Stich.
Olga lag und wartete darauf, dass die Person zur Tür hinaushumpelte und die Tür hinter ihr ins Schloss fiele. Stattdessen waren die Schritte plötzlich nicht mehr zu hören. Olga sah auf die Uhr. Es war kurz vor acht. Der Briefträger konnte noch nicht da gewesen sein. Besuchte die Person die Nachbarin?
Die Nachbarin im Parterre war eine flinke kleine Frau, die mit allen im Haus gut Freund, aber mit niemandem wirklich befreundet war. Sie verbrachte ihre Zeit mit Beten und Singen im nahe gelegenen Gemeindezentrum. Olga nahm ihr übel, dass sie dort nicht wenigstens etwas Nützliches tat, Wäsche flicken oder Kindern etwas vorlesen, kam aber sonst ganz gut mit ihr aus. Weshalb sollte die Person die Kirchenmaus besuchen?
Als es an ihrer Wohnungstür klingelte, war sie erstaunt. Die Abneigung, die sie für ihre Mitbewohnerin hegte, beruhte auf Gegenseitigkeit. Jetzt, es konnte nicht anders sein, stand die Person vor ihrer Tür und klingelte zum zweiten Mal.
Moment, ich komme gleich, rief Olga. Es fiel ihr schwer, schnell aus dem Bett zu klettern und sich den Morgenmantel überzuziehen. Morgens waren ihre Gelenke steif. Sie brauchte eine Weile, bis sie sich fähig fühlte, die Tür zu öffnen. Sie sagte den unfreundlichen Satz nicht, den sie sich vorgenommen hatte zu sagen, sondern öffnete die Tür etwas weiter und ließ die Person an sich vorbei ins Wohnzimmer humpeln. Da saß sie, ein Häuflein Unglück, auf dem einzigen freien Stuhl neben dem Schreibtisch und starrte vor sich hin. Olga wartete und ging dann achselzuckend ins Bad. Der Besuch war ihr unangenehm. Sie hoffte, ihn besser zu bewältigen, wenn sie gewaschen und angezogen der ungebetenen Besucherin gegenübertreten würde.
Eine Viertelstunde später erschien sie wieder, jetzt nicht mehr Schwester der Zitronenjette, sondern Schwester der Äbtissin des Klosters Lüne: korrekt gekleidet, sorgfältig frisiert und mit überlegenem Gesichtsausdruck auf den ungewöhnlichen Besuch zur ungewöhnlichen Zeit hinblickend.
Die Person saß noch immer in zusammengesunkener Haltung am Schreibtisch. Sie hielt ein Stück Papier in der Hand, einen Brief, wie es schien. Als Olga sich räusperte, sah sie hoch und nahm Haltung an. Sie richtete den Oberkörper auf und stellte die übereinandergeschlagenen Beine nebeneinander auf den Fußboden. Das Schuhband am rechten schwarzen Stiefel war unordentlich gebunden und hing auf den Boden.
Gehen Sie davon aus, dass es mir nicht leichtfällt, zu Ihnen zu kommen, sagte die Person.
Ihre Stimme nötigte Olga Bewunderung ab. Sie selbst hätte keinen kühleren Ton finden können.
Ich komme, um Sie nach der Telefonnummer Ihrer Tochter zu fragen. Ich weiß, dass sie sich mit – die Stimme zögerte einen Augenblick, genauso lange wie Olga brauchte, um den Entschluss zu fassen, Bellas Nummer auf keinen Fall preiszugeben – Ermittlungen beschäftigt. Olga antwortete nicht. Ihrem verschlossenen Gesicht war die Absicht abzulesen.
Das ist das letzte Lebenszeichen, das ich von meiner Tochter habe, sagte die Person und streckte Olga den Brief entgegen. Ihre Stimme war tonlos, alle Aggressivität war daraus verschwunden. Olga dachte an die Tochter, die schon lange nicht mehr im Haus lebte, an den Mann der Person, der inzwischen tot war, und änderte ihre Haltung nicht.
Der Brief ist vier Wochen alt. Sie schreibt darin, dass sie in zwei Tagen zurückkommen und mich dann anrufen wird. Sie hat sich nicht gemeldet.
Als Olga sich noch immer nicht rührte, ließ die Person den Arm mit dem Brief sinken und fiel in sich zusammen. Olga fühlte Mitleid und ärgerte sich darüber.
Meine Tochter hat Gründe, ihre Telefonnummer nicht bekannt zu geben, sagte sie. Im Übrigen hat sie ihren Beruf aufgegeben. Sie ermittelt nicht mehr.
Sie sprach mit Genugtuung. Bellas Arbeit war ihr immer anrüchig vorgekommen. Als Kriminalkommissarin hatte sie sich, ihrer Ansicht nach, zu sehr mit der Staatsmacht eingelassen. Als Privatdetektivin hatte sie in ihren Augen schon fast zur Unterwelt gehört.
Die Person ließ den Arm sinken und begann, vor sich hin zu schluchzen. Dann fiel ihr ein, dass sie sich auf feindlichem Territorium befand. Sie raffte sich auf und humpelte zur Tür. Der Brief fiel auf den Boden.
Lassen Sie ihn liegen, sagte Olga großzügig. Ich werde ihn meiner Tochter geben. Sie wird sich bei Ihnen melden.
Die Person humpelte zur Tür hinaus, ohne zu antworten, aber auch, ohne sich nach dem Brief zu bücken. Olga blieb in der Zimmertür stehen, sah auf den Brief und ärgerte sich über ihre Nachgiebigkeit.
Alte Nazisse, sagte sie, der Tag fängt ja gut an.
Kapitel 4
Er hatte immer gewusst, dass die Frau, die er geheiratet hatte, dumm war. Sie war nicht mal besonders hübsch gewesen. Jung, ja, aber den Reiz, der darin lag, hatte er damals übersehen, weil er selbst jung gewesen war. Trotzdem hatte er sie geheiratet. Ihre Heirat war nicht einfach deshalb zustande gekommen, weil sie sich schon als Kinder gekannt hatten. Nein, er hatte sich ganz bewusst diese Frau ausgesucht. Sie besaß eine Eigenschaft, über die damals nur wenige Frauen verfügten: Sie gehörte zu der neuerdings herrschenden kommunistischen Klasse. Es gab verschiedene Gründe, weshalb für ihn keine andere Frau in Frage gekommen war als so eine. Die Gründe hatte er im Laufe der Jahre vergessen, denn seine Rechnung war aufgegangen. Er hatte sein Leben umsichtig geplant, und es war nach Plan verlaufen.
Plan – das war auch so ein Wort, das inzwischen jede Bedeutung verloren hatte. Für das neue Leben, auf das er sich seit drei Jahren mit Erfolg konzentrierte, brauchte er keinen Plan. Jetzt brauchte man Strategien, am besten mehrere, jetzt, da nichts mehr berechenbar war. Jederzeit konnten sich Änderungen ergeben, auf die man keinen Einfluss hatte, Ereignisse eintreten, die nicht vorherzusehen waren. So wie diese Frau im letzten Sommer.
Er hörte seine Frau die Küchentür schließen und dann die Treppe emporsteigen. Sie ging langsam, wegen der Mühe, mit der sie das Tablett mit dem Glas und der Wasserflasche balancierte. Er sah auf die Türöffnung, in der sie gleich erscheinen würde, das graue Haar für die Nacht gebürstet, das Nachthemd unter dem Bademantel hervorhängend, Pantoffeln an den Füßen. Die Pantoffeln waren hübsch. Er hatte sie ihr vorhin gegeben, ein Geschenk, um sie für das bevorstehende Gespräch zugänglich zu machen. Er stand von der Bettkante auf, ging seiner Frau entgegen und nahm ihr das Tablett ab.
Das Küchenfenster war nicht zu, sagte sie.
Ihre Stimme ist wie sie selbst, dachte er, unscheinbar, aber man bemerkt sie trotzdem. Laut sagte er: Früher hätten wir auflassen können, und ärgerte sich im gleichen Augenblick über seine Worte. Früher war früher. Einmal, bald nach dem Fall der Mauer, hatte er in Berlin zu tun gehabt, in dem Teil, den sie gewohnt waren, »Hauptstadt« zu nennen. Die Straße »Unter den Linden« war voller Menschen gewesen, Menschen von drüben und von hier. Sie waren herumgeschlendert, mit schräg gehaltenen Köpfen nach Veränderungen Ausschau haltend, und wie eine dichte gewisperte Wolke hatte das Wort »früher« über ihnen gehangen. Er hörte es ununterbrochen, leise und laut, so lange, bis er genug hatte und die Stadt verließ. Er hielt nichts davon, von vergangenen Zeiten zu träumen. Das führte zu nichts. Außerdem war es gefährlich, weil es von dem ablenkte, was zu tun war. Jetzt waren andere Zeiten.
Das einzige Problem, das er darin sah, auch die neuen Zeiten erfolgreich zu bestehen, war das Alter. Man konnte nicht übersehen, dass man nicht mehr zwanzig, sondern fünfundsechzig war. Die Kräfte ließen nach, und jeder Gedanke an früher verhinderte die unbedingt notwendige Konzentration auf heute. Heute – er hatte seiner Frau das Tablett abgenommen, war zurück auf seine Seite des Ehebetts gegangen, blieb dort stehen und sah vor sich hin. Er verstand noch immer nicht, weshalb dieses Heute ihm von Anfang an so vertraut vorgekommen war, obwohl alle Welt damit Schwierigkeiten hatte.
Während er eigentlich nichts weiter zu tun brauchte, als in sich hineinzuhören, dabei lange vergessen geglaubte Worte wiederzufinden und zu beginnen, ein neues Leben zu entwickeln, quälte sich seine Frau mit vergangenen Strukturen, die sie vergeblich in der neuen Zeit suchte. Natürlich gab es jetzt weniger Arbeit für Frauen. Aber war es so schlecht, dass die Mütter sich wieder mehr um ihre Kinder kümmern konnten? Was war falsch daran, wenn die jungen Frauen im Familienbetrieb aushalfen und sich dabei ein schönes Taschengeld verdienten? Seiner Tochter jedenfalls ging es nicht schlecht. Natürlich war dies alles erst der Anfang. Damals -
Willst du dich nicht hinlegen?, fragte die Frau. Sie saß im Bett, die Decke bis zu den Schultern hochgezogen, und sah aufmerksam zu ihm hinüber. Sie lebten zu lange miteinander, als dass ihr hätte entgehen können, wie sehr sich ihr Mann verändert hatte, seit die Fremde da gewesen war. Doch, natürlich, sagte er. Ich überlege nur gerade, wie ich es dir erklären soll.
Was erklären, fragte die Frau.
Sie war beunruhigt. Sie spürte etwas Neues auf sich zukommen, etwas, das vielleicht über das Neue hinausging, das zu lernen ihr in den letzten Jahren so schwergefallen war. Sie liebte und bewunderte ihren Mann. Sie hatte ihn von Anfang an bewundert, beinahe von Anfang an, erinnerte sie sich. In den Wochen bevor der Krieg zu Ende ging, ihr Vater war noch im Konzentrationslager, und sie war mit ihrer Mutter allein geblieben, war er jeden Tag in seiner HJ-Uniform als Briefträger zu ihnen gekommen. Ihre Mutter sah es nicht gern, dass sie ihn anhimmelte. Ja, anhimmelte, so hatte sie gesagt. Das war ihr peinlich gewesen. Deshalb hatte sie ihn dann heimlich getroffen. Nur ein paarmal. Einmal war er sehr verstört gewesen. Er hatte etwas gesagt oder getan – es war ihr nicht klar geworden, worum es ging. Und dann war der Krieg vorbei gewesen. Alles war plötzlich anders. Sie hatte Angst gehabt, er würde sie vergessen. Aber er war hin und wieder gekommen, zuerst heimlich, dann bald ohne Scheu. Die ganze Zeit über, acht Jahre lang, hatte sie gehofft. Neunzehnhundertdreiundfünfzig war ihre Hoffnung in Erfüllung gegangen: Er hatte sie geheiratet. Ein paar Monate nach ihrer Hochzeit war er in die Partei eingetreten. Von da an hatte ihm ihre Bewunderung uneingeschränkt gehört. Es war so gewesen, als sei damit die letzte Schranke zwischen ihnen gefallen.
Jetzt, im Bett sitzend und ihrem Mann dabei zusehend, wie er sich umständlich zurechtsetzte, fiel ihr staunend der Abend wieder ein, an dem er spät von einer Versammlung nach Hause gekommen war. Er sprach darüber, was auf der Versammlung beschlossen worden war. Und dass er den Antrag gestellt hätte. Sie hatte damals nicht nach seinen Gründen gefragt. Wortlos war sie zu ihm hinübergerutscht, einfach in dem Bedürfnis, die politische Nähe, die er damit zwischen ihnen hergestellt hatte, durch körperliche Nähe zu ergänzen. Sie waren lange stumm nebeneinander liegen geblieben. Jetzt, sie wusste nicht weshalb, aber es war so, erst jetzt kamen ihr plötzlich Zweifel daran, dass sie damals das Gleiche gedacht und gefühlt hatten.
Erinnerst du dich an die Frau, die im Sommer hier war? Sie hatte es gewusst, nickte nur stumm mit dem Kopf. Sie hatte es schon geahnt, als sie die Frau beim ersten Mal über den Plattenweg durch den Garten kommen sah. Niemand von hier ging so, in dem Alter mit Turnschuhen und die Hände in den Jackentaschen. Später, als die Frau am Stammtisch saß und aß, war sie aus der Küche in den Schankraum gegangen, um zu hören, was ihr Mann mit der da zu reden hatte. Es ging um früher, die Zeit, als sie und ihr Mann sich noch nicht näher kannten, weil ihre Familien, wie er sich einmal ausgedrückt hatte, an verschiedenen Enden am Seil zogen. Gerade dieses Seil, an dessen Enden angeblich nach Westen und nach Osten gezogen wurde, war ihr wieder eingefallen, als sie ihren Mann sah, ins Gespräch vertieft mit dieser Fremden. Sie war nie ganz davon überzeugt gewesen, dass es nur darum gegangen war, in die verschiedenen Himmelsrichtungen zu ziehen. Ihr Vater jedenfalls war anderer Meinung gewesen.
Ihm war es darum gegangen, die braune Pest zu bekämpfen. Vom Seil war da nie die Rede gewesen.
Als ihr Mann sie der Fremden nicht vorgestellt hatte, war sie zurück in die Küche gegangen. Er würde ihr später sagen, was die Frau wollte. Denn dass sie etwas wollte, war klar. Weshalb hätte sie sonst an einem ganz gewöhnlichen Dienstagnachmittag in das Lokal kommen sollen?
Sie sah die Frau über den Plattenweg davongehen, die Hände in den Jackentaschen, die Schultern ein wenig hochgezogen, und in der Dämmerung verschwinden. Weshalb bog sie nicht nach rechts ab, auf die Straße, die zum Dorf führte? Weshalb schlug sie den Weg in den Wald ein?
Eine leichte Unruhe war in ihr zurückgeblieben. Die gleiche Unruhe meinte sie bei ihrem Mann zu spüren, nachdem die Frau gegangen war. Aber sie fragte ihn nicht. Es war besser zu warten, bis er sich entschließen würde, mit ihr über den Besuch zu sprechen.
Jetzt war es so weit. Erwartungsvoll sah sie ihn an.
Hast du sie erkannt, fragte er. Sie schüttelte den Kopf.
Nein, sagte sie, nur, dass sie von drüben war.
Ja, jetzt, antwortete er. Ist auch besser so. Sie ist tot, ich habe sie umgebracht.
Seine Hände fuhren auf der Bettdecke hin und her wie zwei Teile, die nicht zu ihm und nicht zueinander gehörten. Sie trafen sich zufällig, hielten sich fest und blieben vor ihm auf der Decke liegen. Die Frau spürte Angst. Sie kroch langsam ihre Waden hoch, saß in den Knien, sie wusste, sie hätte jetzt keinen Schritt tun können, kroch die Oberschenkel herauf in den Leib, kroch in den Magen und saß da fest. Sie begann zu zittern. Ihre Zähne schlugen aufeinander. Sie zog die Bettdecke zum Gesicht und drückte die Decke mit beiden Händen gegen ihren Kiefer. Sie versuchte, den Kopf zu schütteln. Sie wollte sagen, dass sie den Worten ihres Mannes nicht glaubte, aber es gelang ihr nicht. Schließlich brach sie in Tränen aus.
Der Mann war erleichtert. Der Anblick der zitternden, mit beiden Händen den Kiefer haltenden Frau war ihm unerträglich gewesen. So wie jetzt, schluchzend und stöhnend, kannte er sie. Er musste sie nur gewähren lassen.
Nach einer Weile hob sie den Kopf.
Aber warum, sagte sie.