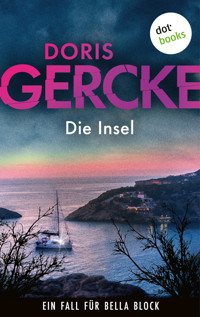Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Bella Block
- Sprache: Deutsch
Der achte Fall der Kultermittlerin Bella Block jetzt neu im eBook!Sonne, Lügen und ein tödliches Geheimnis … Als die Hamburger Privatdetektivin Bella Block beauftragt wird, in Spanien nach dem verschwundenen Mann einer Freundin zu suchen, scheint der Fall für sie ein leichtes Spiel zu sein: Ein paar Tage im sonnigen Andalusien verbringen, ein paar Nachforschungen über den Verschwundenen anstellen – nur allzu gerne lässt die Ermittlerin sich darauf ein. Doch schnell merkt Bella, dass hinter der Fassade des vermeintlich harmlosen Urlaubsidylls ein gefährliches Geheimnis verborgen liegt. Als Bella tiefer in die düstere Welt der spanischen Provinz eintaucht, trifft sie auf einen alten Feind aus ihrer Vergangenheit. Plötzlich werden nicht nur ihre Ermittlerfähigkeiten, sondern auch ihr Leben auf eine tödliche Probe gestellt … Der achte Fall der legendären Kommissarin Bella Block, der unabhängig gelesen werden kann – ein bitterböser Kriminalroman für die Fans von Susanne Mischke.In Band 9 reist Bella Block nach Odessa und gerät in einen Wettlauf gegen die Zeit, um das Leben ihrer Auftraggeberin zu retten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als die Hamburger Privatdetektivin Bella Block beauftragt wird, in Spanien nach dem verschwundenen Mann einer Freundin zu suchen, scheint der Fall für sie ein leichtes Spiel zu sein: Ein paar Tage im sonnigen Andalusien verbringen, ein paar Nachforschungen über den Verschwundenen anstellen – nur allzu gerne lässt die Ermittlerin sich darauf ein. Doch schnell merkt Bella, dass hinter der Fassade des vermeintlich harmlosen Urlaubsidylls ein gefährliches Geheimnis verborgen liegt. Als Bella tiefer in die düstere Welt der spanischen Provinz eintaucht, trifft sie auf einen alten Feind aus ihrer Vergangenheit. Plötzlich werden nicht nur ihre Ermittlerfähigkeiten, sondern auch ihr Leben auf eine tödliche Probe gestellt …
Aktualisierte eBook-Neuausgabe September 2025
Copyright © der Originalausgabe 1995 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
Copyright © der aktualisierten Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Stephen Bridger, Tanya Lapidus
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (fb)
ISBN 978-3-98952-688-4
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Doris Gercke
Auf Leben und Tod
Ein Fall für Bella Block 8
Wer wird es wagen, den Kampf aufzunehmen mit dem Grundschlamm?
(Peter Weiss, 1972)
Kapitel 1
Um neun Uhr, als die Sonne die Schlucht erreicht hatte, trat die alte Frau vor die Haustür. Sie trat jeden Morgen um die gleiche Zeit vor die Tür und sah auf die Straße. Eines Tages würde der Sohn wiederkommen. Er war immer wiedergekommen. Auf dieser Straße würde er gehen. Sie würde die Erste sein, die ihn sah.
Erst auf dem Bahnhof von Aguilas, als niemand außer ihm den Zug verließ und niemand auf dem Bahnhofsgelände zu sehen war, außer dem schlafenden Fahrkartenverkäufer hinter der halb blinden Scheibe, war er sicher, dass ihm niemand gefolgt war. Langsam, aber dennoch mit leichten Schritten überquerte er den Bahnsteig, ging vorbei an dem dösenden Mann hinter der Scheibe und trat vor die Tür des Bahnhofs. Tief durchatmen. Da war die gelbe, zerbröckelnde Mauer der Rampe. Da vor ihm lagen die schweren Feldsteine, mit denen die Auffahrt gepflastert war. Schräg lag sie vor ihm in der Sonne. Eukalyptusbäume, eine sterbende Agave, kein Laut, seit der Zug in seinem Rücken endgültig angehalten hatte. Er konnte das Meer riechen. Langsam ging er über die Feldsteine nach unten. Der Platz vor der Bahnhofsrampe lag gelb und staubig unter den Bäumen. Die Tür unter der Rampe in der Mauer war verschlossen. Er warf einen flüchtigen Blick darauf. Es war Mittagszeit. Die beiden Männer, die hinter der Tür das kleine Eisenbahnmuseum betreuten, waren nach Hause gegangen und hatten sich zum Schlafen hingelegt. Flüchtig dachte der Mann, der gerade mit dem Zug angekommen war, an das feierliche Zeremoniell, mit dem vor Jahren das Museum eröffnet worden war.
Der Bürgermeister war da gewesen, Abgeordnete aller Parteien, Beauftragte der Provinzregierung und ein hoher Beamter der Bahn. In langen Reden war der wirtschaftliche und kulturelle Aufschwung beschworen worden, den Andalusien nehmen würde. War nicht das Museum ein deutliches Zeichen dafür, dass es voranging? Zum Schluss hatte der Bürgermeister sich eine rote Mütze aufgesetzt. Ein Mädchen hatte sie ihm hingehalten. Mit der roten Mütze auf dem Kopf und unter dem Beifall aller Anwesenden hatte er einen Schalter betätigt, und die kleine Modelleisenbahn war losgefahren. Wochenlang waren die Kinder der Umgebung in das Museum gekommen, um die Modelleisenbahn zu bewundern.
Der Mann, der einen Augenblick stehen geblieben war und jetzt weiterging, verzog verächtlich den Mund. Auch er war unter den Jugendlichen gewesen, die die Bahn angesehen hatten. Inzwischen konnte er andere Museen ansehen, wenn er wollte. Museen mit Bildern und irgendwelchen anderen Sachen, die wertvoll waren. Jedenfalls nicht mit Spielzeugeisenbahnen, die man in jedem Schaufenster sehen konnte.
Am Rand des staubigen, von Schlaglöchern zerbeulten Platzes blieb er noch einmal stehen und sah zurück. Er sah auf das gelbe, zerfallende Bahnhofsgebäude. Früher hatte es zwei Türme gehabt, Türme wie die auf den Burgen im Norden. Man hatte sie abgetragen, um die Menschen, die den Bahnhof noch nutzten, vor herabfallenden Steinen zu schützen. Der Bahnhof sah arm aus ohne seine Türme. Die Scheiben in den hohen Fenstern waren fast alle zerbrochen. Die Mauer der Bahnhofsrampe, die von zwei Seiten aus schräg nach oben führte, zerbröckelte unter den darüberhängenden lila und roten Bougainvilleen. Sehr große Geranienbüsche mit leuchtend roten Blüten verdeckten den Sockel des Bahnhofsgebäudes und zerschlagene Kellerfenster. Es roch nach Staub und Sonne und ein wenig nach Meer. Zufrieden wandte der Mann sich ab und ging über die leere Straße in die Richtung, aus der er das Geräusch der an den Strand schlagenden Wellen zu hören meinte. Niemand folgte ihm. Leer und verlassen lag der Platz vor dem Bahnhof in der Sonne.
Die Fenster der Häuser an den schmalen Straßen waren geschlossen. Vor den Ladentüren hingen die metallenen Ketten der Fliegenvorhänge ruhig und unbewegt. Manchmal war ein Kind zu hören, das im Schlaf weinte auf einer der kleinen, von Weinranken überdachten, weißgekalkten Terrassen.
Nur die Tür zu einer Bar an der Ecke eines ockerfarben gestrichenen Hauses war geöffnet. Lärm kam aus dem Innern, das Geräusch eines Fernsehers. Er zögerte nur einen winzigen Augenblick, bevor er weiterging, jetzt mit schnelleren Schritten auf das Meer zu. Den gelben Hund, der im Schatten einer Hauswand auf dem Bürgersteig schlief, stieß er mit dem Fuß beiseite. Er hörte sein Jaulen, bis er die Promenade am Meer erreicht hatte. Helles Licht ließ das Wasser fast silbern erscheinen. Er blieb einen Augenblick geblendet stehen. Hinter dem Licht war das Meer dunkel und blau wie der Himmel. Der Mann überquerte die Promenade, die steinern und viel zu groß und zu breit dalag. Eine Treppe führte hinunter in den schmutziggrauen Sand. Er fühlte das Bedürfnis, Schuhe und Strümpfe auszuziehen und barfuß durch den Sand zu gehen. Wenn er über sein Bedürfnis nachgedacht hätte, wäre ihm aufgefallen, dass der Sand schmutzig war, dass leere Plastikflaschen, zerrissene Einkaufstüten und der Dreck der Dorfhunde über dem Strand lagen. Aber er dachte nicht nach, er war eine Zeitlang von zu Hause fort gewesen und freute sich, wieder zurückgekommen zu sein. Er setzte sich auf die unterste Stufe der Treppe, streckte die nackten Füße in den Sand und hielt sein Gesicht mit geschlossenen Augen in die Sonne. Hinter ihm die Promenade blieb leer bis auf zwei oder drei Autos, die langsam, als seien die Fahrer von der Sonne geblendet, vorüberrollten.
Es war das ruhige, gleichmäßige Geräusch der den Strand leckenden Wellen, das ihn nach einer Weile daran erinnerte, wie durstig er war. Der Zug war ohne Speisewagen gewesen. Es war lange her, dass er getrunken hatte. Ruhig, ein wenig betäubt von dem ungewohnten Aufenthalt in der Sonne, zog er Strümpfe und Schuhe an und verließ den Strand. Mit dem Essen konnte er warten, bis er zu Hause war. Trinken würde er jetzt, auf einer der Terrassen an der Promenade, die leer waren, weil die Ausländer, für die man sie gebaut hatte, nicht darauf saßen. Vielleicht schliefen sie, jetzt, in der Mittagszeit. Vielleicht waren sie gar nicht gekommen.
Die Terrassen waren nicht nur leer, sie waren auch nicht in Betrieb. Nach einer Weile fand der Mann eine kleine, dunkle Bar. Er bestellte ein Bier und sah, während der Junge hinter der Theke zapfte, den Bildern eines amerikanischen Fernsehfilms zu. Ein großer Unfall hatte sich ereignet, eine Massenkarambolage auf einem Highway. Viele Helfer bemühten sich, die grässlich verstümmelten Leichen, die blutüberströmten Verletzten abzutransportieren. Als überlaut und in einer Wolke von Staub ein Hubschrauber landete, schob ihm der Junge das Bier über die Theke. Er trank und sah dabei Männern in weißen Kitteln zu, die aus dem Hubschrauber gesprungen waren und, während sie liefen, Masken aus den Taschen ihrer Kittel zogen und sie sich über die Köpfe stülpten. Er hatte, vielleicht weil er müde war, vielleicht auch, weil der Lärm des Hubschraubers alles übertönte, nicht gehört, was gesprochen worden war. Aber er begriff, als er die Masken sah, was die Männer vorhatten. Aufmerksam sah er zu, wie diese Männer in den weißen Kitteln zwischen den Verstümmelten herumliefen, ein paar Helfer mit einer Maschinenpistole in Schach hielten und aus einem Kleintransporter eine Kiste holten, die sie in den Hubschrauber brachten, laufend, nach allen Seiten sichernd und unangefochten. Erst als der Hubschrauber abflog, das überlaute Geräusch verschwunden war, entspannte er sich und schob dem Jungen hinter der Theke das leere Glas hin.
Nicht schlecht, sagte der Junge, während er nach dem Glas griff und dabei noch immer auf den Fernseher sah. Der Mann antwortete nicht, legte das Geld für ein Bier auf den Tresen und verließ die Bar. Verwundert sah der Junge ihm nach. Er sah ihn ein paar Meter weiter stehen bleiben und die Fahrpläne an der verschlossenen Tür des Reisebüros studieren.
Da wird er wohl noch eine Weile warten müssen, sagte der Junge vor sich hin und setzte mechanisch das volle Glas an die Lippen. Er kannte den Fahrplan. Es fuhren zwei Busse am Tag in jede Richtung. Der erste war vor Stunden gefahren, und der zweite kam noch lange nicht. Auch der Mann vor der Tür des Reisebüros schien das jetzt begriffen zu haben. Er sah die leere Promenade hinauf und hinunter, tat unschlüssig ein paar kleine Schritte und ging los.
Er geht zum Dorf hinaus, dachte der Junge. Möchte wissen, wohin der will.
Am Ausgang des Dorfes sah sich der Mann, der mit dem Zug gekommen war und seine Füße in den Sand gehalten hatte, bevor er ein Bier trank, noch einmal um. Die Promenade war noch immer leer. An der Seite zum Dorfausgang war sie nicht fertiggebaut worden. Sie endete in einem Haufen aus Schutt und zerbrochenen Steinplatten. Danach begann die Dorfstraße. Ein kleines Stück lief neben der Dorfstraße eine halbhohe Mauer her. Auf der weißgekalkten Mauer lag bäuchlings ein gelber Hund. Sein linkes Hinterbein hing an der Straßenseite der Mauer herunter. Der Hund lag vollkommen still und unbeweglich da. Nur sein linkes Auge war halb geöffnet und beobachtete gleichgültig den Mann auf der Straße.
Niemand folgte ihm. Er würde zu Fuß gehen, bis der Bus ihn einholte oder ihn ein Auto mitnahm. Früher, noch zu Francos Zeiten, war es verboten gewesen, per Anhalter zu reisen. Vielleicht bestand das Verbot noch, er wusste es nicht, aber auf jeden Fall kümmerte sich niemand mehr darum.
Die Autos, die ihm begegneten, fuhren alle in die entgegengesetzte Richtung. Aber es machte ihm nichts aus, zu Fuß zu gehen. Irgendwann würde der Bus ihn einholen. Bis dahin würde er gehen. Er war lange nicht hier gewesen, fast drei Jahre lang nicht. Ohne dass er darüber nachdachte, wurde ihm die Bewegung des Gehens neben der Landstraße zu einer Geste des Ankommens, der Wiederinbesitznahme des Teils der Erde, der ihm wirklich vertraut war. Er war gern außerhalb seines Landes unterwegs, wegen des Geldes, das er woanders verdiente, und wegen der ungewöhnlichen Vergnügungen unterwegs. Aber er kam auch gern wieder zurück. Jetzt, im Mittagslicht, waren die Berge wie mit Asche bedeckt, so weiß. Niedrige, halbverdorrte Ginsterbüsche wuchsen aus der Asche, als seien sie bei einem großen Brand übriggeblieben.
Er war schon fast zwei Stunden gegangen, als er das Klingen von Glocken hörte und auf einem entfernten Hang die Tiere sah. Wie schnelle, gelb-weiße und bewegliche Würmer waren sie über den Hang verteilt. Da weidete eine große Herde. Der Hirt einer solchen Herde hatte Essen und Trinken dabei. Der Mann verließ die Landstraße. Zwischen stacheligen Ginsterbüschen und starren Wolfsmilchgewächsen hindurch ging er näher. Die Hunde entdeckten ihn und kamen ihm kläffend entgegengesprungen. Es waren drei. Sie waren von unbestimmbarer Rasse, struppig und bösartig. Erst als der Hirt sie zurückrief, gaben sie Ruhe. Da hatte der Mann dem einen, einem besonders aufdringlichen schwarzen Köter, schon einen Tritt versetzt, der ihn im Bogen in die Ginsterbüsche fliegen ließ.
Sie mögen keine Fremden, sagte der Hirt zur Begrüßung.
Das ist ihre Aufgabe, sagte der Mann. Wenn du etwas zu trinken hast – ich zahle.
Der Hirt wies die immer noch knurrenden Hunde zurecht. Er wartete, bis sie sich ein Stück zurückgezogen hatten, bevor er sich dem Fremden wieder zuwandte.
Hast Glück, sagte er, ich will gerade etwas essen.
Ein strenger Geruch ging von ihm aus. Er haftete an seinen Kleidern, an dem zerlöcherten Umhang und schien sogar aus dem Beutel zu kommen, den er von der Schulter genommen hatte.
Der Mann spürte leichte Übelkeit in sich aufsteigen. Er wunderte sich, denn der Geruch des Hirten hätte ihm vertraut sein müssen. Die Übelkeit verging aber schnell. Sie war nur flüchtig gewesen, etwas, das nicht zu ihm gehörte und schnell wieder verschwand. Der Ziegenhirt reichte ihm eine Plastikflasche mit Wein. Der Mann trank den warmen, schweren Wein.
Hast du auch Wasser, fragte er. Er sah dabei auf die Ziegen und Schafe, die langsam den Hang herunterkamen und sich ihnen näherten. Die Schafe waren vor kurzem geschoren worden. Sie waren dünn. Man sah ihre Rippen unter dem schmutzigweißen Fell. Die Köpfe saßen knochig und plump und kahl auf den mageren Hälsen. Der Hirt folgte mit seinen Augen den Blicken des Mannes.
Woher soll’s denn kommen, sagte er. Sieh dir doch die Hänge an. Möchtest du hier Schaf sein? Sind zusammen über dreihundert.
Die Ziegen sehen besser aus, sagte der Mann begütigend. Er hatte überhaupt keine Lust, sich die Klagen des Hirten anzuhören. Pralle Euter, setzte er hinzu.
Du hast einen guten Blick, sagte der Hirt. Ich weiß nicht, wie die das machen. Die sehen immer besser aus. Obwohl sie mehr rumrennen.
Wer mehr rennt, findet mehr, lachte der Mann. Er dachte dabei an die Arbeit, die er hinter sich gebracht hatte, und fühlte sich wohl. Am liebsten hätte er sich ausgestreckt, um ein wenig zu schlafen.
Siehst du den Bus von hier aus, fragte er. Ich will den Bus anhalten. Hab ihn verpasst, vorhin. Dachte, ich nehm den nächsten und geh schon mal los.
Kommst wohl von weiter her, was? Dahinten kommt er, dein Bus.
Der Mann sprang auf und begann zu laufen und mit den Armen zu winken. Die Hunde rasten kläffend hinter ihm her. Halt die Mistviecher zurück, schrie er und hörte in seinem Rücken den Hirten, der die Hunde rief. Sie gehorchten sofort und blieben stehen. Im Laufen zog der Mann einen Schein aus der Tasche, wandte sich halb um und schrie: für den Wein, während er den Schein zwischen die Zweige eines Ginsterbusches stopfte. Der Bus hielt schon am Straßenrand und wartete.
Hast ihm Gesellschaft geleistet, was?, sagte der Busfahrer fröhlich, so, als sei der Ziegenhirt ein guter Bekannter und als sei er dem Mann dankbar dafür, dass er seinem Bekannten die Langeweile vertrieben hatte. Der Mann nickte, noch außer Atem, und sah zu den gelb-weißen, wie Würmer wimmelnden Schafen hinüber, die jetzt in halber Höhe den Hang bedeckten. Der Hirt bewegte sich langsam auf den Ginsterbusch zu.
An der übernächsten Haltestelle stieg er aus. Um sein Dorf zu erreichen, hätte er noch ein Stück weiterfahren können. Aber er zog es vor, den Rest des Wegs wieder zu Fuß zu gehen. Er wartete, bis der Bus abgefahren war, ging ein paar hundert Meter in dieselbe Richtung und bog dann von der Straße ab.
Sein Weg führte ihn zwischen ein paar Häusern hindurch, an einem Graben voller Unrat vorbei.
Auf einer sehr neuen Straße, so neu, dass noch kein Mittelstreifen oder Seitenbegrenzungen aufgetüncht worden waren, ging er weiter. Er kam an einer Orangenplantage vorbei. Schon als er neben dem Hirten im Gras gelegen hatte, aber noch stärker jetzt, als er an den duftenden und voll von Orangen hängenden Bäumen vorüberging, fühlte er sich leicht und ruhig. Es war nicht so, dass er darüber nachgedacht hätte und zu dem Schluss gekommen wäre: Jetzt bin ich zu Hause und fühle mich leicht und ruhig. Die Veränderung seines Zustands war ihm nicht bewusst. Er blieb nur einen Augenblick stehen, griff über die Mauer in einen Orangenbaum, brach einen blühenden kleinen Zweig ab und hielt ihn sich tief einatmend unter die Nase, bevor er ihn im Knopfloch seines Jacketts befestigte. Als er die ersten Häuser des Dorfes erreichte, war sein Schritt beschwingt, und er pfiff leise vor sich hin. Seine Augen wanderten flink an den Hauseingängen vorüber. Niemand war zu sehen. Auch der Platz vor der Bar war leer. Die Tür zum Innenraum stand offen, nur verhangen mit dem metallenen Fliegenvorhang.
Jetzt nicht, dachte er, dahin kann ich noch oft genug gehen. Eine magere, gelbe Katze lief über die Straße und verschwand hinter einer Mauer. Die Lauben vor den Häusern waren ohne Blätter und die Terrassen darunter leer. Nirgends ein Laut, nicht einmal aus der Bar war der übliche Fernsehlärm zu hören gewesen. Er ging langsam weiter und pfiff auch nicht mehr. Am Ende des Dorfes standen die Häuser in größeren Abständen. Dazwischen dehnten sich Orangengärten. Rechts lag die Schlucht, auf deren Grund ebenfalls Orangenbäume wuchsen. Das Haus seiner Mutter war das letzte im Dorf. Es war ein einfaches, langgezogenes Haus, weißgekalkt und flach, aus Würfeln zusammengesetzt, deren ockerfarbene Dächer zum Ende hin eingestürzt waren. Die weißen Blöcke bildeten ein L. Der kürzere Teil bestand aus zwei weißgekalkten Würfeln. Einer hatte eine große Garagentür. Die Tür stand offen.
In der Öffnung, in deren Hintergrund die Feuerstelle zu sehen war, saß seine Mutter und schlief. Sie saß sehr gerade auf einem hölzernen Stuhl, dessen Sitzfläche mit Binsen bespannt war. Ihre Hände lagen auf der schwarzen Schürze, große Hände mit langen, runzligen Fingern, gesplitterten Nägeln und sehr starken Handgelenken. Schwarz saß sie da, vor der weißen Mauer ihres Hauses, den blauen, dunklen Himmel über sich. Mit den beiden Palmen hinter dem Haus wirkte das fast afrikanisch, aber dem Mann fiel es nicht auf. Das Bild war ihm zu vertraut, er war hier zu Hause. Langsam ging er auf die alte Frau zu, erwartete, dass sie aufwachte. Als er nahe bei ihr stand, hörte er sie leise und gleichmäßig schnarchen. Sie wurde nicht wach, auch nicht, als er sich auf den Betonboden neben sie setzte. Er lehnte seinen Rücken gegen die Hauswand und begann zu warten. Die Sonne stand jetzt schräg über der Schlucht. Sie traf die Hauswand und sein Gesicht, so dass er die Augen halb geschlossen hielt, um sich vor dem immer noch hellen Licht zu schützen. In dem feinen Spalt zwischen dem Beton und der Hauswand erschien der winzige braune Kopf einer Eidechse, blieb einen Augenblick unbeweglich stehen und schob sich dann ruckartig vorwärts. Langsam führte der Mann seine Hand an der Hauswand entlang, hielt sie über der Eidechse still und schob sie vorsichtig, Zentimeter für Zentimeter an der Wand hinunter. Die Eidechse bewegte ihren Kopf mit einer eleganten, kleinen Bewegung in die Richtung, aus der die Hand kam. Fast wie ein winziger, zahmer Vogel, dachte der Mann und ließ seine Hand bewegungslos an der Mauer liegen. Eine Weile verharrten sie so, der Kopf der Eidechse nach oben gewendet und die bewegungslose Hand darüber. Das Tier war langsam. Er konnte es an seinen Bewegungen sehen. Es war jetzt nicht die Zeit der Eidechsen. Es war nicht warm genug in der Mauerritze. Seine Hand war schneller. Er fühlte das winzige Herz zwischen seinen Fingerspitzen, bevor er der Eidechse mit einer einzigen, schnellen Bewegung den Kopf abriss. Sie war braun gewesen und hatte einen grünen Schwanz gehabt. Er warf die Teile weg.
Du bist wiedergekommen. Ich wusste es, sagte die alte Frau neben ihm.
Er sah auf. Sie hatte ihn beobachtet. Er lächelte sie an, nahm den Orangenblütenzweig von seinem Jackett und legte ihn neben ihre Hände. Er konnte sehen, wie die Missbilligung aus ihrem Gesicht verschwand und der Freude über seine Rückkehr Platz machte.
Kapitel 2
Zu den Dingen, die Bella widerlich fand und die sie nur sehr schwer ertragen konnte, gehörten nackte Männer in Socken, eiskalte Schlafzimmer und die Stimme ihrer Mutter Olga morgens am Telefon, wenn sie noch im Halbschlaf lag. Einzig ein nackter Mann in Socken blieb ihr an diesem Morgen erspart.
Sie war nachts aufgewacht und hatte feststellen müssen, dass ihr Schlafzimmer sehr kalt geworden war. Da die Fenster nicht offenstanden, musste in der Nacht die Heizung ausgefallen sein. Das kam sehr selten vor, aber es geschah eben manchmal, weil das kleine Haus am Elbhang, in dem sie lebte und früher auch ihr Detektivbüro unterhalten hatte, alt war und einige seiner Einrichtungen nicht mehr besonders gut funktionierten. Bella zog die Unannehmlichkeiten, die damit verbunden waren, dem Umzug in eine Wohnung mit funktionierender Fernheizung vor. Sie hatte das alte Haus, das sie lange Zeit als Mieterin bewohnte, sogar vor ein paar Monaten gekauft. Danach hatten sich – das Haus war, nicht wegen seiner baulichen Vorzüge, sondern wegen seiner Lage, nicht gerade billig gewesen – zuerst die Abflussrohre, dann die elektrischen Leitungen und nun offenbar auch noch die Heizung als unbedingt reparaturbedürftig erwiesen.
Da es draußen noch dunkel gewesen war, hatte sie nur einen kurzen Gedanken an die Unannehmlichkeiten verschwendet, die der Tag bringen würde, sich die Decke über den Kopf gezogen und versucht, noch einmal einzuschlafen. Im Halbschlaf war der Traum zurückgekommen, durch den sie zuvor aufgewacht war und das eiskalte Schlafzimmer bemerkt hatte. Es war kein angenehmer Traum gewesen. Und dann läutete das Telefon neben dem Bett. Bella, die die Angewohnheit, den Hörer sofort abzunehmen, aus ihrer Zeit als Kriminalkommissarin beibehalten hatte, jedenfalls dann, wenn sie im Halbschlaf lag und nicht in der Lage war, ihre Reflexe völlig zu kontrollieren, hörte Olgas Stimme.
Guten Morgen, mein Kind. Heute Nacht ist die Nazisse gestorben. Ich dachte, das könnte dich interessieren. Du kanntest sie doch. Erinnerst du dich –
Morgens war Olgas Stimme besonders laut, jedenfalls kam es Bella so vor. Sie war nicht nur laut. Sie war geradezu unerträglich. Sie war besitzergreifend, rücksichtslos – Bella spürte ihre Hand, die sich vor Wut über die Stimme fester um den Hörer schloss. Eine böse Antwort – sie suchte nach einer bösen Antwort.
Unten an der Haustür war ein Geräusch zu hören. Jemand steckte den Schlüssel ins Schloss und öffnete geräuschvoll, ließ irgendetwas hinfallen und sagte: Ach du lieber Himmel, ist es hier kalt.
Entschuldige Mutter, sagte Bella, Willi kommt gerade. Ich ruf nachher zurück. Sie legte den Hörer auf, ohne Olgas Antwort abzuwarten, und hörte zufrieden den Worten nach, die Willi halblaut, etwas lauter als halblaut, vor sich hin brummelte.
Das konnte ja nicht gutgehen. Diese Frau sollte öfter an die praktischen Dinge denken. Herakles, schön und gut. Aber der lebte in Griechenland. Und da ist es bekanntlich etwas wärmer als hier.
Bella lächelte, während sie Willi zuhörte. Willi, ihr voller Name war Wilhelmina van Laaken, war bei Bella »Mädchen für alles«. Dafür finanzierte Bella Willis Studium.
Als Willi sich bei Bella vorgestellt hatte, war sie Jura-Studentin gewesen. Ziemlich schnell hatte Bella herausgefunden, dass Willi intelligent genug war, um sich interessanteren Studiengängen zuzuwenden. Im Augenblick studierte sie Astrophysik, Russisch und Spanisch und dazu russische und spanische Literatur. Die Beschäftigung mit Herakles ging auf Bellas augenblickliche Interessen zurück. Seit sie genügend Geld hatte, um ihren Neigungen nachgehen zu können, ohne Detektivin spielen zu müssen, hatte sie beschlossen, den Ursachen der Teilung der Welt in mächtige Männer und ohnmächtige Frauen auf den Grund zu gehen. Der griechischen Götterwelt, entstanden im Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat, galt dabei ihr besonderes Interesse. Das Leben des Herakles war, als Willi das letzte Mal da gewesen war, ein zwischen ihnen diskutiertes Thema gewesen. Es schien, als seien Gewalt, Machtwahn und Angst die ihn prägenden Eigenschaften.
Jetzt hörte sie, dass Willi ans Telefon ging, wählte und den Mann am anderen Ende der Leitung davon überzeugte, dass er jetzt, sofort, einen seiner riesigen Öltanker in Bewegung setzen müsse, um ein winziges Haus am Elbhang und zwei darin hilflos zitternde Frauen vor dem Kältetod zu bewahren.
Danke, sagte Willi am Ende des Gesprächs, danke, das werden wir Ihnen nie vergessen. Sie sagte es mit so viel Gefühl, mit so viel Wärme in der Stimme, dass Bella fand, der Mann müsse blöde sein, wenn er nicht merkte, dass sie sich über ihn lustig machte.
Waren Ihre Dankesworte an den Ölhändler nicht ein wenig übertrieben?, sagte sie, angestrahlt von einem Elektro-Heizofen und mit zwei Pullovern und einer Decke ausgestattet, während sie mit Willi beim Frühstück saß. Schließlich ist es sein Job, Öl zu verkaufen. Und er verdient ganz gut an uns.
Er hätte natürlich auch erst morgen oder übermorgen kommen können, sagte Willi. Männer funktionieren einfach besser, wenn ich ihnen Honig um den Bart schmiere. Ich weiß auch nicht, weshalb. Irgendjemand muss ihnen das beigebracht haben, als sie noch ganz klein waren. Ein ganz guter Trick, eigentlich. Finden Sie nicht? Übrigens ist heute Dienstag.
Das war eine ziemlich holprige Überleitung, sagte Bella.