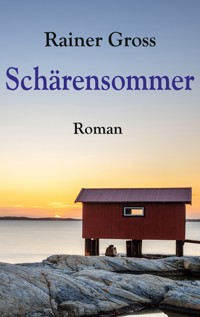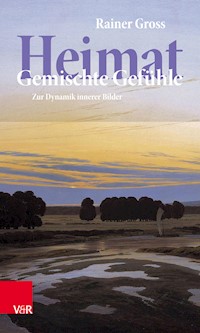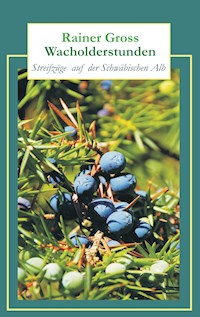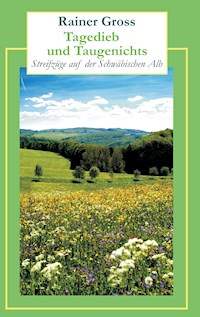Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Road Novel der besonderen Art. Der Theologiedozent Johannes und Myriel, eine Studentin, machen sich gemeinsam auf eine Motorradreise in den hohen Norden Europas. Es fängt alles ganz harmlos an, doch nichts ist harmlos: In Johannes' Tankrucksack steckt ein Revolver, und die Fahrt folgt den Spuren seiner dunklen Vergangenheit. Nun, Jahre später, will er die Geschichte zu einem Ende bringen. Eine Geschichte von Schuld und Vergebung, von verlorenem und wiedergewonnenem Leben, von Einsamkeit und der kleinen Hütte aus Nähe, die zwei Menschen sich bauen können. Dieses Buch ist die überarbeitete Neuausgabe des 2008 bei Pendragon als "Weiße Nächte" und bei BoD als "Nordkap" erschienenen Romans
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Road Novel der besonderen Art. Der Theologiedozent Johannes und Myriel, eine Studentin, machen sich gemeinsam auf eine Motorradreise in den hohen Norden Europas. Es fängt alles ganz harmlos an, doch nichts ist harmlos: In Johannes’ Tankrucksack steckt ein Revolver, und die Fahrt folgt den Spuren seiner dunklen Vergangenheit. Nun, Jahre später, will er die Geschichte zu einem Ende bringen.
Eine Geschichte von Schuld und Vergebung, von verlorenem und wiedergewonnenem Leben, von Einsamkeit und der kleinen Hütte aus Nähe, die zwei Menschen sich bauen können.
Dies ist die überarbeitete Neuausgabe des Romans, der 2008 als Weiße Nächte bei Pendragon und später als Nordkap bei BoD erschien.
Rainer Gross, Jahrgang 1962, geboren in Reutlingen, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Heute lebt er mit seiner Frau als freier Schriftsteller wieder in seiner Heimatstadt. Er wurde 2008 mit dem Friedrich-Glauser-Debütpreis ausgezeichnet.
Bisher sind rund siebzig Titel von Rainer Gross erschienen. Zuletzt veröffentlicht: Novemberland (2023); Schafsgezwitscher (2023); Das heiratende Mädchen (2023); Jesus trinkt den Kaffee schwarz (2024); Café im Hof (2024); Abschied in Cork (2024); Jahrtausendwende (2025); Gezeitenwechsel (2025); Tagundnachtgleiche (2025); Der leere Himmel (2025).
Ex septemtrione lux
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Das Singen der Reißverschlüsse
Der Troll
Europastraße
Glockenblumen
Nordkap
Friedvolle Wasser
Lapplands Paradis
Vorbemerkung
Die Handlung des Romans spielt 1989, als der Tunnel zwischen Kåfjord und Honningsvåg noch nicht gebaut war, die D-Mark zur Norwegischen Krone eins zu vier stand und es noch keine Mobiltelefone gab.
Das Singen der Reißverschlüsse
Warum nehme ich Myriel mit auf diese Fahrt? Es hat harmlos angefangen. Wir haben vom Motorradfahren geredet und wohin wir im Sommer fahren. Sie wird ihren Freund in Luleå besuchen, und ich erzähle von meiner Reise ans Nordkap. Dann können wir ja eine Strecke zusammen fahren, sagte sie. Warum nicht?, dachte ich. Aber nichts ist harmlos. Mein Vorhaben ist alles andere als eine Urlaubsreise. Warum habe ich zugestimmt? Sie wird mich stören, das weiß ich. Ich sollte auf dieser Fahrt allein sein. Ich brauche die Einsamkeit, um alles wiederzufinden, was ich suche. Ich muss dort hinauf, in den Norden. Nur dort finde ich es wieder. Ich habe den Revolver im Tankrucksack, sie könnte ihn entdecken. Aber ich beruhige mich mit dem Gedanken, dass wir uns jederzeit trennen können. Wenn ihre Anwesenheit mir zu viel wird, fahre ich allein weiter. Da brauche ich keine falsche Rücksicht zu nehmen. Es ist meine Fahrt.
Wem sage ich das? Wieso beginne ich mit diesen Aufzeichnungen, als wäre es eine ganz gewöhnliche Reise? Das selbstverständliche Notieren der Erlebnisse und Gedanken, wie auf früheren Fahrten. Für wen schreibe ich? Ich lege keine Rechenschaft ab, vor niemandem. Ich schreibe nur für mich selbst, für den zeitlosen Augenblick. Denn ich werde später nicht mehr auf diese Zeit zurückblicken können. Dieses Tagebuch wird nicht einmal ein Testament sein, denn ich werde dafür sorgen, dass es mich nicht überlebt.
Wir treffen uns am Morgen vor Myriels Studentenwohnheim. Sie trifft letzte Vorbereitungen, beide Maschinen stehen hoch bepackt auf dem Parkplatz, sie bekommt mit Mühe das Bein über die Sitzbank. Wir werden die Vogelfluglinie nehmen geradewegs nach Norwegen über Puttgarden, Helsingborg und Oslo. Im Seminar wird ein anderer an meiner Stelle Neues Testament lehren, die Studenten werden zusammensitzen bei Wein im Alten Stift und über die synoptische Frage disputieren, während ich schon unterwegs bin.
Mit dem Aufbruch überkommt mich das alte Tourengefühl: Die ersten Meter, die man fährt. Die vertrauten Straßen, die man lange nicht wiedersehen wird. An der Ampel abbiegen Richtung Autobahn. Eigentlich mag ich Abschiede. Man kappt die Fäden und löst sich vom Alten, vieles ist noch Spiel, und das Neue, mit dem man es zu tun bekommt, ist noch nicht wahr. Ich will mir diesmal nicht die alte Frage stellen müssen, wer ich unterwegs bin. Ich will einfach aufbrechen und jemand sein, irgendjemand.
Tanken hinter Würzburg auf der A 7, halb zwei. Ich tanke dreizehn Liter bleifrei. Da ist er wieder: der vertraute Ton des Unterwegsseins. Es sind die gleichen Notizen wie damals auf der Fahrt mit Vera und Jan, über Regen in der Rhön und dass wir gut vorankommen. Die Geschwindigkeit liegt zwischen hundertzwanzig und hundertdreißig.
Die Ortsnamen erkenne ich auch wieder. Es sind keine Erinnerungen, es sind Beweise, dass das damals alles wirklich war. Keine erfundene Geschichte, sondern Wahrheit. Diese Geschichte ist tatsächlich meine. Das Wiedersehen mit den Orten und Namen rekonstruiert das Geschehene wie bei einem Kriminalfall. Damals hatte alles so arglos angefangen wie jetzt. Hätten wir gewusst, was passieren würde, wir wären sofort umgekehrt. Die Maschine liegt ruhig im Wind und flattert nicht, hinter der Scheibe der Tourenverkleidung herrscht Windstille.
Merkwürdig nur, dass ich nicht allein bin wie sonst auf meinen Fahrten. Vielleicht ist deshalb die Reise mit Jan und Vera so präsent, und die Zeit, die seither vergangen ist, scheint wie nie gewesen. An den Zapfsäulen wieder das umständliche Absteigen, Aufbocken, Zupacken am massigen Gewicht, das mir so gefällt. Schön, wie der Tank sich füllt und schwer wird. Myriel kommt vom Zahlen zurück, ich stecke den Stift ans Fahrtenbuch, lege es zurück ins Kartenfach, ziehe den Reißverschluss zu. Ich habe alles dabei, denke ich. Wie immer. Weiterfahrt zwanzig nach zwei.
Ihre japanische Maschine hat einen kleineren Tank als meine. Wir müssen deshalb öfter zum Tanken halten, als ich es gewohnt bin. Die Abstimmung des Fahrtempos aufeinander gelingt unerwartet problemlos. Sie hat einen ähnlichen Fahrstil wie ich und ein ähnliches Reiseempfinden. Wenn es mir zu beschaulich wird, verkürze ich den Abstand zwischen uns, und sie erhöht dann die Geschwindigkeit. Weil sie die schwächere Maschine hat, fährt sie voraus. Beim Überholen schwenke ich als Erster auf die linke Spur und halte sie frei für sie. Ich kann sie beim Fahren beobachten. Ich sehe, wie der Fahrtwind sie schüttelt, die Fransen ihres roten Haars flattern, keck lugen sie aus dem Spalt zwischen Halstuch und Helmrand hervor. Für sie, ohne Vollverkleidung, muss es anstrengend sein.
Nach vierhundert Kilometernmachen wir die erste Rast. Wir sitzen am Randstein mit einer Dose Cola in der Hand. Brot, Dosenwurst, Senftütchen, Taschenmesser. Der Abfalleimer ist voller Wespen, die Margarine gelb und weich, von den Büchsendeckeln läuft die Sülze. Ein Sirren in den Ohren, als wären wir ertaubt und könnten uns nur brüllend verständigen.
Im Tankrucksack ist die Zuckerdose aufgegangen, meine Hände kleben und riechen nach Benzin. In der Toilette wasche ich mir die Hände, lasse mir das Wasser kalt übers Gesicht und den Nacken laufen. Ich opfere ein Geldstück und schließe mich auf dem Klo ein, um allein zu sein. Ich sitze und versuche zu begreifen, dass ich tatsächlich wieder unterwegs bin. Das Kreuz tut mir weh, und die Wadenmuskeln verkrampfen.
Draußen Hitze. Myriel sitzt zwischen unseren Maschinen. Sie schaut in die Gegend. Ich freue mich nicht aufs Weiterfahren, ich bin einfach froh, wenn ich es tue. Myriel packt den Proviant ein, sie nimmt den Brotlaib zu sich, ich die Margarine. Weiterfahrt halb sechs.
Hannover gegen acht, die letzte Tankfüllung, bevor wir die Autobahn verlassen und uns in der Heide einen Übernachtungsplatz suchen.
»Sollen wir nicht lieber in einem kleinen Hotel ein Zimmer nehmen?«, fragt Myriel.
»Zu teuer«, sage ich.
Ich will diese Fahrt so machen, wie ich sie damals gemacht habe. Wir hatten wenig Geld und sparten, wo wir konnten. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Wozu haben wir denn das Zelt dabei? Die erste Übernachtung in der Heide, das gehört dazu.
Ein Schreckmoment beim Losfahren: Ich drehe den Schlüssel im Schloss, drücke den Startknopf – und nichts rührt sich. Drücke noch einmal, drehe noch einmal den Schlüssel, dann kommt der Schreck: eine Panne! Ich rufe Myriel herbei, damit sie mir hilft, die Maschine von den Zapfsäulen wegzuschieben. Am Randstein will ich nachsehen, was nicht in Ordnung ist. Dabei entdecke ich, dass ich bloß an den Zündnotschalter gekommen bin. Darauf fall ich noch jedes Mal rein, lache ich und lasse mir nicht anmerken, dass ich unterwegs nichts mehr fürchte als Pannen.
In der Heide. Wir nehmen die Abfahrt Egestorf und geraten auf schmale, birkengesäumte Landstraßen. Ein bleiches Licht liegt über den Wiesen. In ein kleines Waldstück mündet ein Weg, guter Boden, sandiger Rasen ohne Widerstand für die Heringe.
Das Aufschlagen des Zelts ist Teamarbeit. Obwohl wir nur zu zweit sind, geht es recht schnell, zwanzig Minuten brauchen wir. Myriel weiß sofort, worauf es ankommt. Später werden wir das im Schlaf können: das Ausbreiten der Plastikunterlage, das Entrollen des Zeltes darüber mit dem Eingang in die gewünschte Richtung, das Durchschieben der drei Aluminiumstangen durch die Führungen am Außenzelt, das Emporwölben und Einbiegen der Enden in die Laschen am Saum, dann das Einhängen der mit Karabinerhaken versehenen Umschläge der Unterlage in die Ringe an der Innenseite des Außenzelts. Das Innenzelt hängt von selbst.
In der Schwüle kleben uns die Kleider am Leib; nach dem Einräumen ziehen wir uns um. Die Lederanzüge und Stiefel verstauen wir in der Apsis. Erst als wir die Maschinen zudecken, fällt uns ein, dass wir unterwegs den Wassersack nicht gefüllt haben. Myriel bietet sich an, ins nahe Dorf zu gehen, während ich das Abendessen vorbereite.
Über dem Feld jenseits der Straße sinkt fahl die Sonne in den Dunst. Die Beeren der Ebereschen leuchten. Ich komme mir vor wie fahrendes Volk, das sein Lager aufgeschlagen hat draußen auf der Waldwiese, es sind Zirkusleute mit Pferd und Wagen, ihre Geleise zerfurchen den Morastweg, den sie gekommen sind, gelb steht das Wasser in den Fuhren. Käfige sind aufgestellt für die Menagerie. Es riecht nach Harn und Firnis und nach nasser Erde. Ich weiß nicht, wie ich sie finden konnte, vor allem, da ich sie gar nicht gesucht habe. Es ist wohl eine weite Strecke, die ich zurückgelegt habe bis hierher, ich befinde mich, soweit ich weiß, in einer waldreichen Gegend nahe Pilsen. Irgendwie komme ich gerade immer nach Osten ab. Wohin will ich eigentlich, dass ich immer nach Osten abkomme? In die entlegensten Gegenden, durchschwommen welche Ströme – wohin? Ich halte auf dem Morastweg an und schaue über die Lichtung mit den Wagen. Ich steige ab und stelle die Maschine schräg, damit sie nicht einsinkt, vielleicht bin ich aber auch zu Fuß gekommen in hohen, durchgelatschten Stiefeln, etwas Rosinenbrot im Rock und die Fiedel im Felleisen. Zögernd nähere ich mich dem Rotweiß der ersten Wagen, drücke mich ins Gebüsch, denn ich will eigentlich nicht gesehen werden. Soweit ich mich erinnere, verhält sich die Sache nämlich so: Mein alter Herr, seines Zeichens Müller von Dalarna, jagte mich eines Morgens beim Gezwitscher der Sperlinge aus dem Haus, schalt mich einen Taugenichts und hieß mich, in der Welt draußen selbst mein Brot zu verdienen. Mein Rosinenbrot, das ich in der Tasche habe. So war ich zu dem Zirkus gekommen, wo ich Arbeit als Hilfskraft fand und ein Dach über dem Kopf, wenn auch ein rollendes. Dort verliebte ich mich in das Mädchen des Messerwerfes, wir trafen uns heimlich und jedes war des anderen Liebe seines Lebens, doch es kam alles heraus und das Mädchen stand nicht zu mir und ich musste gehen.
Gerne würde ich wieder auf meine Maschine steigen, den Schlüssel ins Schloss stecken, den Helm überziehen. Eine Drehung, grünes und rotes Lämpchen, ein Druck auf den Anlasser. Kurzes Rattern, Anspringen, tiefes Bullern. Das Gewicht der Maschine an den Schenkeln, die Sohlen fest auf dem Asphalt. Die Arme strecken in der Lederjacke, den linken Fuß aufsetzen, Kupplung, der erste Gang rastet ein. Losfahren, die Griffe gepackt, der Blick zurück, die sachte Böschung hinauf auf die glatte strömende entfernungslose Straße. Gas geben, hochschalten, schon wieder unterwegs sein.
Als Myriel zurückkehrt, trägt sie kalktrübes Wasser im Sack. Ich singe Hannes Wader vor mich hin.
»Ein Zweihundertmeterdorf die Straße entlang«, erzählt sie. »Backsteinhäuser, Bauernhöfe. Die Leute sind außerordentlich hilfsbereit.« Außerordentlich, sagt sie. Solche Wörter benutzt sie oft. »Sogar eine Werkstatt gibt es.«
Ich bin froh, das zu hören, denn eine Strebe meines Gepäckträgers ist gebrochen und muss geschweißt werden.
»Was singst du denn da?«
»Hannes Wader. Heute hier, morgen dort. Kennst du das?«
»Bringst du’s mir bei?«
Ich singe die erste Strophe.
Heute hier, morgen dort,
bin kaum da, muss ich fort.
Hab mich niemals deswegen beklagt.
Hab es selbst so gewählt,
nie die Jahre gezählt,
nie nach Gestern und Morgen gefragt.
Sie pfeift es vor sich hin.
»Passendes Lied für unterwegs«, sagt sie.
Die restlichen Strophen krieg ich auch noch zusammen.
Dämmerung. Mücken tanzen in der grauen Luft. Ein Flugzeug zieht am Himmel. Wir haben uns eingerichtet auf den Isomatten zwischen Motorradkoffern, Taschen und Tankrucksäcken, die verpackten Schlafsäcke als Kopfkissen. Ich koche Tee und mache eine Büchse Pichelsteiner warm. Die vertrauten Hantierungen mit den vertrauten Gegenständen, die Spiritusflasche, die Streichhölzer, die Aluminiumtöpfe. Myriel schaut mir zu. Der vertraute Geruch vom Brenner sagt mir: Du hast‘s geschafft. Du bist endlich unterwegs.
Später liegen wir bequem und satt. Die Laterne brennt, draußen ist es dunkel geworden. Wir reden wenig. Das Sirren in den Ohren ist in der Stille noch lauter. Ich habe mir meine Pfeife angesteckt und blase Rauchringe gegen die Decke.
»Darf ich auch mal?«, fragt Myriel. Sie nimmt einen Zug und inhaliert statt zu paffen.
»Hast noch genügend Zeit, es zu lernen«, sage ich arglos. Was ich manchmal so daherrede! Aus den Augenwinkeln bemerke ich, dass sie mich seltsam anschaut.
Die Gazewände des Innenzelts sind im Kerzenschein undurchsichtig, hängende Lichtund Schattenbahnen. Myriel ist in den Schlafsack gekrochen und denkt nach, einmal will ich sie ansprechen, aber da ist sie schon eingeschlafen
Ich weiß jetzt, am Ende dieses ersten Tages, nicht, was ich von all dem halten soll. Ich bin einfach froh, dass es gelungen ist, dass nun alles von selbst geht. Das schafft Ruhe in mir. Das Unterwegssein mit Myriel ist angenehmer, als ich erwartet hätte. Die Erinnerungen an die Fahrt mit Jan und Vera, die immer wieder auftauchen, stören mich nicht. Im Gegenteil: So kann ich die Vergangenheit vielleicht abtragen wie einen Berg, Stein um Stein.
Ich muss noch einmal hinaus, nehme die Laterne, öffne das Zelt, die Reißverschlüsse singen ihren vertrauten Ton. Die Nacht ist kühl, das Gras feucht. Ja, denke ich: Jetzt hat‘s angefangen.
*
Ich habe schlecht geschlafen. Das tue ich in der ersten Nacht immer. Der Himmel ist bedeckt, auf der Straße schon Verkehr. Im Wald hängen wir den Wassersack an einen Baum und waschen uns mit dem lauen Rinnsal, bis er leer ist. Der Geruch von Myriels grüner Flüssigseife. Wir müssen die Waschlappen gründlich ausspülen und knoten sie in meiner Verkleidung an eine Strebe, damit sie während der Fahrt trocknen. Bevor wir auf die Autobahn zurückkehren, muss ich im Dorf den Gepäckträger schweißen lassen.
Eine kleines Heidestädtchen mit Kopfsteinpflaster, einer Ampel, einem Supermarkt. Am Ortsausgang das Schild: Waldbad, beheizt. Von den Kartoffeläckern draußen führen drei Straßen heran und kreuzen sich. Dort steht auf Rasen die Backsteinkirche, mauerumfriedet, daneben ein Hühnerhof dämmernd unter alten Eichen. Die Idylle rührt mich. Ein Friede liegt darin, den ich selbst nicht habe. Ich bin unterwegs in den Norden, auf einer Suche, die mich mein Leben kosten wird. Gern würde ich hierbleiben können, meinen Frieden finden, mit den blauweißen Autobahnschilder im Kiefernwald wie Wegweisern zu frohen Festen.
Der Mechanikergeselle in der Werkstatt will einen Zehner fürs Elektroschweißen. Das ist billig. Zuvor muss er die Batterie abklemmen, damit es keinen Kurzschluss gibt. Das habe ich noch nicht gewusst.
Hinter Oldenburg wird die Autobahn zu einem Schnellweg ans Land-Ende. Alle hier haben dasselbe Ziel. Pappelreihen, Weiden, das mähnige Gras im Wind von hartem Glanz überflogen. Plötzlich öffnen sich stählerne Wasser und liegen Inseln tief unten, hoch ragen die Brückenpfeiler und heben die Fahrbahn hinweg über den Sund ans andere Gestade.
»Einfach?«, fragt mich das Fräulein am Fährschalter auf Fehmarn.
»Einfach«, antworte ich und denke, dass es damals mit Jan und Vera alles andere als einfach gewesen ist. Auf der Fähre haben die Schwierigkeiten schon angefangen, wenn ich mich recht erinnere. Ich sehe Veras abweisendes Gesicht vor mir, eine Gleichgültigkeit gegenüber der Fahrt, die mich verletzt. Jan ist mein Freund, mein Kommilitone, wir haben viel zu dritt unternommen, haben einander immer vertraut. Jetzt gibt es mir einen Stich, wenn sie bloß mit ihm redet. Immer habe ich das Gefühl, dass sie zu ihm freundlicher ist, dass alles, was er sagt, richtiger ist, dass sie seine Maschine bequemer findet. Willst du mit ihm fahren?, frage ich einmal provozierend. Ist dir das lieber? Wir können uns so rasch und so tief verletzen. Ich werde wütend und sage Dinge, die ich bereuen müsste, aber nicht bereuen kann. Dann wieder ist sie anhänglich und streicht während des Fahrens über meinen Oberschenkel, lacht, wenn ich ihr etwas zeige. Ich verstehe sie nicht. Ich wollte, dass es zwischen uns ganz einfach wäre, dass es einfach Liebe wäre und nichts weiter.
Der Hafen mit dem Zoll, den Wartespuren, den Fahnenmasten, den weitläufigen Kajen gibt ein Ferngefühl. Von einer Tafel lese ich auf Dänisch die Bitte um Verständnis für unvermeidliche Verzögerungen ab, Myriel muss lachen. Es ist schön, wenn sie lacht. An den Masten rütteln Fahnen, skandinavisch bunt. Wenn die bunten Fahnen wehen singt Myriel – tatsächlich: Die Fahrt geht übers Meer.
Myriel kennt das noch nicht. Wir werden wie immer als Erste eingewunken, an die Seite zwischen Heizungsrohre und Taurollen, wo nur Motorräder hinpassen. Dort stehen die Fahrer beieinander, zwei Schweizer, ein Italiener, ein Holländer. Myriel stellt sich dazu, ich folge ihr, obwohl mir nicht nach Unterhaltungen zumute ist. Man kommt ins Gespräch, über Ziele und Skandinavienerfahrungen. Einer der Schweizer ist wie ich zum Nordkap unterwegs.
»Meine Verlobte wollte nicht mit«, sagt er, »da bin ich eben allein los. Ist sowieso besser«, meint er.
»Vielleicht sehen wir uns nachher auf dem Sonnendeck«, sage ich.
Dann stellt sich Myriel an die Reling und füttert die Möwen. Ich sehe ihr dabei zu. Sie formt kleine Kugeln aus dem Brot und wirft sie in die Luft, versucht, die Vögel zu Flugmanövern zu verführen. Manche lassen sich reglos nahe heran tragen, bleiben gleichauf, äugen, fallen auf einmal zurück und steigen wieder, segeln hoch über der Brücke, sodass man den Kopf in den Nacken legen muss.
Als Rødbyhavn in Sicht kommt, enttäuen wir unsere Maschinen, bleiben aber daneben stehen, bis die Stöße vom Andocken vorbei sind. Der Italiener ist voreilig aufgesessen und kippt mit seiner Tausender um. Sofort sind wir bei ihm und helfen wuchten, allein bekäme er sie nicht mehr hoch. Er bedankt sich, steigt auf und tut, als wäre nichts gewesen.
»Schön, dass Motorradfahrer einander so helfen«, meint Myriel.
»Dem war das peinlich«, sage ich. »Hilfe annehmen kann nicht jeder.«
Am Zoll geht es ohne Kontrolle weiter, die Schalter sind verwaist. Früher, erinnere ich mich, blieben wir im Pulk und ließen Nachzügler in die Reihe. Anfangs sah es immer so aus, als müssten alle die Ausweise zeigen, doch als die ersten drei sich umständlich die Handschuhe ausgezogen, die Jacke geöffnet und die Brieftasche herausgekramt hatten und sie dann noch den Helm absetzen sollten, um das Gesicht zu zeigen, winkten die Beamten alle durch.
Hinter dem Zoll fängt gleich die Autobahn an. Diejenigen, die sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten, bleiben beieinander, die Anderen ziehen vorbei und verschwinden. Bald ist die Autobahn leer.
Hinter Hecken aus Hundsrosen liegen die Rastplätze. Tische und Bänke, Klohäuschen, einen von ihnen erkenne ich wieder, als wir halten. Da ist der Wasserhahn, an dem Vera das rostige Wasser zapfte, für unsere Übernachtung am Strand. Myriel füllt den Wassersack, während ich die Karte studiere. Strand oder Wald?, frage ich und kann nichts dagegen tun, dass ich dieselbe Frage stelle wie damals. Ich wehre mich nicht dagegen, lasse mich sinken in die Wiederholung. Genau das habe ich ja gesucht auf dieser Fahrt. Ich bin wie ein Fährtenleser und sammle die Steinchen auf, lauter Bilder, die ich vor Jahren hier verloren habe. Selbst die vom Zucker verklebten Tütensuppen im Tankrucksack, die paar Worte beim Anhalten, das lange Alleinsein während der Fahrt – alles ist eine Spur. Wir fahren zur Køgebucht, sage ich deshalb zu Myriel wie damals zu Vera. Da wissen wir, was uns erwartet.
Lagerplatz bei Greve Strand, zehn nach fünf.
Sanddünen und Rosenhecken. Von der Ortsstraße führen Wege zwischen Grundstücken hindurch zum Strand. Hinter den Pappeln liegen Häuser mit Veranden, Pfade laufen durch den grasbeschopften Sand. Am dunstigen Horizont kann man Schweden erahnen. Boote dümpeln an Bojen vertäut. Das Wasser ist warm und der Sandgrund hart, waschbrettgeriffelt.
Zum Essen kochen wir Grünkernsuppe aus der Tüte, Risotto und Tee. Ich koche auf beiden Kochern gleichzeitig, sie stehen in der vorderen Apsis im Sand. Beim Kochen spüre ich es mit jedem Handgriff: eine Genugtuung, eine Einfachheit, die alles klärt. Ein nicht abreißender Strom von Augenblicken. Umsicht und geübte Handgriffe, die Hände erinnern sich, als läge keine Zeit dazwischen. Es ist alles wieder da.
Myriel geht umher und sucht Muscheln. Ich schaue den Möwen zu, wie sie schreien. Als meine Füße am Meeressaum nass werden, überkommt mich eine unerklärliche Lust. In Bocksprüngen jage ich den Wellen nach, ich tanze, der Sand spritzt unter meinen Füßen, ein albernes Rumpelstilzchen bin ich, Ach-wiegut-dass-niemand-weiß! Myriel lässt sich davon anstecken, beim Geschirrspülen spielt sie Schiffchen und lässt die Töpfe treiben, lässt sie kreiseln und sich drehen im Strom. Ich muss lachen und fange die Schiffchen wieder ein.
»Als Kind wollte ich Kapitän werden«, sage ich.
»Das glaube ich dir nicht«, erwidert sie.
Das Wasser ist lau und watet sich seidig, das Schäumen und Ziehen, Gurgeln und Saugen, das Wasser mit den Beinen zu schieben schafft Frieden. Draußen stehen wir an der letzten Sandbank, im tiefen Zug und Schlag des Wassers, auf einmal nebeneinander. Ich sehe, wie ihre schmalen Füße im Sand einsinken, sehe die Körnchen an ihren Waden kleben.
Später legen wir uns hin und schieben die Schlafsäcke ins Genick. Wir trinken Tee und reden bei Laternenlicht über die Eindrücke des Tages.
In der Dämmerung erlischt der Strand. Klein das Zelt in den Dünen, von innen erleuchtet. Lichterketten ragen weit hinaus ins Blau. Køge, Kopenhagen, ein Leuchtturm.
Mitten in der Nacht stehe ich noch einmal auf und lege mich ich in eines der vertäuten Boote. Der Himmel bleich von Gewölk, draußen vom Meer nähert sich Dunkelheit. Das Boot bekommt Wasser unter den Kiel, hebt sich und beginnt zu treiben; die Flut läuft auf. Der Bord über mir, der Mast, der Himmel. Es ist mein Boot, denke ich: Ich liege in meinem Boot und fahre langsam aufs Meer hinaus, auf die tropische Lagune, am Palmensaum entlang bis zum Korallenriff, ich ankere mit meinem Boot draußen in den Keys, wo das Wasser grün ist und klar wie Glas. Ich werde fahren bis an den Horizont, liegen in meinem Boot, den Mast über mir und den Himmel, ich werde altgeworden sein und meine Augen werden die Farbe des Meeres haben.
*
Am Morgen ist das Wasser kalt. Kalt und grün, die Sandbänke schimmern. Auf einer von ihnen liegt mein Boot aus der Nacht, rotgestrichen, angeleint. Die Gedanken von gestern Nacht spuken mir im Kopf herum. Ich mache ein Andeutung Myriel gegenüber.
»Erzähl doch mal«, sagt sie.
»Ich kann nicht«, antworte ich. »Ich müsste dir eine Geschichte erfinden, damit ich das könnte.«
»Dann tu‘s doch!«
»Nein, dazu habe ich keine Lust. Immer diese Geschichten!«, sage ich und beiße in mein Marmeladebrot.