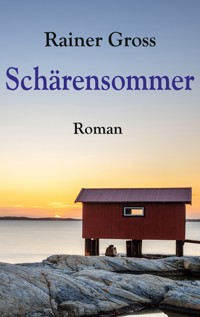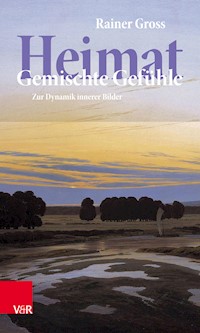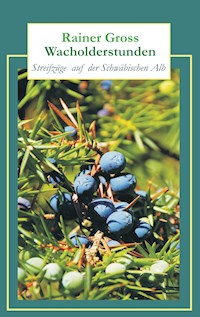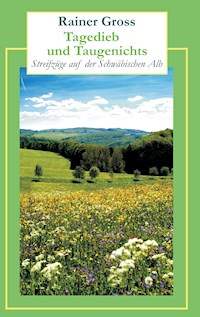Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Traum von der großen weiten Welt - deshalb ist er nach Hamburg gekommen. Er träumt ihn immer noch, seit seiner Kindheit. Er will in der Millionenstadt als Schriftsteller leben, sich eine literarische Existenz aufbauen, sich inspirieren lassen von der Hansemetropole und ihrem urbanen Leben. Doch die Fremde nimmt ihn nicht auf, die Erfüllung bleibt aus, und als er in eine Krise gerät, offenbart sich ihm die ganze Zwiespältigkeit seiner Existenz. Der zweite Band des Schriftsteller-Zyklus von Rai-ner Gross.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Traum von der großen weiten Welt – deshalb ist er nach Hamburg gekommen. Er träumt ihn immer noch, seit seiner Kindheit. Er will in der Millionenstadt als Schriftsteller leben, sich eine literarische Existenz aufbauen, sich inspirieren lassen von der Hansemetropole und ihrem urbanen Leben. Doch die Fremde nimmt ihn nicht auf, die Erfüllung bleibt aus, und als er in eine Krise gerät, offenbart sich ihm die ganze Zwiespältigkeit seiner Existenz.
Der zweite Band des Schriftsteller-Zyklus von Rainer Gross.
Rainer Gross, Jahrgang 1962, geboren in Reutlingen, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Heute lebt er mit seiner Frau als freier Schriftsteller wieder in seiner Heimatstadt. Er wurde 2008 mit dem Friedrich-Glauser-Debütpreis ausgezeichnet.
Bisher sind rund siebzig Titel von Rainer Gross erschienen. Zuletzt veröffentlicht: Novemberland (2023); Schafsgezwitscher (2023); Das heiratende Mädchen (2023); Jesus trinkt den Kaffee schwarz (2024); Café im Hof (2024); Abschied in Cork (2024); Jahrtausendwende (2025).
Denen, die’s angeht.
Nebelstille. Mild und feucht wie ein Morgen am Strand. Plattenwege zwischen kahlem Gebüsch, Amseln hecken darin. Ab und an blühende Forsythien. Wege zwischen geklinkerten Wohnblöcken, dann schmale Straßen, dann Familienhäuschen mit Giebeldach. In den Gärten stehen uralte Bäume. Der Sand einer Pferderennbahn. Der Bahnhof. Am Zug die erste Alltagshandlung. Lange steht seine Frau noch in der offenen Tür, sie lesen einander von den Lippen. Sie fährt nach Hamburg hinein, zur Arbeit. Den Rückweg geht er allein. Der Nebel macht die Welt sanft und freundlich. Die Zimmer zuhause sind kahl und kalt. Jetzt bin ich hier, denkt er. Ich habe es geschafft. Hier kriegt mich niemand mehr weg.
Tief einatmen am Hauptbahnhof. Aufschauen wie aus einem Traum. Wehende Fahnen, eilende Menschen, Lautsprecher, einfahrende Züge. Er steigt in die U3 und fährt wie auf Achterbahn zwischen den mächtigen Bauten der Hansestadt hindurch, hoch über den Straßen, unter dem hohen blauen Himmel. Baumwall, Landungsbrücken, er tritt hinaus in den Hafenwind und die Schiffe und den Strom wie in immerwährende Ferien. Er kann es nicht fassen. Fischbrötchen an den Kajen, eine Flasche Wasser im Gepäck. Vor drei Wochen waren sie hier noch verzweifelt und spätabends auf Wohnungssuche.
Die Sonne glüht hinter den geschlossenen Lidern. Eine Zigarre aus dem Etui, dünn, fein. Frauen gehen wie festliche Flaggen im Fluss des Lebens. Ein Japaner isst einen Hotdog und schaut den Möwen zu. Sightseeing., aber nicht mehr für ihn. Er fährt eine halbe Stunde nach Hause und kann morgen wiederkommen, oder übermorgen, oder in einer Woche. Kein Abschied wie früher. Keine Praktikumswochen, die zu Ende gehen. Zehn Jahre haben sie sich vorgenommen. Zehn Jahre, dann wollen sie weitersehen.
Draußen auf dem Land passiert die U-bahn eine Moorlandschaft. Schwersinnig stehen Wälder am Horizont, helle Birken winken darin wie dürre Hände. An einem Bachlauf fast märkische Kopfweiden, auf den Wiesen bleckt Wasser zwischen Riedgrasschöpfen. Walddörfer. Vorortsiedlung. An der Peripherie.
Einkauf. Der Marktplatz, die Fußgängerzone, die große Straße. Banken und Sparkassen, ein Blumenhändler, ein Kaufhaus, ein Drogeriemarkt. Dort besorgt er Slipeinlagen für seine Frau, ostentativ holt er die leere Schachtel hervor, um das Richtige zu finden. Taschentücher, feuchtes Klopapier. Beim Bäcker kostet das Pfund Mischbrot zwei Euro fünfundzwanzig, das Brötchen fünfundzwanzig Cents. Rundstück, sagen sie hier. Erste Vorräte, die er nach Hause bringt, damit sie zu essen haben abends und um die aufkommende Panik zu beschwichtigen: Frikadellen, eine Dose Ravioli, Wasser, Butter, Wurst, Käse, Milch, das Nötigste, wie man so sagt. Die Küchenutensilien sind noch in Umzugskartons verpackt. Auf dem Heimweg zieht von Westen eine Wolkenfront herauf, überdeckt den Himmel, schickt Regen.
Abends im Fernsehen: Zwei Kommissare essen an einem Imbiss an den Landungsbrücken. Das Regionalprogramm berichtet über Bauerndörfer in Schleswig-Holstein. Die Nachrichten bringen Friedensverhandlungen in Nahost.
Morgens, als seine Frau zur Arbeit gegangen ist, kann er nicht wieder einschlafen. Im kleinen Badezimmer wird es warm und feucht, als er duscht. Duft und heißes Wasser. Grauer, großer Himmel in den Fenstern. Die Birken wehen und winken. Einsamkeit, denkt er. Die Geräte und Gegenstände sperren sich seinen Händen: feindselige Haken, Bohrlöcher, Schrauben. Die Geborgenheit verbirgt sich in Umzugskartons und muss gefunden werden, Stück für Stück. In einem Karton entdeckt er Blechbüchsen duftenden Tees, Porzellanschalen, Räucherstäbchen. Wieder segeln Tee-Clipper auf historischen Meeren oder ernten Shiva-Pflückerinnen von Dreitausenderbüschen. Ein Freudenschauer überläuft ihn. Seine kleine Teewelt, die er hegt und pflegt. In die er sich flüchtet. Er will gleich das Teeregal einräumen, aber das ist noch nicht aufgebaut.
Er wird viel allein sein, erkennt er.
Er wird viel mit Gott reden.
Er hat viel Zeit, Halt anderswo zu finden als in Umzugskartons.
Fremde Rituale. Dafür nich, sagt eine Dame am Telefon, wofür dann?, würde er am liebsten fragen. Ein Zugreisender meint am Hauptbahnhof zu den widersprechenden Ansagen: Die Dame sollte mal auf die Uhr schauen. Beifälliges Gelächter der Mitreisenden. Tschü-üs, verabschiedet ihn die Verkäuferin an der Supermarktkasse. Die Leute sind freundlicher und offener als in Süddeutschland. Immer spürt er ihre ‘einheimische Souveränität, besonders in dem Norddeutsch, das sie sprechen, und ist nichts als der Zugereiste. Er fühlt sich fremd hier, fremder als anfangs in Nürnberg. Er verbringt den Nachmittag auf dem Sofa vor dem Fernseher, bis seine Frau von der Arbeit kommt.
Dann klingelt es unten an der Haustür, und sie steht in der Tür, bringt Kühle mit und Zuversicht und freut sich heim zu kommen. Dann gibt es Abendessen. Wärmung der Ravioli im Topf auf dem Gasherd. Scheibe Brot. Am Kieferntisch sitzen sie neben der Heizung, im friedvollen Fensterblick der Dämmerung, der gelben Lichter, der Zweiggirlanden der Birken. Beruhigender Geruch nach warmem Essen. Das Bett im Schlafzimmer ist schon aufgebaut. Die Vorräte, die Gläser, die Teller haben sie in den Kartons gefunden. Die Musikanlage und der Rechner sind betriebsbereit. Im Bett liest er in Tolkiens Fantasymeisterwerk, wie die Reiter von Rohan nach Helms Klamm aufbrechen. Hearken, my folk!
Honig macht die Augen hell, sagt er sich, aber sie haben kaum mehr Brot im Hause. Ein Becher aufgebrühten Beuteltees, am Fenster sitzen, in der Wärme der Heizung. Regentropfen in den Birken: Schnüre aus Silberperlen. Die Welt ruht und schweigt im Grau des Himmels. Pianoweisen aus dem CD-Player. Heute Nacht Träume von Buchenschößlingen, die aus seinem Schreibtisch sprießen, und von rätselhaften Frauen, die sterben durch schmerzlichschöne Hingabe.
Der Spiegelschrank im Badezimmer hängt an der Wand, und im Schlafzimmer ist der Schrank aufgebaut. Bücher drängen sich in den Wohnzimmerregalen, bunt, voller Geschichten und Motive. Er freut sich auf seine Arbeit. Er freut sich auf die Nachmittage am Rechner. Der Schreibtisch steht im Wohnzimmer, weit weg vom zugigen Fenster, in einem durch ein Regal abgeteilten Eck. Beim Hereinkommen aus dem dunklen Flur flutet Sonne durch die Fenster. Dumpf und malzig riecht es nach dem Pfeifenrauch von gestern Abend. Wenn sie kochen, riecht es nach Streichholz und Gasflamme wie unterwegs auf seinen Motorradreisen im Zelt, ein heimeliger Geruch. Seine Frau erinnert die Uhr über dem Herd an ihre Großmutter.
Er hat es geschafft. Sie haben es geschafft. Sie sind von Nürnberg hierher gezogen. Nach vier Jahren. Nichts braucht mehr zu geschehen. Sie sind jetzt hier und können leben – aber was bloß?, fragt er sich. Wie? Zeit hat er genug, sie auf sich zukommen zu lassen. Jederzeit könnte er sich in die U-bahn setzen und auf Streifzug gehen, durch die Hafenstadt, durch die Millionenstadt. Wie er sie bei den früheren Besuchen kennen gelernt hat. Er wird Nebenverdienste suchen wie in Nürnberg: VHS-Kurse, Verkäufer in einer Buchhandlung oder einem Teeladen, Feuilleton-Artikel für Zeitungen, Kurse an der Evangelischen Akademie Nordelbien. Das ist sein Bild, das er verfolgt. Eine literarische Existenz: nicht nur als Schriftsteller, sondern so, dass alles, was er erlebt, ein Stück Literatur abgibt, die Tage und Stunden und Ereignisse schon Literatur sind. Ein Leben im Roman. Ein Leben in einer Geschichte. Seiner Geschichte, die er sich ausgedacht hat, die er für sein Leben hält. Gottes Geschichte. Er hat ihn nicht wirklich gefragt, was willst du, was soll ich tun? Er hat das Gefühl, es durchgesetzt zu haben. Ein Zweifel bleibt.
Ja, eine Existenz, die Literatur ist. Untergetaucht in der großen Geschichte, die die Welt ist. Eine klandestine Existenz, verborgen und unerkannt unter Millionen von Menschen. Er mitten darin, wie die Made im Speck. Und aus der Verborgenheit heraus: schreiben. Seine Bücher veröffentlichen, sich den Menschen mitteilen, ohne Ruhm, Kommerz und public relations. So stellt er sich das vor.
Wozu das Ganze? Selbstverwirklichung? Gott dienen? Glücklich werden? Er weiß es nicht. Er kann es nicht bestimmen oder fügen. Es muss von selbst kommen.
Sie haben einen Hausmeister, bezahlt über die Nebenkosten. Keine Treppen wischen, keine Mülleimer leeren, keinen Schnee schippen im Winter. Das tut gut. Der Mann ist ein Sturkopf aus Dithmarschen, schlohweißes Haar, altes Friesengewächs, mit dessen Maßnahmen sie nicht immer einverstanden sind. Aber er ist ihnen sympathisch. Später gibt er das Treppenwischen auf und bezahlt seine Enkelin dafür.
Die Badewanne ist zu klein, stellt er fest. Zu wenig Armfreiheit, so kurz, dass er die Beine aufstellen muss, und das Wasser bedeckt nicht einmal seine Brust. Es ist auch nicht heiß genug, sie müssen den Gasbrenner in der Küche höher stellen. Im Badezimmerfenster mit dem geriffelten Glas Ostersonne. Schön soll es werden, denkt er, das Auferstehungsfest.
Die Fahrt mit dem Auto, um seine Frau abzuholen, führt ihn überland. Schmale Sträßchen, Weidezäune, alte Bäume, die ihr Fingerwerk in den lichtgefluteten Abendhimmel zeichnen. Backsteinhöfe am Wegrand. Einmal ein Fuhrweg, abgesperrt, der zu stillen Gestüten führen könnte mit abendlichem Ausritt.
Er holt sie vom Ortsamt ab, die Straßenkarte neben sich auf dem Beifahrersitz. Dort winkt sie, am rechten Bürgersteig, sie steigt ein. Küsschen. Wie war dein Tag? Und deiner? Zuhause sitzen sie am Tisch und essen Labskaus mit Spiegelei, Matjes und Roter Bete, während die Kommissare über Rente reden oder wieder am Hafenimbiss stehen. Lautlos schwebt der blasse Vollmond am Himmel.
Sie besichtigen einen Antiquitätenmarkt zwischen altem Gebälk und historischen Bauten. Duellpistolen gibt’s, echte, für tausend Mark, und Hamburgensien, aber sie verzichten und sparen ihr Geld auf für die maritime Dekoration ihrer Wohnung. Im Netz gibt es Fernrohre, Kompasse, Schiffsleuchten, Seekarten. Mach nur, sagt seine Frau.
Abends auf dem Balkon. Stehend, rauchend. Die Brücken sind abgebrochen, denkt er. Hier ist er sicher. Hier ist er in einer anderen Geschichte. Milde, feuchte Abendluft. Es weht sanft in den Birken. Amseln singen, still blühen Narzissen am Fuß eines Baums. Rasen, Wege, Häuser. Wohnsiedlung in einem Vorort an der Peripherie. In der Ferne öffnet sich der Horizont; dort zieht ein Flugzeug im Untergangslicht auf seiner Bahn zum Flughafen. Es ist alles gut.
Merkwürdige Lektüre: Die Heimkehr von Hermann Hesse in gilbem Bändchen, geheftet, aus der Reihe der Wiesbadener Volksbücher. Stempel im Innern: Reutlinger Frauenarbeitsschule. Warum hat sich dieser Dichter vom Glauben seiner Väter abgewandt? Das versteht er nicht. Er will es gern begreifen. Es treibt ihn um.
Weshalb?
Weil ich mich selbst nicht begreife, gibt er sich die Antwort. Jenes Ich, das damals Hesse las und sich selbst finden wollte. Das ist ihm jetzt so fremd wie alle vergangenen Ichs. Er weiß auch als gläubiger Christ nicht, wer er ist. Früher dachte er, es zu wissen, aber das war eine Täuschung. Er hat die Geschichte seines Lebens falsch gedeutet. Ein Selbstentwurf, nichts weiter. Alles bisher waren nur Selbstentwürfe. Wer aber bin ich in Wahrheit?, fragt er sich. Das weiß nur Gott
Hesse hatte bereits ein erstes Leben gelebt, bevor alles in ihm aufbrach. Das Leben ist unberechenbar, denkt er. Es bricht sich Bahn, befreit sich, entfaltet sich ohne Rücksicht. Wer weiß, was ihm hier in Hamburg noch geschehen wird? Er dachte, es wäre alles schon vorbei, als er mit dreißig zum Glauben kam, und es wartete bloß noch ein friedlicher Abgang auf ihn. Aber er merkt jetzt hier oben, nachdem er sich seinen Traum erfüllt hat, dass er längst nicht in Sicherheit ist.
Er ist noch immer auf der Suche. Obwohl er in Gott alles gefunden haben müsste. Er sucht immer noch ein erfülltes Leben.
Er leidet immer an der Zwiespältigkeit der Welt. Sie verspricht das Paradies, weckt Träume und erschreckt doch durch Niederlagen, Scheitern, Verlust und Ausweglosigkeit. Nun sitzt er hier, am Tor zur Welt, und fragt sich: Wie soll ich zur Welt leben?
Er leidet an der Welt. An ihrer Feindseligkeit, die er oft empfindet und die sich schon im Kleinen, im Alltag, im beständigen Kleinkrieg mit Küchengeschirr, Gasherden und Schlagbohrern, mit Behördenwillkür und Nachbarärger bemerkbar macht.
Was suche ich wirklich?, fragt er sich. Die Welt ist die gleiche geblieben, hier oben am Ziel seiner Wünsche. Die große weite Welt, die er sich als Kind vorgestellt hat, bleibt ein Traum.
Was ich suche, ist Frieden, denkt er. Frieden mit mir und der Welt. Eine geklärte, sichere Existenz. Eine Erklärung dafür, warum er so zerrissen ist und nicht einfach leben kann. Irgendeine Erkenntnis, einen Lehrsatz, einen Modus, eine Praktik, die ihm hilft, leben zu können.
Vielleicht hat er in Gott die Antwort längst gefunden. Das ist ja seine Überzeugung seit zehn Jahren. Aber vermutlich hat er die Antwort einfach noch nicht verstanden.
Vielleicht ist es nur die Fähigkeit zu lieben, die er sucht. Die Liebe würde heilen. Die Liebe würde ihn befähigen, wahrhaft zu leben.
Die Nachbarin unter ihnen hört oft zu laut Musik. So laut, dass er sich beim Schreiben nicht konzentrieren kann. Er wird wütend. Er legt eine Scheibe in den CD-Player und stellt auf volle Lautstärke. Ein Techno-Stück. So laut, dass er sich die Ohren zuhalten muss. Die Bässe dröhnen, er spürt es im Magen. Dann stellt er wieder leiser, aber die Musik von unten bleibt. Wütend geht er zwei Treppen tiefer und klingelt. Zwei junge Mädchen öffnen, was los sei?, fragt die Eine genervt. Er versucht, ihnen zu erklären, was los ist, aber das Mädchen an der Tür hört gar nicht zu, stöhnt genervt auf und will die Tür wieder schließen. Er hält die Tür auf, schiebt den Fuß über die Schwelle, damit er weiterreden kann. Sie wird hysterisch und droht, die Polizei zu rufen. Er wird sarkastisch und meint: Ooch, jetzt hat aber jemand Angst! Sie sind doch verrückt!, ruft die Freundin im Hintergrund, und er sieht ein, dass er zu weit gegangen ist. Vollgepumpt mit Adrenalin schlägt er noch einmal gegen die geschlossene Wohnungstür und geht wieder nach oben. Seine Hände zittern. Das hat jetzt nicht viel gebracht, denkt er. Ich muss mal mit der Mutter reden, vielleicht bringt die sie zur Einsicht. Und insgeheim erschrickt er über sich. Immerhin haben sie, als er oben ist, die Musik leiser gestellt.
Ein Hamburger Herrenhaus in Blankenese. Drei Geschosse, unterm Dach wohnt der Herr Doktor. In Gummistiefeln, weil es draußen regnet, machen sie ihm ihre Aufwartung und holen ihre ersteigerten Lithographien Hamburger Elbansichten ab.. Er bittet sie nicht herein. Akademiker, wie er selbst, aber mit Kultur und Geld aufgewachsen. Gebürtiger Hamburger, gutsituierte Familie, Johanneum, Geisteswissenschaften. Hätte ich das auch erreichen können?, fragt er sich. Hätte ich das erreichen wollen? In einem anderen Leben, denkt er. Er hat nach seinem Studium nicht promoviert. Er wollte auch nicht die akademische Laufbahn einschlagen. Er war auf der Suche.
Sie spazieren durch den Hirschpark und kehren im Witthüs ein. Reetgedeckt, Teepavillon, Stuck an den Wänden und Polsterstühle und klassische Musik. Treffpunkt zum Nachmittagstee. Es gibt Qualle auf Sand und Ronnefeldt-Tee. Mit ihren Gummistiefeln sind sie fehl am Platz, aber so soll es sein. Die edlen Menschen um sie her betreiben gedämpften Tons ihre Konversation. Die Leute von Hamburg, denkt er mit Siegfried Lenz. Fremde Rituale. Aufgenommen werden?
Hinterher auf dem Weg zur U-bahn sprechen sie darüber. Weshalb hat er nichts erreicht in seinem vierzigjährigen Leben?, fragt er sie. Oder doch etwas erreicht, nämlich das, was er tatsächlich erreichen wollte? Oder hätte er sich mehr anstrengen sollen, um leistungsfähiger zu sein? Hat er endgültig den Zug verpasst?
»Du hast einen Zug verpasst«, sagt sie, »den du gar nicht kriegen wolltest. Du hast nur geglaubt, du müsstest ihn erreichen, weil alle anderen das erwartet haben. Oder weil du gedacht hast, dass sie es erwarten.«
Ja, erkennt er, er hat seine Geschichte wirklich immer einseitig gedeutet. Vielleicht ist ja alles gar nicht wahr, denkt er. Vielleicht bin ich kein Taugenichts, kein schwarzes Schaf, das immer der Reihe tanzt. Vielleicht suche ich nur eine Nische, in der ich leben kann.
Er dekoriert die Wohnung. Maritima aus dem Internet. Ein Stück Fischernetz mit einer Netzboje drapiert er an die freie Flurwand. Eine einfache Talje mit einem Holzblock, nur die Taue fehlen. Übers Wohnzimmersofa hängt er eine Seekarte und arrangiert auf einem kleinen Bord das Messingfernrohr im Nussbaumkasten, eine Segelanleitung für angehende Matrosen, und seinen Kompass, den er noch von seinem Trip nach Melbourne hat. Obwohl es nicht die gewünschte Wirkung hat, ist er zufrieden. Am Meer wohnen, denkt er. Das muss man doch sehen. Als sie abends vom Büro kommt, sagt es ihr zu. Es ist ihr nur ein bisschen fremd, sagt sie, aber daran wird sie sich noch gewöhnen.
Ausflug in den Duvenstedter Brook. Am Mühlenteich findet er die Wohlsdorfer Mühle, einen literarischen Ort. Dort sollte man einkehren, aber sie haben zur Feier des ersten Mai schon beim Griechen gegessen. Der Teich. Auwald. Wege zwischen Sumpf und Wald. Hinterher wird Verlassenheit daraus. Diese Fremde, denken sie beide. Sie kann ihnen noch keine Geborgenheit geben, und ihre verzweifelten Versuche, heimisch zu werden, bewirken oft das Gegenteil. Heimisch wird man durch Gewohnheit, sagt er, durch Wohnen, durch Hiersein. Bis dahin sind wir nirgendwo.
Hafengeburtstag. In der Stadt ein Festtag. Hinaus nach Klein-Flottbek, hinein ins Derby-Getriebe. Hinter Maschendraht und Bäumen schallt ein Lautsprecher, Rennatmosphäre und Grillwürstchen, Jockeys queren mit ihren Gäulen die Parkwege. In der Sonne ist es heiß. Vom Jenischhaus aus sehen sie den ersten Windjammer elbaufwärts ziehen, ein Horn tönt übers Wasser bis zu ihnen herauf. Sie durchqueren das Tal der Flottbek, die stark befahrene Elbchaussee, beehren den erstbesten Eisverkäufer und setzen sich unter dem Schatten eines Baumes aufs Geländer, um den Schiffen zuzuschauen. Was alles heute auf dem Wasser ist!, staunt er. Vom Schlauchboot bis zum Containerschiff: Schaluppen, Schoner, Segelboote, Motorflitzer, Hafenfähren, Feuerwehr und Küstenwache, die Cap San Diego kehrt von ihrer Ausfahrt zurück und verleiht dem Elbhafen ein nostalgisches Flair von Übersee. Der Glanz auf dem Wasser blendet. Nachher steigen sie in die Fähre bei Teufelsbrück und fahren, dichtgedrängt stehend auf dem Sonnendeck, nach Finkenwerder und von dort zu den Landungsbrücken, hinein ins Menschengewimmel.
An den Landungsbrücken herrscht Kirmes. Eine Currywurst mit Pommes zwischen Schiffsschaukel und Magenbrot. Seine erste Portion Pommes ist kalt, er gibt sie zurück und verlangt eine neue. Vom Geländer aus sieht man den Betrieb im Hafenbecken. Der Sprecher verabschiedet aus den Lautsprechern jedes kleine Schiff, das ausläuft. Nationalhymnen erschallen. Noch vertäut liegen die beiden Russen und der Norweger, die Statsraad Lehmkuhl. Open ship verkündet ein Schild, zwei Euro sind billiger Obolus, und dann stehen sie auf den Planken, fühlen die Taue in den Händen, blicken schwindelnd hinauf in die Takelage, verfolgen die Züge und Spannungen von Talje zu Talje. Die Blöcke sind aus Metall und innen mit Kunststoffrollen versehen. Vom Bug aus, wo mächtig der Bugspriet mit den Klüverbäumen in die Szenerie hinaus ragt, beobachten sie das Manöver eines havarierten Containerschiffs, das von Schleppern ins Dock 14 gezogen wird. Blohm&Voss zeigt sich noch vor dem Tag der Offenen Tür transparent: Die buntbemalte Dockwand ist herab gelassen, das Dock geflutet, Einblicke können getan werden.
Im Heck das doppelte Steuerrad, hinter dem mancher Besucher sich wie Störtebeker vorkommt. Zwei Steuerungspulte für Wind- und Maschinenfahrt, elektronische Anzeige von Richtung und Stärke, Stellung des Steuers, vielleicht sogar Echolot. Modernes Segelschiff, und dennoch ein Schauschiff, den weiten Weg von Norwegen herab gekommen, um zum Geburtstag zu gratulieren, beschaulich an der Kaje zu liegen und an Touristen zu verdienen. Manche Seemänner sprechen Englisch, aber auch seine paar Brocken Schwedisch werden verstanden.
Zum Schluss, als alle Souvenirs schon weggepackt sind, ergattert er durch hartnäckiges Nachfragen noch einen Pin mit dem Schiff darauf, Statsraad Lehmkuhl, Andenken und Beweis, dass er persönlich dort gewesen ist.
Dafür bin ich hierher gezogen, denkt er. Seine Frau ist beeindruckt. Das kennt sie nicht aus ihrer Heimat. Sie hat rote Backen vom Wind und strahlt vor Freude. Was ich durch dich alles erlebe!, sagt sie. Die U-bahn bringt sie in die Innenstadt, die wie im Windschatten des Festes liegt. Die Gassen sind feiertäglich verlassen, ein Straßencafé nimmt sie auf, Getränke erfrischen. Aber diese Menschenmassen, sagt sie. Das ist nichts für mich! Ich glaube, die Stadt ist mir zu groß.
Tun, wozu sie hier sind. Das wollen sie besonders am Anfang, um sich einzuleben, um zu erkunden, wie das Leben hier schmeckt. Er wartet darauf loszuziehen mit seinem Notizbuch und Menschen zu begegnen, Geschichten zu entdecken, Material zu sammeln für den großen Hamburg-Roman, der ihm vorschwebt. Dazu hat er auf seinen Besuchen recherchiert und erste Entwürfe gemacht. Daran weiter zu arbeiten, darauf wartet er. Seine Frau findet sich inzwischen ein in die Arbeit und schließt erste Freundschaften. Sie sind offen für alles.
Sie machen am Wochenende Ausflüge ins Umland, nutzen das Wohnen an der Peripherie. Bäuerliches Schleswig-Holstein. Arkadische Landschaften. Picknick am Mühlenteich. Blick von den wenigen Erhebungen übers Land. Windräder am Horizont. Blühende Rapsfelder, eiszeitliche Sandböden, Megalithgräber und Herrensitze, Pferdehöfe, Koppeln und Alleen. Es tut gut, aus der Stadt heraus zu kommen. Die Landschaft ist anders als in seiner Heimat. Keine Römer, keine Kelten, aber auch keine Pfeffersäcke und Hansekaufmänner, sondern Grafen und Herzöge unter dänischer Herrschaft. Das interessiert ihn, geht ihn aber nichts an. Das also soll jetzt Heimat werden.
Der nordische Himmel, den er von seiner Durchreise auf den Skandinavientouren her kennt, mit ziehenden Wolken, hintereinander gestaffelt mit Weitblick, den er so liebt – er führt jetzt nicht mehr nach Norden. Ist keine arktische Verheißung, sondern Alltag. Sie geben sich Mühe, sich einzufühlen und heimisch zu werden, suchen auf der Karte Ziele, spüren das ganz andere Lebensgefühl, das dieses Land zwischen den Meeren bereit hält. Es ist zwar Fremde, aber sie spricht zu ihnen. Sie wächst ihnen ans Herz. Die Landschaft weckt vertrauliche Gefühle, im Gegensatz zur Stadt.
Seine Frau lernt Hamburg durch ihre Arbeit kennen. Aber er sitzt an der Peripherie und hat eine dreiviertel Stunde mit der U-bahn, bis er im Zentrum ankommt. Vielleicht hätten sie doch eine Wohnung in der Stadt nehmen sollen.
Eine Nacht allein. Kerzenlicht, einen irischen Tee, eine Pfeife Rauchtabak. Im Fernsehen stößt er auf Brechts Die Gewehre der Frau Carrare