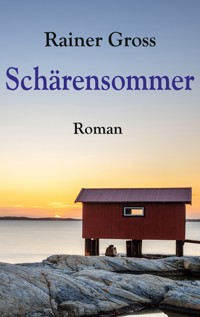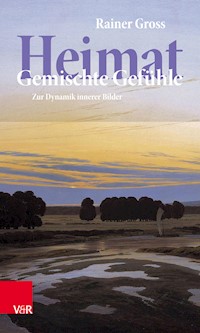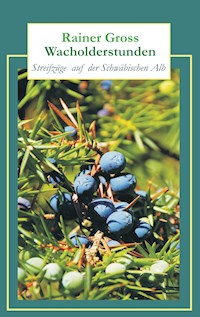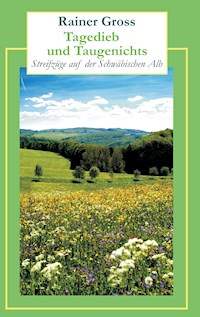Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Schriftsteller ist nach zwanzig Jahren zurück in der Heimat. Er wird rasch wieder heimisch, genießt die Ausflüge auf die Schwäbi-sche Aln und freut sich bereits auf einen friedlichen Lebensabend. Da stellt sich endlich der literarische Erfolg ein, und er scheint der Erfüllung seines Lebenstraums ganz nah. Doch es kommt alles anders, als er erwartet hat. Als er sechzig wird, zieht er Bilanz, über sein Leben, sein Schreiben, seine Träume, und die Ruhelosigkeit seiner Existenz wird ihm erst richtig bewusst. Der dritte Band des Schriftsteller-Zyklus von Rainer Gross.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Schriftsteller ist nach zwanzig Jahren zurück in der Heimat. Er wird rasch wieder heimisch, genießt die Ausflüge auf die Schwäbische Alb und freut sich bereits auf einen friedlichen Lebensabend. Da stellt sich endlich der literarische Erfolg ein, und er scheint der Erfüllung seines Lebenstraums ganz nah. Doch es kommt alles anders, als er erwartet hat. Als er sechzig wird, zieht er Bilanz, über sein Leben, sein Schreiben, seine Träume, und die Ruhelosigkeit seiner Existenz wird ihm erst richtig bewusst.
Der dritte Band des Schriftsteller-Zyklus von Rainer Gross.
Rainer Gross, Jahrgang 1962, geboren in Reutlingen, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Heute lebt er mit seiner Frau als freier Schriftsteller wieder in seiner Heimatstadt. Er wurde 2008 mit dem Friedrich-Glauser-Debütpreis ausgezeichnet.
Bisher sind rund siebzig Titel von Rainer Gross erschienen. Zuletzt veröffentlicht: Novemberland (2023); Schafsgezwitscher (2023); Das heiratende Mädchen (2023); Jesus trinkt den Kaffee schwarz (2024); Café im Hof (2024); Abschied in Cork (2024); Jahrtausendwende (2025); Gezeitenwechsel (2025);
Denen, die’s angeht.
Die Trabantensiedlung am Rand der Stadt Übernachten im einstigen Jugendzimmer in der Wohnung seiner Eltern. Nun ist nur noch der Vater da. Er ist ein über achtzigjähriges Männlein geworden, das ihn mit großen, manchmal verwunderten Augen anschaut. Der Vater ist froh, dass sie jetzt bei ihm sind, zeigt seine Zuneigung in tausend Besorgungen, hat Wurst geholt vom Lieblingsmetzger, frische Brezeln, Cola in Literflaschen. Sie werden bis morgen bleiben, wenn der Umzugslaster aus Hamburg ankommen wird.
Die Albberge sind vom Nebel verhüllt, Nieselregen, es ist kalt. Die Wohnungsübergabe macht der Eigentümer, der gegenüber wohnt, ein feiner alter Herr aus Rumänien, pensionierter Mathematiklehrer. Sie warten im Auto an der Straße auf den Laster. Ringsum lauter Eigentumswohnungen, die Häuserblöcke erschreckend nah, eingebaut wie im Baukasten, denkt er. Die beiden Hochäuser geben einen Hauch von Großstadt. Er hat Angst, dass seine Geschichte hier, seine Kindheit und Jugend und die Studienjahre ihn einholen. Die unglückliche erste Liebe, wegen der er nach Melbourne ging. Sein Suizidversuch damals, mit zwanzig. Kurz wünscht er sich die Anonymität des Nordens zurück. Ein Omnibus fährt auf der Hauptstraße vorbei, hält an, lässt Leute aussteigen, großformatige Werbung an den Flanken, er kennt den Bus, er kennt die Linie, er kennt die Haltestellen. Plötzlich wird ihm klar, dass das seine Heimat ist. Er ist zuhause. Es sieht sich nur alles neu an. Ein Neuanfang. Gerade als seine Frau aussteigt, kommt der Laster.
Er hat sich für während des Umzugs auf den Balkon zurückgezogen. Er hält das ganze Chaos nicht aus. Seine Frau gibt den Umzugsleuten Anweisungen. Der Balkon ist noch ohne Möbel, nackter Beton. Er raucht eine Zigarette, schnippt die Asche auf den Boden. Er hat eine der kleinen blauen Pillen genommen, um es nicht an sich heran zu lassen. Innerlich ist er fassungslos. Wir sind wirklich hier!, sagt er sich. Es ist endlich vorbei! Er hat schon einmal im Voraus die Aussicht, die sie jahrelang haben werden. Den Hausberg sieht man über dem Mietblock linkerhand, die Albberge in einer Lücke, den Vulkankegel über dem nächsten Hausdach. Die Häuser stehen dicht beieinander, behüten, bewachen einander. Hier bin ich aufgehoben, sagt er sich. Man kann sich in die Fenster gucken, und bei Anbruch der Dämmerung, wenn die Lichter angehen, senken sich überall die Rollläden. Wege führen von Haus zu Haus, allenthalben gehen Frauen mit Einkaufstaschen oder Fahrräder schiebend hin und her, im Grenzwall der Gärten alte Büsche und Bäume, ein Fußballtor, ein Trampolin, eine Rutsche. Wer hier wohnt, erkennt er, hat gekauft oder will bleiben. Er schaut den Menschen zu, ruht auf deren Alltag aus, ihrem beruhigenden, sicheren Alltag.
Dann sind sie allein. Die Menge der Kartons und das Ausmaß des Chaos machen sie mutlos. Sie verlassen das ungastliche Heim und gehen in der Stadt essen. Tiefgarage, nächtlich beleuchtet. Hinaus treten auf den Marktplatz, Fachwerkhäuser, Passanten, die Lichter vom Weihnachtsmarkt. Ein literarischer Augenblick, denkt er. Eine literarische Stadt ist sie, seine Heimatstadt. Mit neuen Augen gesehen, vor einem weiteren Horizont als früher. Weggewesen zwanzig Jahre. Rückkehr nach einem Abstecher in die weite Welt. Nominell Großstadt, weil sie mit den eingemeindeten Dörfern ringsum über die hunderttausend Einwohner kommt. Aber sie ist keine Großstadt. Nicht mit Hamburg zu vergleichen. Sie hat keine Oper, keine U-bahn, keinen Zoo, ein einziges Kino und einen Bahnhof mit vier Geleisen. Sie ist provinziell geblieben, trotz neuer Stadthalle, Drogenszene und sozialen Brennpunkten. Hinter dem mittelalterlichen Tor zur Altstadt, einem Tapas-Lokal und einer Sushi-Bar finden sie ein griechisches Schnellrestaurant, das offen hat. Kein heimeliger Ort heute Abend, aber sie haben Hunger. Sie verzehren gierig Gyros mit Pommes und Tsatsiki. Sie sind hier nicht zu Gast heim: Sie haben das Recht der Ansässigen.
Nachts wacht er auf. Vier Uhr, ungewohnte Umgebung. Das Schlafzimmer noch kahl, voller Kisten, die Wände nackt. Er ist unruhig. Er steht vorsichtig auf, damit er sie nicht weckt. Aber das Aufsein bringt nicht viel. In der Küche findet er die Dose mit dem löslichen Kaffee nicht, der Rechner ist noch nicht angeschlossen, er kann nur fernsehen. Er raucht eine Zigarette auf dem Balkon und schaltet wieder aus. Als er ins Bett geht, merkt er, wie erschöpft er ist.
Am Morgen wacht er mit dem Gefühl auf, ein neues Leben begonnen zu haben. Kein unwirklicher Traum: Es ist alles real. In der Wohnung ist es dunkel, weil sie überall die Rollläden herab gelassen haben. In Hamburg hatten sie nur Jalousien. In der Küche zieht er den Rollladen hoch und blickt hinaus auf das Nachbarhaus, auf Gebüschreihen und das Hochhaus dahinter. Zwei Stockwerke über dem Plattenweg, hinten auf dem Balkon sind es drei. Ein guter Platz, denkt er. Wie die Kommandobrücke eines Schiffes. Da werden sie gemeinsam kochen können.
Sie fahren zu einem Supermarkt, den er noch von früher kennt. Dreißig Jahre hat er hier gelebt. Sie genießen es, die hiesigen schwäbischen Spezialitäten einzukaufen, die in Hamburg immer vermisst haben: Flammende Herzen, knusprige Brezeln, Kimmicher, Bauernbrot, Spätzlesmehl, Birnenmost, Lyoner, geräucherte Landjäger, Maultaschen, Schupfnudeln, Flädle, Alblinsen. Manchmal fällt er ins Hochdeutsche zurück, bis er merkt, dass jeder seine Mundart versteht.
Die Straße zum Supermarkt fährt er gern. Eine Straße aus seiner Kindheit. Am ihrem einen Ende liegen die Mietsblöcke, in denen sie wohnten, an ihrem anderen liegt die Stadt. Oft fahren sie sie samstags zum Einkaufen. Die Straße ist auf der ganzen Länge verkehrsberuhigt. Zwei Ampeln regeln die Kreuzungen. Früher war es eine dunkle Allee mit alten Bäumen; jetzt sind die Bäume überall neu gepflanzt und geben den Blick frei auf den Hausberg, der sich über die Stadt erhebt. Auf den Grasstreifen blühen Löwenzahn und Gänseblümchen und Tulpen. Es geht am alten Sportplatz vorbei, wo er im Verein im Tor stand, dann kommt der Grieche, links die Südapotheke und früher ein kleiner Konsum, in dem er einmal ein Quartettspiel geklaut hat. Dann geht es den Buckel hinauf am Altenheim vorbei. Hier blühen die Forsythien. Oben auf der Kuppe kann man zur Kreuzkirche abbiegen, wo er konfirmiert wurde, und rechterhand war der Friseur, zu dem seine Mutter ihn immer schickte. Dort der Schreibwarenladen, in dem er seine Comics kaufte.
In dem Café gegenüber, das den Eltern eines Klassenkameraden gehörte, frühstücken sie. Croissants und zwei Tassen Schokolade. Das Sitzen im Café ist wie das Sitzen im Alsterpavillon, nur nicht mitten in einer Millionenstadt, sondern an der belebten Peripherie mit Blick auf die vorgelagerten Albhöhen. So gefällt mir das Stadtleben, sagt sie. Hamburg war mir einfach zu groß.
Wenn es schon den Buckel wieder hinunter geht, zur Stadtmitte, biegen sie ab auf den Supermarkt-Parkplatz.
In der Stube brennen die Lampen: die Tischlampe auf dem Bücherbord, die Tiffanylampe auf dem Teeregal, die Schreibtischlampe. Der Fernseher läuft, draußen ist es dunkel geworden. Sie haben ein paar neue Programme, die Kabelbelegung ist anders. Sie lassen den Rollladen herab und machen es sich gemütlich.
Er spürt die Nachbarn ringsherum, das Eingebettetsein, fühlt sich wie ein Bauklotz, eingefügt am richtigen Platz. Jetzt, am Abend, fühlt er es genau: Die Wohnung wird ein gemütlicher Bau sein, in den er sich zurückziehen kann. In Hamburg lebte er sehr zurückgezogen,. Hier wird das anders sein, denkt er. Hier sind Straßen und Landschaft vertraut. Er wird wieder Streifzüge auf der Schwäbischen Alb unternehmen, wie früher im Studium, sie werden Ausflüge machen, sie werden nicht nach Fehmarn und Schleswig fahren, aber an den Bodensee und in den Schwarzwald. Sie sitzen auf dem Sofa, er hält sie im Arm, gibt ihr einen Kuss.
Ihre Lippen sind ein wenig spröde, er riecht ihre Haut, spürt die Wärme ihres Körpers. Deshalb sind wir hier, denkt er: um gemeinsam zu leben.
Der Vater ruft an. Bald ist Weihnachten, sagt er. Er feiert ja Weihnachten nicht mehr, seit die Mutter gestorben ist. Für mich allein kaufe ich keinen Baum, sagt er, und ich koche auch nicht. Er sitze dann auf dem Sofa, habe eine Kerze brennen, schaue fern und denke daran, wie es früher war, als sie noch lebte.
Die Heimatstadt hat sich verändert. Neue Bauten, der Fußgängersteg über die Hauptstraße zur Altstadt ist weg, allenthalben Neubaugebiete. Aber im Grunde ist sie dieselbe wie früher. Er merkt, dass auch er sich verändert hat. Er sieht alles mit anderen Augen.
Abends telefoniert seine Frau mit der Telefonstörungsstelle, wie sie den Rooter konfigurieren kann. Dass sie das nach diesem anstrengenden Tag, nach den letzten Wochen, dem Umzug und dem wenigen Schlaf noch leisten kann!, staunt er. Müde geht sie ins Bett, und er kommt auf dem Sofa ins Grübeln. Sie leistet Enormes, denkt er. Er weiß, dass er das allein nicht leisten könnte. Dann bekommt er Angst, dass sie eines Tages zusammenklappt. Dass es zu viel für sie wird. Er müsste ihr etwas abnehmen und kann es nicht, schämt sich dafür, sie tut das alles ja, um ihm so viel wie möglich abzunehmen. Die alten Schuldgefühle. So schlimm ist deine Krankheit nun auch wieder nicht, sagt er sich. Du musst dich einfach mehr zusammenreißen. Du kannst doch einen Teilzeitjob annehmen, VHS-Kurse, für die Zeitung schreiben, Vorträge halten, Workshops anbieten, notfalls im Teeladen arbeiten. Aber das hat er schon in Hamburg nicht geschafft. Dann sagt er sich, dass er diese Stimmen in ihm kennt. Sie zerstören ihn. Sie sind die Stimme der Anderen, die ihm ein Leben lang eingeredet haben, dass er nichts taugt. Fünfunddreißig Jahre Selbstanklage. Doch es ist schon zu spät. Die kleine Welt, in die er sich zurückgezogen hat, bröckelt, droht zusammenzubrechen, der Friede entlarvt sich als Selbstbetrug, sein Blickwinkel verrückt sich und zeigt statt der harmlosen Welt eine bedrohliche Fratze. Er weiß, was vorgeht. Früher verzweifelte er, weil er weil er nicht wusste, woher diese Abstürze kamen. Nun weiß er, dass das alles vorbei geht und die Welt sich wieder zusammensetzt. Er muss nur so lange durchhalten. Er betet zu Gott. Immer wieder muss er da hindurch. Jeder Tag eine Gratwanderung. Das hat sich nicht geändert.
Nachts um halb zwei wird er wach nach einem unguten Erschöpfungsschlaf. Er steht leise auf, versucht, seine Frau nicht zu wecken. Im Wohnzimmer denkt er: Ich bin schwach. Ich habe eine kleine Kraft. Deswegen hat es in meinem Leben nicht zu mehr gereicht. Die Gaben hätte ich gehabt. Aber diese Krankheit frisst mich auf. Dann denkt er daran, dass er lernen wollte, aus Gottes Kraft zu leben. Aber Gott gibt ihm gerade so viel, dass es für einen Tag reicht. Du bist ein Gott, der den Schwachen hilft, statt von ihnen zu fordern, denkt er. Du bist meine einzige Rettung.
Auf der Anrichte in der Küche eine halbvolle Ketchupflasche, ein Schraubenzieher, ein Mokkakännchen. Strandgut aus den Tagen des Umzugs.
Als es Abend wird, drängt es ihn vom Supermarktparkplatz zurück in die Wohnung. Jetzt schnell heim, denkt er, aber als sie in die obere Einfahrt der Trabantensiedlung einbiegen, denkt er: Wieso denn? Ich bin doch immer daheim.
Als er am Herd steht, schaut er aus dem Küchenfenster. Dahinter ist es blau, er sieht hoch oben die Lichter des Hochhauses, erleuchtete Fenster, hinter denen die Menschen ihren Feierabend begehen.
Liegen im Bett. Der kleine Lichtkreis der Klemmlampe. Noyuri aus Tôkyo zieht in eine eigene Wohnung, weil ihr Mann nicht nur eine Geliebte gehabt hat. Gebratene Udon und ein Sandwich in einem Imbiss. Nachdenklich streicht er mit dem Finger über die neutapezierte Wand. Das ist nun unser Schlafzimmer, denkt er. Da oben über das Bett muss noch ein Relief von Dürers Betenden Händen hin, denkt er. Am besten Bronze. Wie früher bei seiner Oma in der Dachwohnung, als er immer bei ihr unter der Federdecke lag und ihren schweren, warmen Leib im Rücken spürte.
Im Fernsehen schaut er der Containerverladung im Hamburger Hafen zu. Er sieht die riesigen Schiffe, die Ladebrücken und Van-Carrier, die Kaianlagen und das graue Hafenwasser wieder. Dort war ich, sagt er sich und spürt ein bisschen Stolz. Am Tor zur Welt. Ich bin einmal hier aus der Heimat ausgebrochen. Das nimmt ihm niemand mehr. Nein, er hat kein Heimweh danach.
Samstagmorgen. Er liegt auf dem Sofa und liest. In der Wohnung rattert irgendwo ein Rollladen. Schritte auf dem Parkett, ein leises Pfeifen. Sie ist aufgestanden. Später klimpert der Löffel im Becher. Gleich wird sie herein kommen mit ihrem Kakao in der Hand.
Nachts um drei. Es regnet in Strömen. Das ist gut, denkt er. Er sitzt auf dem Balkon in seinem Drahtgittersessel und fühlt sich abwechselnd schwer und niedergedrückt und dann zittrig und aufgewühlt. Heute Nacht, denkt er, führen alle Wege, alle Gedanken und Gefühle nirgends hin. Ich brauche es gar nicht zu versuchen. Darin steckt auch eine Erleichterung. Er kann nur warten auf den einen Weg, der sich öffnen wird, heraus aus der Sackgasse. Er muss an das Lied von Paul Gerhard denken: Der wird auch Wege finden, die mein Fuß gehen kann. Das macht ihn ruhig. Er steht wie im Rahmen einer geöffneten Tür und versucht heraus zu finden, wohin der Weg führt. Er weiß, es wird ein guter Weg sein.
Er blickt aus dem offenen Küchenfenster, die Ellbogen aufgestützt, kalte Luft im Gesicht. Im Nachbarhaus sitzt ein Mann auf der Terrasse, eine Decke umgehängt mit Filzpantoffeln, trinkt seinen Kaffee und raucht eine Zigarette. Als der Mann aufschaut, versäumt er zu grüßen und ein nachbarschaftliches Guten Morgen hinunter zu rufen.
Beim Metzger im Supermarkt sucht die dicke Metzgersfrau den Preis für die Schupfnudeln, blättert in einer siebenseitigen Liste.
»Dô wird ma jô verruckt«, sagt sie und schimpft über ihren Mann, der alles im Kopf hat, aber nie greifbar ist.
»Er hilft mir ja net«, sagt sie, »’s dauert no an Moment.«
Sein Bruder ist zu Besuch. Auf einen Tee. Um sieben will er wieder zuhause sein, weil er wie jeden Samstag die Sportschau sehen will. Bis nächste Woche, sagt er freudig, und ihnen beiden geht die Bedeutung dieses Satzes auf.
Das Einräumen des Teeschränkchens hat er sich bis jetzt aufgehoben, bis zu einer guten Stunde an einem freundlichen Nachmittag. Er setzt sich auf den Parkettboden in der Diele und räumt die leeren Fächer des Landhausschrankes ein. Ins unterste und größte Fach kommen die Aromatees, bunt durcheinander, so bunt wie die Dosen. Ins mittlere Fach stellt er die nichtaromatisierten Grüntees, an die linke Seite die Päckchen mit Mate, und dazwischen bleibt ein kleiner Raum für ein Stillleben: Bambuslöffel (chasaku), Teebesen (chasen) und Matcha-Döschen. Ins oberste passen dann alle nichtaromatisierten Schwarztees, wobei er die alte Ordnung wiederherstellt: die Earl Greys in den Dosen mit der Krone nebeneinander, Ostfriesen- und englische Tees beieinander, eine Reihe mit Tees aus Indien, vom Himalaya und aus China, und ganz rechts die teuren Darjeelings. Er ist zufrieden. Jetzt ist die Einrichtung komplett.
Nach dem Waschen auf der Toilette riechen seine Hände süß nach Mandelmilch.
Der Resturlaub seiner Frau geht zu Ende. Ihr erster Arbeitstag. Sie arbeitet in einer Zweigstelle des Amtes auf der Schwäbischen Alb. Ihr Arbeitsweg beträgt eine Stunde, sie wird um halb sieben wieder zuhause sein. Dann wird es bereits dunkel sein. Das Arbeitsfeld ist ihr noch von Hamburg her vertraut, sie kann ohne Einarbeitung gleich anfangen. Es ist ungewohnt für ihn, nach der Zeit der Zweisamkeit tagsüber wieder allein zu sein. Um vier Uhr beginnt er auf sie zu warten. Sie ruft an, bevor sie dort oben losfährt. Es liegt noch kein Schnee auf der Alb. Als sie nach Hause kommt, erwartet er sie wie immer an der Tür und begrüßt sie mit einer Umarmung. Sie muss sich zuerst umziehen und ihre Sachen verstauen, dann setzt sie sich zu ihm aufs Sofa und erzählt von ihrem ersten Tag.
Viel gibt es eigentlich nicht zu erzählen, sagt sie. Die Kollegen sind freundlich, die Arbeit gewohnt, der Chef lässt seinen Mitarbeitern freie Hand. Bis auf die weite Anfahrt ist sie zufrieden mit der neuen Stelle.
Das Teewasser kocht. Aus dem Küchenfenster sieht er, wie eine Nachbarin auf ihre Terrasse tritt, in geblümtem Rock und wattierter Jacke. Sie bleibt an einem Tischchen stehen und raucht. Dann geht sie in Hausschlappen das Stück Rasen ab, das ihr gehört. Es ist durch einen Halbkreis aus zwei Bäumen und Sträuchern in Kübeln abgesteckt. Am Rand bei einer Steinplatte im Boden kippt sie eine Schüssel mit Brei ins Gras für die Katzen. Sie geht zurück und verschwindet im Haus. Er gießt den Tee auf.
Hammerschlag. Den Holzstiel in der Hand, das schwere Eisen in gefügigem Hebel. Der Nagel treibt sich glatt und leicht in den Hausputz. Das Thermometer hängt und zeigt nach einiger Zeit vier Grad.
Sein Vater ruft an. Ob er mit ihm zum Metzgergroßmarkt fahren möchte, da gibt es Wurstendstücke spottbillig und fertige Mittagessen mit großer Auswahl. Leberspätzle gibt es auch, die mag seine Frau so gern, und er könnte sie sich mittags in der Pfanne braten, mit Ei, wenn sie auf der Alb ist.
»Also, dann rufst mich einfach an «, sagt der Vater.
Er brät die gekauften Maultaschen in der Pfanne. Während die Abzugshaube brummt, öffnet er das Fenster. Draußen riecht es von irgendwoher nach Waschpulver. Im Hochhaus gegenüber leuchten die Fenster. Rechts sieht er die Lichter der Bungalows auf dem Höhenrücken, im Dunkeln darunter wischen Scheinwerferpaare auf der Straße zum Autobahnzubringer. Es scheint, denkt er, als wäre der Alltag hier literarischer. An sich ist er es nicht, aber hierher gehört er endlich. Er ist eingebettet in eine neue Geschichte, eine Heimkehrgeschichte. Was nun die literarische Distanz schafft, ist nicht mehr die Fremde selbst, sondern der Blick eines, der aus der Fremde kommt. Der weite Horizont, den er aus Hamburg mitgenommen hat. Dieser Plan ist also aufgegangen.
Sein Vater ruft an. Er erzählt, dass gestern Nacht im Halbschlaf seine linke Hand mit unmenschlicher Kraft versucht hat, ihn zu erwürgen. Das hat ihn verstört. Im Fernsehen ein Film über den romantischen Selbstmord eines Geigers.
Über den Albbergen geht die Sonne auf. Ein langer Wolkenriss, gefüllt mit apfelsinenfarbenem Licht, der Berg steht am Rand, flaumblau und blass, und hält sich zurück. Er schweigt, er döst. Er hält seine Wacht gedankenverloren.
Morgens hat es geschneit. Die Straßen sind frei, die Landschaft, die Hausdächer, die Bäume überpudert mit Schnee. Wie Puderzucker, erzählt sie ihm begeistert am Telefon, als sie oben auf der Alb angekommen ist, ihr seien die Tränen gekommen beim Fahren.
Der Vater holt ihn ab. Sie fahren hinaus in einen der Vororte zum Metzgergroßmarkt Er am Geldautomaten hundert Euro ab. Lass nur«, sagt der Vater, das zahl dann ich.
Der Vater hat einen langsamen Schritt und scheut die Treppen. Drinnen zeigt der Vater ihm das Sortiment., Er genießt es wieder einmal, in der Heimat einzukaufen. Zwei Plastiktüten voll trägt er zum Auto und verstaut sie im Kofferraum. Als sie so stehen, beginnt es aus dem grauen Himmel wieder zu schneien. Einzelne Flocken.
»Das hat er ja wollen«, sagt sein Vater.
»Wer?
»Der Mann im Fernsehen.«