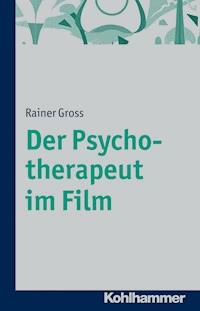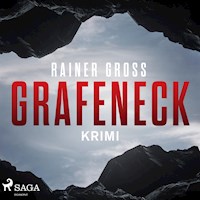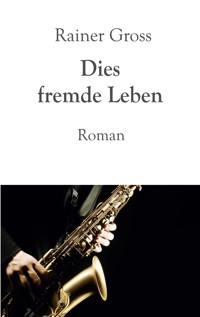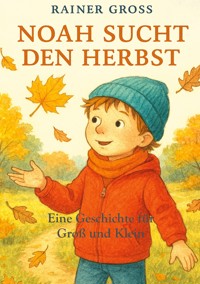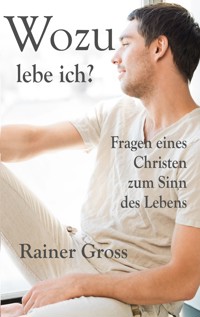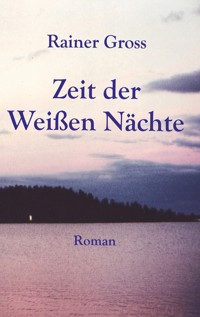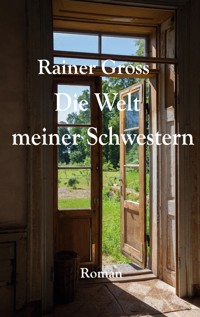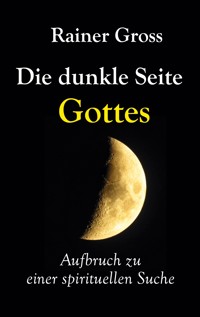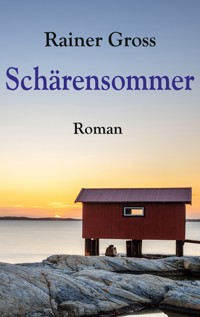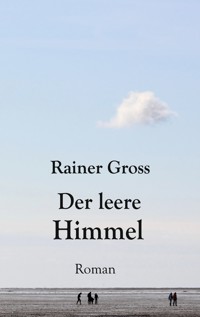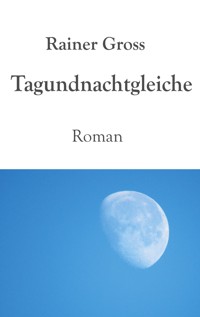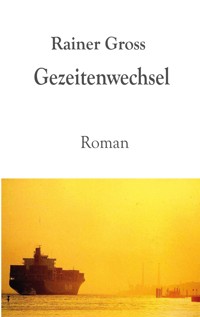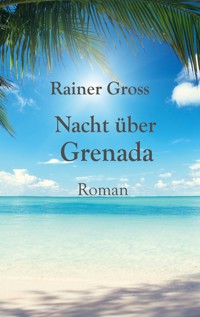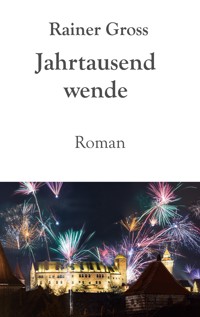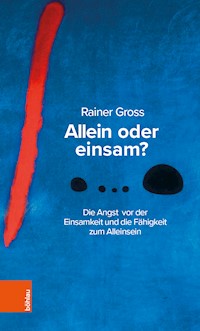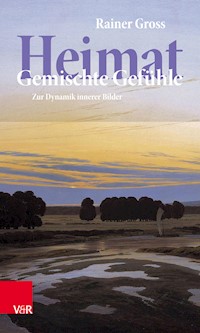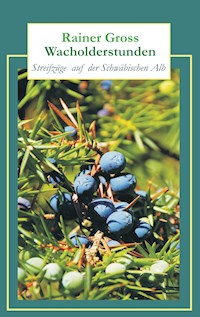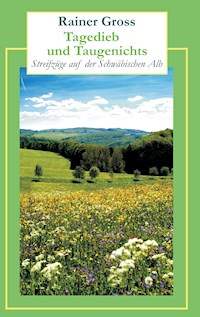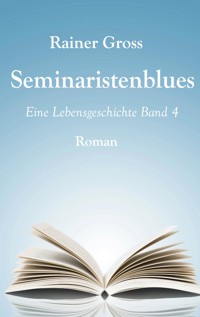
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Suchender. Ein Träumer, ein Dichter, ein Philosoph. Ein Springinsfeld und Taugenichts. Ein Novize und Scholar. Motorradfahrer, Teetrinker und Pfeifenraucher. Eine Hochsensible Person. Ein Rebell mit verstecktem Philisterwunsch. Japan-Fan und Zen-Buddhist. Atheist und Theologe. Fabrikarbeiter, VHS-Dozent, Teeverkäufer. Selbstmordkandidat. Bach-Liebhaber- dies alles ist oder war Joachim Klein. Der vorliegende Roman berichtet aus seinem Leben, vor allem aus den Jahren am Theologischen Seminar 1995 bis 2000. Warum? Weil ich denke, dass seine Person und seine Geschichte eine ausführliche Darstellung verdient haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Suchender. Ein Träumer, ein Dichter, ein Philosoph. Ein Springinsfeld und Taugenichts. Ein Novize und Scholar. Motorradfahrer, Teetrinker und Pfeifenraucher. Eine Hochsensible Person. Ein Rebell mit verstecktem Philisterwunsch. Japan-Fan und Zen-Buddhist. Atheist und Theologe. Fabrikarbeiter, VHS-Dozent, Teeverkäufer. Selbstmordkandidat. Bach-Liebhaber– dies alles ist oder war Joachim Klein.
Der vorliegende Roman berichtet aus seinem Leben, vor allem aus den Jahren am Theologischen Seminar 1995 bis 2000.
Warum? Weil ich denke, dass seine Person und seine Geschichte eine ausführliche Darstellung verdient haben.
Rainer Gross, Jahrgang 1962, geboren in Reutlingen am Fuß der Schwäbischen Alb, studierte Philosophie, Literatur und Theologie. Heute lebt er mit seiner Frau als freier Schriftsteller wieder in seiner Heimatstadt. Er erhielt 2008 den Friedrich-Glauser-Debütpreis.
Bisher sind rund siebzig Titel von Rainer Gross erschienen. Zuletzt veröffentlicht: Novemberland (2023); Schafsgezwitscher (2023); Das heiratende Mädchen (2023); Jesus trinkt den Kaffee schwarz (2024); Café im Hof (2024); Abschied in Cork (2024).
Des vielen Büchermachens ist kein Ende,
und viel Studieren ermüdet den Leib.
PREDIGER 12,12
Inhalt:
Vorwort
1 Umzug
2 Auf dem Heiligen Berg
3 Fleisch und Knochen
4 Enfant terrible
5 Doppeltes Spiel
6 Gut, dass wir einander haben (Reprise)
7 Date in Dhünn
8 Durch die Maschen
9 Fußball
10 Deutsch
11 Das Geheimnis (Reprise)
12 Um sieben zum Chorkonzert
13 Beinkleider
14 Das ist alles nicht so einfach
15 Hamburg
16 Seemannsmission
17 Konnichi wa
18 Teekontor
19 Parkbank
20 Das Tor zur Welt
21 BMW
22 Zeichen
23 Twelve Moons
24 Jenseits des Spiegels
25 Ein Ende mit Schrecken
26 Saure Kutteln
27 Jeremiah Johnson
28 Evangelium des Buchdruckers
29 Missio Dei
30 Showdown in Selbitz
31 Officium
32 Traum
33 Renaissance
34 Anja
35 Volleyball
36 Die kleinen Füchse
37 Die dreifache Schnur
38 God’s fingerprints
39 Herbstbotschaft
40 Pas de deux (Reprise)
41 Lebkuchenstadt
42 Psycho-Doc
43 Die Auflehnung
44 Bachelor
45 Marshügel
46 Kurswechsel
47 Du und ich
Vorwort
»Ich plane meine Memoiren«, sagte mein Freund Joachim Klein vor ein paar Jahren zu mir. »Und du sollst sie schreiben. Ich bin Schriftsteller wie du. Aber das kann ich nicht.«
Ich war einverstanden, und so erzählte er mir in zahlreichen Treffen sein bisheriges Leben. Ich machte mir Notizen, fragte nach, ordnete chronologisch und entwarf den Text. Wir besprachen ihn gemeinsam, diskutierten darüber und einigten uns immer.
In diesem Roman erzähle ich also aus dem Leben von Joachim Klein, und zwar vor allem die Seminaristenjahre 1995 bis 2002. Es ist immer eine Herausforderung, aus dem Leben einer wirklichen Person zu erzählen. Der Stoff ist vielfältig, die Zusammenhänge sind komplex, und das Bild, das man von der Person zeichnet, ist immer subjektiv und Stückwerk.
Dennoch habe ich versucht, dieses Buch ehrlich und wahrhaftig zu schreiben. Die geschilderten Ereignisse haben alle stattgefunden, und doch musste ich eine stimmige Geschichte daraus machen, was bedeutete: Zusammenhänge vereinfachen, Stoff auswählen, alternative Aspekte ignorieren.
So ist die Geschichte über Joachim Klein beides: fiktiv und biografisch, erfunden und real. Bei all dem kam es mir darauf an, Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, den Menschen Joachim Klein nahe zu bringen, aus dem Grund, weil ich denke, dass er und seine Geschichte eine ausführliche Darstellung verdient haben.
Reutlingen, Mai 2025
Seminaristenjahre
1995 – 1999
1 Umzug
Joachim zog um. Aus dem Zimmerchen bei seinen Eltern aus und in das WG-Zimmer in Leutkirch ein. Genauer: in Tautenhofen bei Leutkirch.
Das Theologische Seminar lag auf einer Höhe über dem Dorf. Er würde eine halbe Stunde Fußweg haben.
Es gab nicht viel zu transportieren. Den meisten Platz nahmen die Bücher ein und ein Schränkchen, das Joachim mitnehmen wollte.
In dem WG-Zimmer waren ein Schrank, ein Schreibtisch und ein Bett vorhanden.
Der Transporter von Lukas war geräumig. Die Kartons nahmen sich klein aus im Innern, sodass Joachim das Schränkchen vollständig mitnehmen konnte.
Ulrich und Britta kamen spät und hatten die Birne zur Schreibtischlampe verloren.
Beim Abschied von zuhause schaute Joachim zu spät nach dem Balkon im fünften Stock, der Blick war durch die Bäume versperrt, er sah seine Mutter nicht winken.
Es war kalt, sie fuhren in einer Reihe, solange möglich, auf die Alb hinauf nach Riedlingen.
Als sie die Alb überquert hatten, ging es in die Donauebene hinaus und weiter ins Voralpenland.
Bald waren die Alpen am Horizont zu sehen.
Das Land gefiel Joachim. Weite Wiesen, Wäldchen, allenthalben Wasser als Sumpf und See.
Lukas und ein Bruder aus der Gemeinde fuhren voraus. Joachim hielt mit dem Motorrad Anschluss und versuchte zugleich, Ulrich und Britta hinter sich im Auge zu behalten.
Hinter Bad Wurzau führte die Straße von Dorf zu Dorf. Es ging an einem Flüsschen entlang durch Weiler mit so drolligen Namen wie »Herrgotts«, »Brugg« und »Bauernhanses«.
In Diepoldshofen fanden sie die Abzweigung nach Willerazhofen, wo es dann nach einigen Abzweigungen nach Tautenhofen ging.
Der Himmel riss auf zu leuchtendem Blau, Wolken kreuzten sich bändrig und bauschig, Tautenhofen lag am Rand der Leutkircher Heide, und oben auf der Höhe das Seminar, dörflich verwaist am Mittag.
Auf dem Parkplatz stellten sie ab, und Ulrike, eine Schülerin, die hier putzte, empfing Joachim.
Er erhielt den Schlüssel für die Wohnung, die Anderen besahen sich die künftige Stätte seines Wirkens.
Draußen, am Schulhaus vorbei, sah man über den Feldern und Höhenrücken die weiße Küste der Alpen stehen.
In Tautenhofen fanden sie dann den Ernst-Thalberg-Weg. Joachim hatte das Haus von der ersten Besichtigung her anders in Erinnerung.
Und sein Zimmer mit der Dachschräge kam ihm kürzer vor.
Die Kartons waren schnell verstaut, Heike im zweiten Schuljahr brachte den Schlüssel zur Schule, damit sie die Möbel holen konnten, die dort auf dem Dachboden standen.
Auf der schmalen Stiege im Haus war der Schrank, der abtransportiert werden sollte, zu breit. Sie hievten ihn kurzerhand übers Balkongeländer und empfingen ihn vier Mann stark im Garten.
Auf dem Dachboden der Schule suchten sie inzwischen die Teile für den neuen Schrank zusammen. Und Joachim wählte aus den vier Schreibtischen, die dort lagerten, den schönsten aus.
Aus einem Besenstiel verfertigte Lukas eine Garderobenstange für den neuen Schrank, und die Rückwand bog sich, weil sie nicht richtig passte.
Zwischendurch gab es Essen: Britta hatte den mitgebrachten Reistopf warmgemacht, die Küche geputzt, den Tisch gedeckt. Es gab dazu Weißbrot und Sprudel.
Als die Anderen sich über Jacques le back unterhielten und darüber, wo in Reutlingen einer zu finden sei, und sie die Namen der Straßen und Orte nannten, versetzte es Joachim einen Stich.
Der Umzug hierher war noch Abenteuer oder Unternehmen, aber kein Abschied, kein Bleiben. Das hatte er noch nicht begriffen.
Der Nachmittag verstrich mit Schrankaufbau und Hin- und Herstapeln der Kartons.
Joachim hatte wenig zu tun. Er wurde müde und bekam Kopfschmerzen.
Zusammen mit Britta schaute er die Fotos an, die er damals von ihr gemacht hatte, als er nach Fiji aufgebrochen war.
Das war damals tatsächlich ein Abschied gewesen.
Wann hatte er es damals begriffen? Im Flugzeug nach Belgrad? Oder schon am Flughafen, das Warten, die Angst und Gerdas Hände in seinen?
Oder schon auf der Fahrt mit Frankieboy im Auto?
Der Schrecken holte ihn immer wieder ein und versenkte ihn in einen Traum, einen hilflosen, übermächtigen Traum.
So nahm er immer von mehr Abschied und sah mehr sterben, als da war.
Schließlich gab es Tee und Kuchen, Striezel hieß der Kuchen, bitte ihn doch herauf, scherzte Joachim.
Sie boten Siegfried aus Hamburg, der im Wohnzimmer seine Bücherwand aufbaute, auch einen Tee an.
Dann brachen Lukas und der Gemeindebruder auf. Joachim steckte ihnen den Umschlag zu, der zuhause vorbereitet worden war. Ulrich und Britta blieben noch.
Der Rechner wurde angeschlossen, der Monitor auf der neuen Konsole platziert, der Drucker auf den Tisch zwischen Schreibtisch und Fensterbank gestellt.
Er funktionierte.
Der Platz am Fenster mit der Fensterbank, auf der er seine Tasse Tee stehen haben würde und den Aschenbecher für die Pfeife, gefiel Joachim sofort.
Im Sessel würde er sitzen und ein gutes Buch lesen, während draußen über Tautenhofen die Dämmerung sank oder Regenschauer niedergingen oder der kalte Ost Schneefahnen aufblies. Ein erster vertrauter Ort.
Britta wurde müde, und Ulrich meinte, sie würden nun allmählich aufbrechen.
Vor diesem Moment hatte Joachim sich gefürchtet, aber das große Elend blieb aus.
Er drückte Britta noch einmal, Ulrich nahm ihn überraschend in den Arm. Draußen am Auto in der Kälte standen sie noch auf eine Zigarettenlänge und redeten über die Unbegreiflichkeit des Hierseins und sein baldiges Wiederkommen.
Nein, dachte Joachim, er wollte hier keine andere Heimat finden. Es sollte keine geben außer seiner Alb.
Er würde vier Jahre im Exil verbringen, Zweitwohnsitz, auswärtiger Seminarist der Gemeinde, wie es im Gemeindebrief stand.
Er würde sich einrichten in der Fremde, Landschaft und Menschen kennen lernen, Schönheiten finden und Geheimnisse entdecken, würde Freude haben über das Neue und Spannende und die Herausforderung.
Aber er würde keine neue Heimatliebe fassen. Er würde diesen Ort nicht zu einer Heimat machen.
Dann setzten sich die beiden ins Auto. Joachim sah sie im Geiste auf den dunklen Landstraßen bis Riedlingen fahren, Britta müde und dösend, Ulrich schweigend und aufmerksam.
Joachim kannte ja die Heimfahrten mit den beiden. Fast wünschte er sich, er könnte diese Heimfahrt nun haben mit den beiden.
Aber es war in Ordnung, als sie losfuhren und er am Gartentor wartete und winkte und Brittas Hand noch aus dem Fenster winken sah, bis sie in der Dunkelheit verschwanden.
Er ging den Weg zurück zum Haus.
Kurz brannten ihm die Augen und schnürte es ihm die Kehle zu.
Dann stieg er die Treppe hinauf, fand statt der Erinnerung an jedes kleine Wort, jede Begebenheit, jede Geste des Tages nur sein neues Zimmer vor, die Kartons, die es auszupacken, das Gefüge seines Alleinseins mit sich selbst, das es einzurichten galt.
Bis nach Mitternacht hatte er außer zwei Kartons alles eingeräumt.
Der Schrank voller Wäsche, die Jacken und Anzüge hingen, die ersten Bücherreihen füllten die Regalbretter, Kalender waren an den holzverkleideten Wänden, auf der Fensterbank standen das Usambara-Veilchen, der Osterkaktus, der Bonsai und die Grünlilien.
Auf dem Tisch lag neben dem Drucker die Blechschachtel Zigarren, Streichhölzer und die Pillendose.
Die Mutter hatte angerufen, er nutzte die Gelegenheit, um Grüße an die Gemeinde zu übermitteln.
Spät in der Küche vesperte er. Die Wurst vom Eninger Metzger war deftig, das Brot knusprig, die Tomate knackig, der Pfirsichtee erfrischend.
Er spülte Teller und Messer ab und legte den Rest zurück in den Kühlschrank.
Siegfried kam währenddessen von Leutkirch zurück. Auf dem Roller war es eisig gewesen, er duschte und ging ins Bett.
Seither saß Joachim, eingerichtet, und schrieb den letzten Tag im September in sein Tagebuch.
Er wusste nicht, wie es ihm ging.
Er wollte den Tag noch nicht weggeben. Er wollte wachbleiben und horchen. Reden. Den neuen, heimeligen Ort begrüßen und einnehmen. In den Büchern blättern und den ersten Atemzug Literatur nehmen.
Neben den Deutschbüchern hatte die Teekanne ihren Platz gefunden, und die Motorradhose hing an der Schranktür, als sei er in einer norwegischen Stue.
Er dachte daran, dass Gott ihm zuschaute. Dass er ihn stärken wollte in dem neuen Leben, das er nicht verstand.
Magsein, wenn er die Entfernung begriff, die hundertzwanzig Kilometer an einem warmen Oktobernachmittag und Ankommen in Reutlingen, dann verstand er auch, wo er war und dass er genau diese hundertzwanzig Kilometer – nicht weniger und nicht mehr – von seinem alten Leben entfernt war.
2 Auf dem Heiligen Berg
Der Begrüßungsabend war am Sonntag.
Joachim hatte sich umgezogen in Jeans und T-Shirt und Jacke, ging zu Fuß, die steile Steige hinab ins Tal, wo der Bach floss, und den Berg hinauf, wo das Seminar lag.
Durch die dunklen Felder ging er auf das erhellte Gebäude zu, er sah es von Weitem, und es überlief ihn ein Schauer der Geborgenheit.
Er trat ein in Licht und Lärm, stand erst einmal da, schaute sich das Getriebe an. Da kam auch schon einer auf ihn zu und begrüßte ihn.
Er sah die Lehrer wieder, die er vom Bewerbungsgespräch her kannte. Er lernte die WG-Bewohner, Siegfried und Thomas und Johannes kennen, und er sah in eine Menge fremder Gesichter.
Der Studienleiter Herr Pfeiffer begrüßte ihn und fragte, wie seine Unterkunft sei und ob alles geklappt habe.
Dass der Schreibtisch, den er sich auf dem Dachboden hatte reservieren lassen, nicht mehr da gewesen war und er einen anderen, unansehnlichen hatte nehmen müssen, sagte Joachim nicht.
Dann ging es hinein in den Andachtssaal.
Der Saal war mittels Schiebewänden unterteilbar in drei Klassenräume. Sonst war er der Andachts- und Veranstaltungssaal und hatte vorn eine Empore mit einer Kanzel.
Die vierte Klasse, die jetzt abging, richtete den Abend für die Neulinge aus.
Das war immer so, erfuhr Joachim. Jede Klasse hatte im Jahr eine Veranstaltung auszurichten. Sie als Eingangsklasse sollten die Weihnachtsfeier gestalten.
Auf dem Programm stand das Zeugnis eines Mitschülers.
Es blieb Joachim im Gedächtnis.
Kraftfahrer aus Wladiwostok, fromm aufgewachsen in frommem Dorf, hatte ihm immer etwas gefehlt. Er hatte gewusst, dass es in seinem Herz kalt war.
Bin ich gegangen schaffen zweihundertvierzig Stunden die Monat, erzählte er, aber Seele immer geweint.
Er rang tatsächlich mit den Tränen, ging unruhig hin und her, kämpfte mit der fremden Sprache, die er nicht gekonnt hatte, als er hier angefangen hatte.
So war das in meine Leben, erzählte er, immer zuerst tun und dann denken. Zuhause hatte er gebüffelt, während seine Kinder ihm zusahen und dann gespannt auf das Ergebnis der Tests warteten.
Schließlich kamen ihm doch die Tränen. Er erzähle hier keine Scherze, sondern sein Leben. Gott habe ihm geholfen, sprechen und schreiben zu lernen.
Er sei jetzt sehr aufgeregt hier vorn, aber in seinem Herz sei Frieden.
Es fand sich rasch jemand, der für ihn betete.
Ein kleines Theaterstück, das die Lehrer mit ihren Eigenarten vorstellte. Lieder wurden gesungen. Ein Musikstück mit Trompete. Kuchen und Tee in der Pause.
Draußen standen dann wieder alle zusammen, in Grüppchen, plauderten, Joachim stand allein und schaute sich das alles an.
Ein paar seiner Klassenkameraden hatte er kennen gelernt. Er würde ihnen morgen, am ersten Unterrichtstag, einen Deutschtest vorlegen, um zu sehen, wie hoch das Niveau war, auf das er sich einstellen musste.
Da kam einer der Lehrer auf ihn zu, Peter Busse, der auch Philosophie gab.
»Joachim, hast du nicht Philosophie studiert?«, fragte er.
»Ja.« Joachim war ein wenig geschmeichelt davon, dass der Lehrer von ihm gehört hatte und ihn ansprach.
»Ich möchte deine Meinung als Fachmann hören«, sagte Busse. »MacArthur, den Kirchengeschichtslehrer, habe ich schon gefragt. Nun will ich dich fragen: Denkst du, dass die Dinge in Wirklichkeit die Gedanken Gottes sind?«
Joachim war verdutzt, fasste sich aber schnell. Er hatte nicht damit gerechnet, gleich am ersten Tag in einen Disput dieser Größenordnung einzusteigen.
»Nein«, sagte Joachim nach einigem Überlegen. »Dann müsste man Gottes Wirklichkeit als eine Überwelt annehmen und hätte wieder das Problem der zwei Welten. Zudem hätte alles in dieser Welt ein abkünftiges Sein, und dann wäre man nahe an der Gnosis und dem Neuplatonismus.«
Busse hörte ihm aufmerksam zu, sagte aber nichts.
Joachim meinte, ein süffisantes Lächeln in seinen Mundwinkeln spielen zu sehen, und wusste nicht, ob die Frage ernst gemeint war oder nur dazu diente, ihn zu prüfen.
Sie fachsimpelten ein bisschen, und Joachim sagte leutselig: »Ich freue mich auf ein Fach bei dir.«
Im Verlauf der nächsten Woche lernte Joachim seine übrigen Klassenkameraden kennen, dreißig Leute waren sie, das war viel.
Die Ausbildung zum Missionar oder Gemeindepastor dauerte vier Jahre. Manche machten nur ein Jahr, als Auffrischung oder zur persönlichen Erbauung. Die meisten zwei Jahre.
Am Ende waren es nur sechs, die die ganze Ausbildung absolvierten und in den vollzeitlichen Dienst gehen wollten.
Die Fachschule war überkonfessionell, das heißt für alle christlichen Richtungen offen.
Da gibt es einen afrikanischen Häuptling, der unter Tarnnamen in Deutschland war, weil er verfolgt wurde.
Da waren mehrere Spätaussiedler, ein Ehepaar aus Brasilien, ein Amerikaner mit herrlichem Akzent, der Joachim später immer mit Stay at ease! begrüßte, einen Singhalesen, einen Musikprofessor aus Albanien, einen Ausbilder von der Bundeswehr, einen Elektriker, einen jungen Hausmeister, der herrlich Trompete spielte, eine Verwaltungsfachfrau, einen Speditionskaufmann, der Matthias hieß und den Joachim immer Matthew nannte, eine alleinerziehende Mutter, einen gestandenen Familienvater über vierzig, einen studierten Rechtsanwalt, Thomas aus Joachims WG.
Es gab Charismatiker und Pfingstler, einen Mennoniten, einen Katholiken, Brüdergemeindler und Landeskirchler.
Eine bunte Vielfalt an Schicksalen und Persönlichkeiten, an Lebensgeschichten und Glaubensrichtungen.
Das war es, was Joachim an diesem Seminar so gefiel, und das war es auch, wovon er sich eine echte Horizonterweiterung versprach.
Einmal setzten sich Joachim und Siegfried im Wohnzimmer der WG zusammen. Joachim machte sich eine Tasse Tee, Siegfried trank Kaffee, und er erzählte Joachim seine Lebensgeschichte.
Manchmal stotterte er ein bisschen und nuschelte. In Südwestafrika geboren, als seine Mutter gerade mit seinem Vater, einem Buren, dort war.
Kurz darauf reisten seine Eltern zurück nach Deutschland, dann der Vater wieder zurück nach Afrika, um sie nachzuholen, später, wenn er etwas aufgebaut hätte dort.
Ihre Briefe seien abgefangen worden, erzählte Siegfried, sodass keiner vom Anderen wusste, was er dachte.
Die entstandenen Missverständnisse führten schließlich zur Scheidung. Erst einige Jahre später, als seine Mutter wieder geheiratet hatte, fand sie die Wahrheit heraus.
In Waisenhäusern aufgewachsen, wo man sich mit Stühlen prügelte, hatte Siegfried es von Anfang an schwer.
Er kam zu keiner ordentlichen Schulbildung, arbeitete in verschiedenen Berufen, machte sich früh als Fuhrunternehmer selbständig, musste das aber aufgeben, weil seine Bandscheibe kaputtging von der Ruckelei auf den Sitzen.
Vor acht Jahren bekam er von Gott ein neues Leben, erzählte er, als stehe jede seiner Entscheidungen unter der Frage, was er nun mit diesem neuen Leben von Gott anfange.
Er ließ durchblicken, dass sein altes Leben vorbei war. In Hamburg gehörte er zu einer Gemeinde, die Joachim bei einem Besuch bei Schorsch sich angeschaut hatte, die Gemeinde am Holstenwall.
Jetzt durfte auch Siegfried sich ausbilden lassen, von Spenden finanziert, zum Evangelisten. Damit er sein neues Leben von Gott noch mehr nutzen konnte, um den Verlorenen die Frohe Botschaft zu predigen, sagte er
Weil er sich nichts hatte kaufen können vor dem Einzug, wollte er zum Essen nach Leutkirch fahren, zum Mäc-Dohnald, wie er immer sagte.
Joachim nötigte ihn zu einer Dose Erbsentopf und Brot, er nahm gerne an.
Manchmal wurden sie vom Geschäftsführer Herr Manz, der so eine Art Mädchen für alles spielte, wie pubertierende Schüler behandelt.
Etwa wenn es darum ging, wie die Schulräume geputzt werden sollten, wer sich beim Aufstellen der Stühle für den Chorauftritt drücken wollte oder dass man die Thermostaten der Heizung im Winter nur auf drei stellen sollte.
Das brachte Probleme mit sich, wenn er Manu – den vierzigjährigen Singhalesen, der aus seinem Heimatland geflohen war wegen der Verfolgung durch die Sikhs – mal eben anwies, er solle zwei Stühle nehmen statt einem und ihn zurückschickte wie einen Küchenjungen.
Vielleicht hatten die Schüler es manchmal verdient, so behandelt zu werden, vielleicht aber auch reagierten sie damit nur auf die Bevormundung.
Herr Manz war ein Mann der Praxis, keine Frage. Er war sicherlich kein geeigneter Menschenführer und hatte keinen Sinn für theoretische Überlegungen.
So musste sich Joachim, als er ein einziges Mal bei einer Lehrerbesprechung dabei sein durfte, anhören, er habe die »Gabe der Verkomplizierung«, nur weil er bei dem Deutschtest, den er für die Schule entwickeln sollte, auf linguistische Grundsatzprobleme stieß.
Das nahm Joachim ihm übel.
Wieder einmal musste er feststellen, dass er als Deutschlehrer nicht ernst genommen wurde.
Er konnte den Konflikt auch nicht ausdiskutieren, weil er in der Lehrerbesprechung sofort abgewürgt wurde.
Offenes Streiten war verpönt.
Der Studienleiter Herr Pfeiffer war ein studierter Mann und passionierter Theologe und sehr bemüht um didaktische und pädagogische Weiterbildung.
Seine Tests strotzten vor neuen Frageformaten, wobei sonst das Multiple-Choice dominierte.
Nur machte auch er, der sich für fehlerlos hielt, Fehler. Die zeigte Joachim ihm jeweils, sachlich und freundlich, in Vieraugengesprächen auf.
Dass etwa im Unterricht für griechische Grammatik die Mehrzahl von Tempus nicht tempi hieß, das war italienisch, sondern tempora.
Oder dass er den abrahimitischen Segen definierte, ohne eine Bibelstelle zu berücksichtigen, die Joachim ihm vorhielt.
Er hörte sich die Einwände interessiert an, befand es aber nicht für nötig, etwas zu ändern.
Immerhin erkannte er, dass Joachim ihm in manchem überlegen war. Ob das zu einer demütigeren Auffassung seiner Lehrerolle führte, war nicht zu erkennen.
Doch im Grunde war er ein liebenswürdiger Kerl und in bestimmter Hinsicht ebenso naiv wie Joachim.
Herr Pfeiffer hatte deshalb in Joachim früh einen intellektuell Ebenbürtigen erkannt und einen Narren an ihm gefressen.
Einige Zeit lang bestand eine Art Mentor-Schüler-Verhältnis zwischen ihnen, innerhalb dessen Joachim ihm sogar persönliche Dinge anvertraute.
Als einer der wenigen Vertrauten durfte Joachim ihn duzen und Christian zu ihm sagen.
Er, Herr Manz und Herr MacArthur waren die Einzigen, die sich siezen ließen. Und außer Pfeiffer siezten sie alle zurück. Sonst duzte man sich.
Pfeiffer wählte Joachim einmal für eine benotbare Sonderaufgabe aus, um seinen Intellekt herauszufordern, ohne zu bedenken, dass er ihm damit Mehrarbeit aufhalste.
Joachim scheiterte aus Zeitgründen an der Sonderaufgabe und wehrte sich dann gegen die Sonderrolle. Er stand als Deutschlehrer schon genug im Abseits.
Irritiert nahm Pfeiffer das zur Kenntnis.
Verstanden hatte er Joachim nie. Er war emotional ein völlig anderer Typ.
Der Kirchengeschichtslehrer MacArthur war ein geborener Schotte.
Er war ein freundlicher, aber ironischer Mann, der immer ein Augenzwinkern zur Verfügung hatte.
Dennoch mochte Joachim an ihm, dass er Fragen und Probleme der Seminaristen ernst nahm.
Im Winter trug er seinen Schal mit Tartan-Muster und hatte immer eine Thermosflasche Tee mit Milch dabei, den ihm seine Frau jeden Morgen machte.
Er trank ihn dann während des Unterrichts.
Er grüßte mit dem herrlich verschrobenen Spruch: »Wünsche einen angenehmen Tag gehabt zu haben« und erwies seiner geliebten Frau die Ehre, indem er fragte: »Glauben Sie an Engel? Ich habe einen geheiratet.«
Joachim sprach ihn einmal auf den Dreißigjährigen Krieg und die Rolle des Schwedenkönigs Gustav-Adolf an. Ob dieser aus christlicher Sicht als Held bezeichnet werden könne.
MacArthur antwortete: »Man kann von ihm halten, was man will, aber ohne ihn wäre die evangelische Sache verloren gewesen.«
Zu wem Joachim ein dauerndes Vertrauensverhältnis aufbaute, sofern das am Seminar möglich war, war der Lehrer für Dogmatik, Robert Klingental.
Ein Studiosus, der gerade seinen Doktor an einer niederländischen Universität machte.
Er dachte wissenschaftlich und systematisch, war besonnen und ruhig, ließ sich von Joachim nicht provozieren, weil er immer eine Antwort auf dessen Fragen wusste, und wenn nicht, gab er es zu und versprach nachzuforschen.
Er war einer, der keine Ehrenkäsereien und Machtspielchen nötig hatte. Mit ihm blieb Joachim über die Ausbildung hinaus verbunden.
Das Lehrprogramm bestand nicht nur aus fünf Unterrichtsstunden pro Tag, also einem Wochenpensum von 25 Stunden, das erfüllt werden musste durch die Kursauswahl.
Es bestand daneben aus dem wöchentlichen Missionarischen Dienst, dem MD, bei dem man einen Jugendkreis leitete, eine Landfrauengruppe betreute oder in die Arbeit einer der umliegenden Gemeinden eingebunden war.
Der Praktische Dienst hingegen deckte die Wartungs- und Pflegedienste im Schulgebäude ab. Er war Joachim als Ausgleich für seine Unterrichtsvorbereitung für Deutsch erlassen.
Dann gab es in jedem Jahr eine Missionarische Woche, abgekürzt MiWo, einen missionarischen Einsatz in irgendeiner Gemeinde in Deutschland, in Zusammenarbeit mit der Leitung vor Ort.
Dort kamen sie dann bei Privatpersonen unter, wurden verpflegt und gestalteten dafür eine Woche lang das Gemeindeprogramm nach eigenen Vorstellungen.
Zu all den Diensten kam der Chor, Pflichtfach in drei Klassen, mit dem sie in Gemeinden in der Umgebung oft am Wochenende auftraten.
Weiter wurde verlangt, dass man sich eine geistliche Heimat für die Ausbildungszeit in einer der Gemeinden ringsum suchte.
Ein straffes Programm voller Bewährungsmöglichkeiten. Wie straff, das sollte Joachim noch zu spüren bekommen.
Der Unterricht selbst wollte alles vermitteln, was man zum Gründen oder Leiten einer Gemeinde, im In- oder im Ausland, brauchte.
Joachim lernte predigen, Kasualien abhalten, Bibeltexte erarbeiten mit Berücksichtigung des Kontextes, des historischen Hintergrunds und der Sprache.
Er lernte die Ergebnisse zu systematisieren und zu deuten, er lernte Seelsorge üben, Unterricht abhalten, bekam Einblick in die Kirchengeschichte, in die evangelische Dogmatik, in die Argumente der historisch-kritischen Methode.
Er lernte neutestamentliches Griechisch, die koinë, wurde eingeführt in das Problemfeld der interkulturellen Kommunikation, erfuhr von der Geschichte der Charismatischen Bewegung, lernte den Evolutionismus gegen den Kreationismus abwägen und ging der Frage der Perseveranz nach, der Frage, ob ein Christ sein Heil wieder verlieren konnte oder nicht.
Dazu hatte sich Joachim schon in der REV eine Meinung gebildet. Er ging davon aus, dass das neue Leben nicht mehr verloren gehen konnte, weil es aus Gott geboren war.
Später erfuhr er von einem evangelischen Pfarrer, dass die Frage der Perseveranz die Hoffnung des Gläubigen ausdrücke, dass Jesus ihn und seinen Glauben hindurchtragen werde bis zum Ziel.
Joachim aß kaum.
Er kam nicht dazu, seit die Veranstaltungen begonnen hatten. Er trank auch kaum noch Tee oder rauchte Pfeife. Das hatte jetzt keinen Platz mehr oder einen anderen als früher.
Die Stunden waren ausgefüllt.
Manchmal empfand er die Tage wie einen Strom, der ihn mitzog, ein großer, übermächtiger Strom.
Er hatte nichts mehr richtig im Griff, kam nicht zum Nachdenken, holte das Erlebte nicht ein. Das Leben hatte einen Vorsprung ins Unbekannte hinein.
Er brauchte sich aber nicht dagegenzustemmen und wieder, wie früher, verzweifelt daraus auszubrechen.
Nein: Er konnte sich treiben, mitziehen lassen von dieser einnehmenden, umgreifenden Gemeinschaft.
Das ist Gottes Wille, dachte er. Gott will, dass ich ein Gemeinschaftsmensch werde, dachte er immer noch.
Gottes Wille ist gut für mich, dachte er.
Gott würde für alle seine Angelegenheiten sorgen, für seinen Seelenfrieden, für sein Bestehenkönnen und Vorankommen.
Abends, wenn alles erledigt war und sich der Schlafmangel von morgens bemerkbar machte, saß er in seiner Klause und fühlte die Geborgenheit.
Er hörte im Haus die Schritte der Mitbewohner, ihre Stimmen, Tellerklappern in der Küche.
Er wusste, dass nichts mehr ihn von hier wegbringen würde. Dass er gut aufgehoben war für die nächsten Jahre.
3 Fleisch und Knochen
Joachim lernte Pfingstler und Charismatiker näher kennen.
Das brachte die alte Auseinandersetzung wieder hoch. Diese Mitseminaristen redeten ganz selbstverständlich von Visionen, von Prophetie, von der spürbaren Gegenwart Gottes, von Eindrücken und Bildern, die sie bekamen.
Für Joachim stellte sich die Frage, ob es solche Phänomene, von denen die Bibel berichtete, heute noch gab.
Wenn sie so freimütig von ihren persönlichen Erfahrungen erzählten, sagte Joachim meist nichts.
Aber es fiel ihm anfangs schwer, das stehen zu lassen. Es passte nicht zu seinen Erfahrungen, die er im Glauben gemacht hatte.
Er neigte dazu, diesen Brüdern und Schwestern schlicht nicht zu glauben.
Andererseits dachte er sich, dass das nicht sein konnte. Sie konnten nicht alle lügen oder sich etwas einbilden.
So schnell kommt es in der Psyche nicht zu Visionen und Auditionen.
Wenn er aber zugegeben hätte, dass ihre Erfahrungen echt wären, dann hätte er sich fragen müssen, wieso er selbst solche Erfahrungen nicht machte.
Joachim hatte bisher Gott selten gespürt, und nie als einen Wärmestrom durch den Körper oder einen schützenden Mantel, der sich um ihn legte, oder dergleichen.
Manchmal hatte er sich solche Empfindungen vorgestellt und sie wohl durch Imagination hervorgerufen. Aber als Gegenwart Gottes hätte er das nicht bezeichnet.
Er musste in seinem Glaubensleben ohne solche Erfahrungen auskommen.
Später nahm er solche Berichte hin, zuckte innerlich die Schultern und ließ die Frage offen.
Manchmal machte ihn das traurig und unzufrieden.
Dann wieder war er ganz dankbar dafür.
Denn solche Erlebnisse würden ihn auch ziemlich beunruhigen und belasten.
Anders behandelte er die dogmatische Frage: Gehörten diese Erfahrungen notwendig zum Glauben hinzu? Oder im Klartext: Musste jeder, der wirklich gläubig war, sie haben? Oder musste man im Negativfall den Glauben desjenigen in Zweifel stellen?
Joachim hatte nie daran gezweifelt, dass er wirklich glaubte.
Woran lag es bei ihm dann?
Bei Paulus fand Joachim Trost. Sein Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen zeigte ihm, dass der Glauben zunächst eine Überzeugung war, ein Vertrauensverhältnis, ein Fürwahrhalten, oft gegen den Augenschein oder gegen die vernünftige Einschätzung.
Verzückende Erlebnisse waren Dreingabe. Gnadengeschenke.
Joachim hatte einmal den Spruch gelesen, dass der Glaube das Knochengerüst sei und die Gotteserfahrungen das Fleisch.
Vielleicht war damit nur die Glaubenspraxis gemeint im Gegensatz zur verstandesmäßigen Überzeugung.
Aber wenn der Spruch recht hatte, dann sah Joachim sich als Gerippe herumlaufen, ein fades, trockenes Kind Gottes.
Die einzigen Erlebnisse dieser Art hatte er schon mehrere Male mit dem Heiligen Geist gehabt.
So hatte er sie zumindest gedeutet.
Dann fühlte er plötzlich eine Leichtigkeit und Freiheit und eine seltene Zuversicht. Alles ging von selbst ohne sein Zutun.
Die Dinge fügten sich und wurden von unsichtbarer Hand geordnet, und was auch immer er jetzt tat, geschah im Einklang mit diesem Vonselbst.
Er brauchte nur sich dem Strom des Geschehens zu überlassen.
Solche Erlebnisse hatte er bei Unternehmungen oder Vorhaben, aber auch mitten im Alltag.
Das war das Einzige, was er den Brüdern und Schwestern hätte erzählen können.
Es blieb im Seminarsalltag nicht aus, dass Joachim selbst einmal zum Adressaten einer solchen Prophetie wurde.
Eines Morgens sprach ihn James, der Amerikaner, im Flur an.
Er war etwas aufgeregt und ernst und fragte Joachim geradeheraus, ob er etwas am Herzen habe. Eine Herzkrankheit oder so.
Joachim verneinte. Wieso?
»Ich habe eine Prophetie empfangen«, sagte James mit seinem drolligen Akzent. »Jemand, der heute Morgen mit einem roten Hemd kommt, hat eine ernsthafte Herzkrankheit.«
»Aber ich habe kein rotes Hemd«, sagte Joachim und wusste nicht recht, was er davon halten sollte. »Das ist ein orangenes Sweatshirt.«
»Du kannst es mir ruhig sagen, Joachim. Wenn du irgendetwas weißt über dein Herz, dann sag es!«
»Tut mit leid, James«, sagte Joachim ungeduldig, »ich habe nichts mit dem Herz. Du sprichst den Falschen an.«
Ratlos blieb James auf dem Flur zurück, als Joachim in seine Klasse ging.
Wohl doch nicht so einfach mit den Prophetien, dachte sich Joachim und konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken.
Wieder einmal zeigte es ihm, dass eine große Grauzone bei solchen »Offenbarungen« herrschte. Und nun stand der arme James da mit seiner Botschaft und fand keinen Abnehmer.
Man hatte es als Charismatiker auch nicht leicht.
Bei Joachim berührten die charismatischen Erlebnisberichte auch die alte Frage der Mystik.
Besonders ihr Anspruch, dass nur ein Glaube mit mystischen Erfahrungen ein lebendiger Glaube sei, provozierte ihn.
Das führte zu Elitarismus und Überheblichkeit, fand er. Von solcher Mystik hielt er nichts.
Aber dass es Mystiker gab in der Kirchengeschichte, die Gott in einer Dimension erfahren hatten, die ihm noch verschlossen blieb, das hielt er durchaus für möglich.
Während der Seminarszeit hielt er einmal ein Referat über Meister Eckard und erkannte bei seinen Recherchen, dass es auch eine Mystik des Intellekts gab.
Da wäre er eher der Kandidat dafür.
Seine Sehnsucht, einmal das Reich der mystischen Erfahrungen mit Gott betreten zu können, blieb allerdings.
Durch die mystischen Erlebnisse, die er vor seiner Glaubenswende gemacht hatte, konnte er sich vorstellen, wie sich das anfühlte.
Manchmal hoffte er, ohne Gott darum zu bitten, dass ihm einmal so ein Geschenk, so eine Gnade zuteil werde.
Mit der Zeit an der Schule fand er sich damit ab, dass manche Christen solche Erfahrungen machten und manche nicht.
Die Anderen hatten dann wohl aus ihrem Erleben und ihrem Glaubensstil heraus recht. Aber Joachim auch, wenn er sagte, so etwas brauche es nicht.
Es war Dreingabe oder vielleicht gerade das, was diese Gläubigen brauchten.
In jedem Fall hatte ihn das Seminar zu einer Auseinandersetzung damit und zu einer eigenen Standortbestimmung genötigt.
4 Enfant terrible
Irgendwann ging Joachim auf, dass er im Seminar arrogant und besserwisserisch rüberkam. Dass die Mitseminaristen und die Lehrer ihn barmherzig erduldeten.
Eigentlich hätte er es sich denken können.
Es war ganz und gar nicht seine Absicht, aber da er als Akademiker auf den dargebotenen Unterricht eine andere Sichtweise hatte, stieß er mit seinen Nachfragen und kritischen Analysen bei den Lehrern nicht immer auf Gegenliebe.
Er wünschte sich eben eine strikte gedankliche Durchdringung des Stoffes.
Was niemand wusste: Es ging ihm – gerade in der Theologie – um Klarheit des Denkens.
Damit nicht etwa unter der Hand Doktrinen vermittelt wurden, die man einfach glauben sollte, statt Erkenntnissen, durch die man überzeugen konnte.
Insgeheim verlangte Joachim von jedem Lehrer, dass er den Stoff, den er vermittelte, selbst durchdacht und auch methodologisch reflektiert hatte.
Manche Lehrer fürchteten ihn regelrecht, und seine Anwesenheit musste für manche ein wahrer Schrecken sein.
So etwa für Peter Busse, der Philosophie unterrichtete und Joachim glatt die Teilnahme verweigerte.
Joachim musste eigens einen zusätzlichen Kurs belegen, um auf seine Stundenzahl zu kommen. Das empfand er als ungerecht.
Aus der Sicht des Lehrers sicher verständlich – wer gab schon gerne als Laie in einem Fach Unterricht, das einer der Schüler erfolgreich studiert hatte?
Andererseits durfte man, fand Joachim, von einem Dozenten am Seminar durchaus verlangen, dass er solche Situationen meisterte und nicht seine Autorität bedroht sah.
Mit Busse geriet Joachim ein einziges Mal scharf aneinander, und zwar gerade bei der Frage der Heilssicherheit.
Busse war der Ansicht, dass ein Christ sein Heil verlieren konnte, etwa dadurch, dass er Selbstmord beging.
Joachim hielt vehement dagegen und meinte am Schluss zornig:
»Ich werde in der Seelsorge keinem Christen sagen, er darf sich nicht umbringen, weil er sonst sein Heil verliert!«
Joachim dachte dabei besonders an Jochen Klepper, der sich mit seiner Familie aus Angst vor dem KZ umgebracht hatte.
Daraufhin erwiderte Busse ebenso scharf:
»Und ich werde keinem Christen dazu raten, wenn er dadurch seine Ewigkeit bei Gott verliert!«
Da hat er recht, dachte Joachim, und seither waren die Fronten geklärt.
Niemand sagte es Joachim: Er wusste es selbst.
Er versuchte, sich beim Melden im Unterricht zurückzuhalten, wartete, dass die Anderen sich zuerst meldeten, wollte sich nicht mit seinem Wissen in den Vordergrund drängen.
Aber wenn sich nach minutenlangem Schweigen keiner meldete, tat Joachim es halt, damit der Unterricht vorankam.
Und oft benutzte Joachim das Zwiegespräch mit dem Lehrer während des Unterrichts, um für sich dringende Fragen und Probleme zu erörtern, die es für die Anderen gar nicht gab.
Da haben sie sicher viel Geduld und Nächstenliebe geübt, dachte Joachim später.
Andererseits profitierten sie auch von seinen Fragen und Beiträgen, fand er.
Joachim war für die Einen ein Quell des Wissens, für die Anderen ein lästiger Querulant. Es kam darauf an, wie man sich zu ihm stellte.
Natürlich ging es Joachim auch um Anerkennung, das konnte er nicht leugnen. Schon begann er, sich nach einem höheren Niveau zu sehnen, nach jemandem, mit dem er theologisch forschen konnte, ohne deshalb den Unterricht zu sprengen.
Ja, manchmal dachte er daran, dass die Akademie in Gießen vielleicht doch die bessere Wahl gewesen wäre.
Joachim hatte Feuer gefangen für die Dogmatik. Sie war ihm ein persönlicher Zugang zum Glauben und zu Gott.
Oft erlebte er es, dass eine theologische Erkenntnis ihm glaubenspraktische Fragen beantworten oder seinen Glauben vertiefen half.
Er war sich dessen nicht bewusst, aber er nahm eine Haltung gegenüber dem Seminar ein, als ob er nicht völlig konform gehe.
Noch war es keine Auflehnung, aber vier Jahre waren lang.
Dadurch, dass er Deutsch unterrichtete, zuerst seine eigene Anfängerklasse, dann die jeweils neue, wuchs Joachims Autonomie und das Gefühl eines Sonderstatus.
Niemand kümmerte sich um seinen Unterricht, niemand erkundigte sich nach dem Verlauf, niemand prüfte die Qualität oder hinterfragte seine Notengebung.
Er konnte völlig eigenverantwortlich verfahren.
Trotzdem reichte er an einen Lehrerstatus mit gewissen Privilegien nicht heran.
Weder wurde er beim Tag der Offenen Tür als ein Teil der Lehrerschaft vorgestellt, noch durfte er der Sonntagabendandacht fernbleiben, wie es die Lehrer taten.
Zugegebenermaßen reizte das manchmal seine Eitelkeit. Dann rief er sich wieder zu Bescheidenheit.
Dennoch blieb diese Rolle eine der vielen Ungereimtheiten am Seminar.
In der vierten Klasse durfte er selbst einen Philosophiekurs anbieten, im Wahlbereich.
Die kleine Runde, die da zusammensaß und versuchte, das philosophische Fragen zu lernen, war für ihn eine ermutigende Erfahrung in dem ganzen Lehrbetrieb.
5 Doppeltes Spiel
Joachim brauchte lange, bis er das Unbehagen, das er am Seminar hatte, benennen konnte.
Da war als Erstes der Druck. Der Zeitdruck, der Notendruck, der Leistungsdruck.
Damit kam selbst er, der das Lernen und geistige Arbeiten gewohnt war, an seine Grenzen.
Anfangs gab er sich Mühe mit jedem Aufsatz, mit jeder Ausarbeitung, mit jeder Leseaufgabe. Er versuchte, sie so gründlich und gewissenhaft zu erledigen, wie er es von sich forderte.
Ja, er versuchte, aus jeder zu erbringenden Leistung für sich einen Gewinn herauszuschlagen.
So untersuchte er für die Analyse einer Beziehung zwischen zwei biblischen Gestalten die Freundschaft zwischen Jonathan und dem jungen David, erstellte ausgefeilte Charakterprofile und fand in dieser Freundschaft ein Vorbild für alle menschlichen Beziehungen.
Bald merkte er, dass das nicht zu schaffen. Nicht bei jeder Aufgabe.
Es waren zu viele. Neben den ganzen Diensten her, die sie zu versehen hatten.
Das bekam Joachim schon im ersten Semester zu spüren, als seine Klasse die Weihnachtsfeier ausrichten sollte.
Bei all dem Lernen und Arbeiten, Klausurschreiben und Verselernen fürs Biblicum planten und organisierten sie die Feier.
Joachim schrieb ein Theaterstück nach bewährter Manier, studierte es ein, übernahm selbst eine Rolle, gab den Moderator der Feier und verfasste noch einen kleinen Vortrag, und im Grunde wusste er nicht mehr, wo ihm der Kopf stand.
Seinen Klassenkameraden ging es genauso, nur stellten sie nicht das Seminar und dessen Konzept in Frage.
Joachim schon. Er fühlte sich persönlich angegriffen von dem Stress, der hier Alltag war.
Er dachte: Die saugen mich hier aus. Die können mich verheizen, wenn ich nicht aufpasse.
Wofür?
Er musste sich abgrenzen, musste Erwartungen und Ansprüche abwehren, sonst würde er unter die Räder kommen.
Hesses Untern Rad fiel ihm ein, und er fragte sich, ob die Zeit seither stehengeblieben war.
Joachim lernte im Laufe des ersten Semesters, Ansprüche, die ihn überforderten, abzuwehren.
Er übernahm nicht alles, nur weil es vorgegeben war.
Er unterlief das Leistungsprinzip und den Ethos des Seminars.
Ihr lernt für Gott, hatte es am Begrüßungsabend geheißen. Gott will, dass ihr euer Bestes gebt!
Joachim war sich sicher, dass Gott keine guten Noten interessierten. Er wollte von seinen Kindern etwas ganz Anderes.
Barmherzigkeit, Nächstenliebe, sich Zurückstellen und Vertrauen. Das aber zu lernen war die Schule der am wenigsten geeignete Ort.