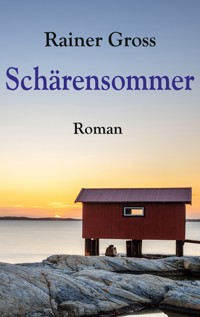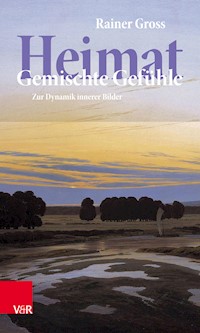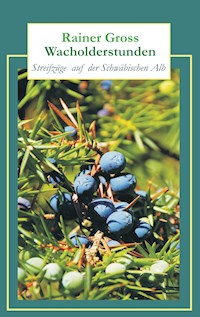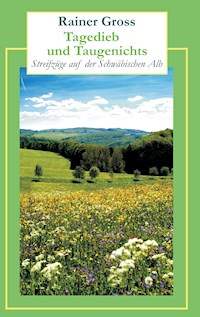6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sylt im Februar. Zum Urlaubmachen ist der ehemalige Missionsprediger Raphael nicht hergekommen. Er ist geflohen, vor der Ent-fremdung in seiner Ehe, vor der unerfüllten Arbeit und vor allem vor dem jahrelangen Schweigen Gottes, das in seinem Leben ist. Da lernt er die todkranke, aber lebenslustige Viki kennen, und es entsteht eine sachte Zuneigung zwischen ihnen. In diesen Wochen, im Angesicht des Todes und der Lust am Leben, geschieht das Wunder einer tiefen Nähe zwischen zwei Menschen, und am Ende scheint sogar das Unmögliche möglich zu werden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sylt im Februar. Zum Urlaubmachen ist der ehemalige Missionsprediger Raphael nicht hergekommen. Er ist geflohen, vor der Entfremdung in seiner Ehe, vor der unerfüllten Arbeit und vor allem vor dem jahrelangen Schweigen Gottes, das in seinem Leben ist. Da lernt er die todkranke, aber lebenslustige Viki kennen, und es entsteht eine sachte Zuneigung zwischen ihnen.
In diesen Wochen, im Angesicht des Todes und der Lust am Leben, geschieht das Wunder einer tiefen Nähe zwischen zwei Menschen, und am Ende scheint sogar das Unmögliche möglich zu werden …
Rainer Gross, Jahrgang 1962, geboren in Reutlingen, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Heute lebt er mit seiner Frau als freier Schriftsteller wieder in seiner Heimatstadt. Er wurde 2008 mit dem Fried-rich-Glauser-Debütpreis ausgezeichnet.
Bisher sind rund siebzig Titel von Rainer Gross erschienen. Zuletzt veröffentlicht: Novemberland (2023); Schafsgezwitscher (2023); Das heiratende Mädchen (2023); Jesus trinkt den Kaffee schwarz (2024); Café im Hof (2024); Abschied in Cork (2024); Jahrtausendwende (2025); Gezeitenwechsel (2025); Tagundnachtgleiche (2025).
Der Tod ist die Grenze des Lebens, nicht aber der Liebe.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Eins
Der Himmel über dem Watt ist leer. In den treibenden Wolken schwimmt ein glutflüssiger Lichtstreif. Der Horizont verschmilzt mit dem Watt und öffnet eine amphibische Weite.
Die Weite lässt Raphael erschauern.
Vogelschwärme streuen darin wie verwahrloste Verse eines Gedichts. Er liest sie, gedankenlos und unbeeindruckt, und spürt die Leere in seinem Kopf, die sie erzeugen.
Der Himmel schweigt. Schon seit zehn Jahren. Der Himmel ist leer und stumm, keine Götter oder Engel wimmeln mehr in ihm. Dort oben ist es einsam und maßlos und unvorstellbar.
Und doch liegt dieser Himmel harmlos und gleichgültig am Montagmorgen über dem Verladebahnhof in Niebüll.
Raphael ordnet sich mit seinem Wagen vor der Auffahrt rechts ein, auf die Spuren neun bis elf des blauen Autozuges nach Sylt. Er hat wie immer das Ticket online gebucht und hält sein Smartphone an das Lesegerät der automatischen Schranke.
Es dauert nicht lange, und er kann mit seinem tannengrünen SUV auf einen Wagen des Autozuges auffahren. Er schaltet den Motor aus, zieht die Handbremse an und lehnt sich zufrieden im Sitz zurück.
Vor ihm steht ein kleiner gelber Opel mit einer Fahrerin darin, die sich auf die Überfahrt vorbereitet. Sie ordnet ihre langen Haare und bindet sie mit einem Haargummi zusammen. Hamburger Kennzeichen.
Raphael ist froh, dass es ein Autozug ist. Da muss er sich jetzt mit niemandem unterhalten.
Er holt aus dem Rucksack auf dem Fahrersitz sein Frühstück. Eine Thermosflasche mit schwarzem Tee und ein Brötchen mit Schinken und saurer Gurke.
Er packt es aus dem Butterbrotpapier, beißt hinein und kaut vor sich hin, während der Zug sich ruckelnd in Bewegung setzt.
Fünf Stunden hat er gebraucht für die vierhundertfünfzig Kilometer Autobahn von Osnabrück hierher. Er kennt die Anfahrt nur vom Sommer. Wenn er und Sina in den Ferien nach Sylt gefahren sind in ihr Ferienhaus.
Sie haben es vom Erbe von Sinas Großtante gekauft, sonst hätten sie es sich nicht leisten können.
Er wollte nicht auf den Sommer warten. Er wollte jetzt nicht die bevölkerte Ferieninsel.
Er wollte Sylt im Februar: das Meer bei Wolken und Nebel, einsame Strandspaziergänge, abends lesen im Sessel beim Licht der Stehlampe.
Er wollte allein sein. Allein mit seinen Gedanken und dem Schweigen, das seit zehn Jahren in seinem Leben ist.
Er hat unbezahlten Urlaub genommen und seine Frau zurückgelassen. Es kommt ihm vor wie ein Bruch, ein Verrat.
Der Verrat ist langsam gekommen, hat sich angeschlichen wie ein Dieb, hat ihn eines Tages überrascht mit vagen Plänen und Bildern eines Wintermeeres im Kopf.
Er brauchte Zeit.
Tagsüber kommt er zu nichts, seine Arbeit stiehlt ihm die Zeit. Und die Abende zuhause sind isoliert und einsilbig im Wohnzimmer mit dem Fernseher.
Er sagt Sina schon lange nicht mehr, was in ihm vorgeht.
Er hat ihr am Anfang von seinem Leben als Evangelist erzählt, von seinen Vorträgen und Reisen und Veranstaltungen. Dann von dem plötzlichen Schweigen Gottes: dem leeren Himmel.
Sina ist nicht gläubig. Nicht einmal gläubige Muslimin, obwohl ihre Großeltern Migranten aus dem Iran waren. Ihre Eltern haben sie liberal und modern erzogen, tolerant, wie sie sagt.
Sie hat ihm zugehört, geduldig, neugierig darauf, ihn und seine Seele kennen zu lernen. Heute hätte er das Gefühl, als belästigte er sie wieder mit einer seiner Befindlichkeiten.
Es war ein Befremden zwischen ihnen, von dem keiner wusste, woher es kam. Nun sind sie beide wieder zusammengekommen, als hätten sie nur kurz die Hand des Anderen losgelassen und wären nebeneinander hergegangen, eine Zeitlang. Und nun, da sie sich wiedergefunden haben, ist alles anders geworden.
Sie schauen sich manchmal an, traurig und ratlos und irritiert von der aufdringlichen Nähe des Anderen. Sie wissen nicht recht, was sie miteinander anfangen sollen.
Der Zug fährt auf den Hindenburgdamm hinaus. Ein schmales Stück Land, das sich in die grausilbrige Fläche hinaus schiebt.
Zwei Gleise, der Damm auslaufend in sachter Böschung. Daneben die rechtwinkligen Lahnungen, die den Sand in kleinen Äckern fangen. Dahinter das graue, ölglatte Meer.
Die freie Strecke übers Watt ist kürzer als erwartet. Nach einer Viertelstunde taucht schon Morsum auf, und jetzt, im Februar, kommt Raphael die Strecke noch kürzer vor.
Im Sommer ist das Meer blau und der Sand hell. Westerland grüßt mit Wimpeln und Fahnen. Die Ferienstimmung dehnt die Anfahrt zu einer Reise übers Meer.
Heute ist der Damm eine menschengebaute Rampe durch Schlick und Sand, einfältig und geheimnislos. Sie überwindet nur das Unbegehbare zwischen Land und Insel.
Raphael nimmt den letzten Bissen von seinem Schinkenbrötchen, trinkt den Becher Tee leer. Er horcht in sich hinein, ob das Meer nicht doch sein Wort an ihn gerichtet hat. Aber auch das Meer schweigt.
Die Einfahrt in Morsum ist wenig archipelagisch. Regenstumpfe Hausdächer, kahle Gebüschreihen, Grasland mit Weidenzäunen.
Weiter geht es nach Keitum und dann nach Westerland.
Als er in Westerland ankommt und vom Zug herunter fährt, ordnet er sich ein und folgt den Hinweisschildern nach Hörnum. Er wird auf der einzigen Straße des schmalen Inselstreifens nach Süden gelangen.
Er lächelt. Er ist wieder auf der Insel, auch wenn es Februar ist. Er atmet auf.
Wie eine geglückte Flucht, denkt er. Weg von zuhause, raus aus allem.
Eine Flucht ins Nirgendwo.
Die Insel wirkt verschlossener und ernster als im Sommer. Sie hat eine gewöhnliche Nacktheit, ohne Allüren. Ein Gestade im nordischen Meer, das seine Strände feilbietet unter bleiernem Himmel.
Er fährt die Straße entlang, links das Watt, rechts das Meer. Das Haus liegt in den Dünen vor Hörnum, ein wenig abgesondert von den anderen Feriensiedlungen.
Erst als er von der Straße abbiegt und den Dünenweg entlang schaukelt, merkt er, dass er das Festland weit hinter sich gelassen hatte.
Er hält vor dem Haus an, schaltet den Motor aus.
Es ist doch eine Überfahrt gewesen, denkt er. Eine Fahrt über den Styx. Eine Goldmünze unter der Zunge für den Fährmann.
Jetzt ist er unsterblich.
Zwei
Raphael geht durchs Haus und öffnet die Fensterläden. Sie haben im letzten Sommer alles winterfest gemacht. Er schaltet den Strom und die Heizung an, dreht das Wasser auf und schaut in allen Zimmern nach dem Rechten.
Er schaut in der Küche im Vorratsschrank nach, was noch an Konserven da ist. Er bestückt die Mülleimer mit neuen Plastiksäcken.
Dann steigt er hinauf ins Dachgeschoss und packt im Schlafzimmer seinen Koffer aus.
Er hat nicht viel mitgenommen. Freizeitkleidung, einen dicken irischen Pulli, Unterwäsche. Er weiß nicht, ob er die ganzen vier Wochen bleiben wird.
Durch das halbrunde Fenster des Schlafzimmers blickt er auf den Hauseingang und das Carport, die im Lee liegen, nach Osten.
Vor der Terrassentür im Wohnzimmer stehen zwei Paar Gummistiefel, am Haken hängt seine Regenjacke. Darin macht er immer seine Strandspaziergänge.
Sina amüsiert sich gern über ihn, über sein nordfriesisches Outfit, aber ihm ist das egal.
Draußen auf der Terrasse zeigt das Thermometer an der Hauswand vier Grad. Ein kalter Wind weht. Der Himmel ist jetzt bedeckt, es sieht aus, als sollte es gleich zu regnen beginnen.
Er fröstelt und macht sich in der Küche einen Tee.
Er nimmt die blauweiße Kapitänstasse aus dem Geschirrschrank, füllt den Wasserkocher und löffelt aus einer Blechbüchse den Tee in das Drahtnetzsieb.
Als das Wasser kocht, gießt er auf und lässt den Ostfriesentee drei Minuten ziehen. Er nimmt das Sieb heraus und setzt sich mit der dampfenden Tasse an den Küchentisch.
Durchs Fenster kann er hinaus auf die Dünen sehen.
Er nimmt vorsichtig einen Schluck. Der Tee ist genau richtig, frisch und würzig mit einer leisen Spur von Bitterkeit. Er trinkt ihn, nicht wie sonst, ohne Kandis und Sahne.
Er sitzt da in den Kleidern, die er auf der Fahrt getragen hat. Er will ankommen.
Begreifen, dass er nun hier ist. Außerhalb der Saison, völlig außer der Zeit.
Was soll er die ganzen vier Wochen machen? Was hat er sich vorgestellt?
Er denkt an den Abend und vermisst schon jetzt die Behaglichkeit, die er zuhause hat. Das breite Sofa, den Fernseher mit dem Großbildschirm, den gefüllten Kühlschrank.
Er wird eine Menge einsamer Abende vor sich haben. Aber das kleine Häuschen ist gemütlich.
Er beschließt, Küche und Wohnzimmer einzuheizen und im Schlafzimmer die Heizung auf zwei zu stellen. Das Gästezimmer und das Bad würde er unbeheizt lassen.
Er nimmt noch einen Schluck. Bereit sein ist alles, denkt er müde.
Bin ich bereit?
Bereit wozu?
Draußen ziehen sich die Wolken zusammen, es wird dunkel im Haus. Fast ist er versucht, das Licht einzuschalten.
Er sitzt und denkt nichts. Sein Kopf ist so leer wie der Himmel, so leer wie seine Seele. Er horcht in sich hinein, aber er spürt nichts als eine sachte Genugtuung.
Nichts treibt ihn mehr. Er hat keine Angst, ist nicht wütend, fühlt sich nicht einsam. Das Einzige, was er fühlt, ist ein sachtes Kribbeln im Magen.
Er merkt, dass er nervös ist.
Als stünde ihm eine wichtige Begegnung bevor. Als käme bald ein Gast zu ihm ins Haus und würde mit ihm sprechen wollen. Oder als hätte er jemanden eingeladen, um mit ihm ein wichtiges Gespräch zu führen.
Wer könnte das sein?, fragt er sich.
Eine Vorahnung?
Aber das ist Unsinn, er erwartet niemanden. Niemand wird kommen. Er wird allein sein.
Es wird mir hier nichts geschehen, denkt er. Ich werde hier vier Wochen lang warten, jeden Abend, darauf, dass etwas geschieht, und ich werde wieder abfahren, enttäuscht und verbittert, und mich fragen, was das für eine Schnapsidee war.
Im Wohnzimmer wartet der Kamin. Er wird ihn sicher das eine oder andere Mal anfeuern. Treibholz liegt in einem Stapel daneben bereit, Holz, das er im Sommer am Strand gesammelt hat. Er hat es vor dem Haus kleingemacht und im Wohnzimmer aufgeschichtet.
Er wird wieder am Strand spazieren und Treibholz sammeln. Jetzt, im Winter, werden die Stürme manches Holz an Land spülen.
Er denkt an seinen kleinen Handwagen, der im Schuppen steht. Das kleine, selbst gebaute vierrädrige Wägelchen, mit dem er immer loszieht, wenn er Treibholz sammelt.
Das wird er wieder in die Hand nehmen, den Strand entlang gehen nach Norden oder hinunter an die Inselspitze, die Augen auf den Gürtel aus angeschwemmtem Meerkraut, Muscheln und leeren Flaschen gerichtet, spähend nach allem, was aus Holz ist.
Beim Treibholzsammeln kommt er zur Ruhe. Da ist er mit dem Meer und dem Augenblick allein. Da ist er mit seinem Leben im Reinen.
Denkt nichts, späht nur, ein sachter Beutetrieb, der ihn, wenn er fündig geworden ist, mit Herzklopfen zugreifen lässt, bis er das Stück geborgen hat.
Am schönsten ist es, wenn er das Holz im Kamin verbrennt, abends bis in die Nacht hinein. Im Sonner ist es lang hell.
Er schaut dann zu, wie die Flammen grüne und blaue Ränder bekommen vom Salz, wie das fahl glüht und glimmt, er kann stundenlang sitzen und schauen, und niemand weiß, was so ein Feuer aus Treibholz mit ihm macht.
Er gähnt und spült die Tasse unterm Wasserhahn ab. Er klopft das Drahtsieb im Mülleimer aus und spült es ebenfalls ab. Tasse und Sieb lässt er auf der Anrichte stehen.
Er ist müde. Es drängt ihn an den Strand, um das Meer zu begrüßen. Aber er hat keine Lust, den leeren Himmel zu sehen.
Er lässt die Rollläden im Wohnzimmer herunter und legt sich aufs Sofa. Er deckt sich mit der Wolldecke zu, die immer dort liegt, und schaltet den Fernseher ein.
Er schließt manchmal die Augen und hat vom Fernseher ein Hörspiel. Einmal schreckt er auf und merkt, dass er eingedöst ist.
Er schaltet mit der Fernbedienung den Apparat aus, dreht sich zur Wand, zieht die Decke bis zum Kinn und schläft rasch ein.
Drei
Als er aufwacht, ist es dunkel im Zimmer. Als Erstes hört er den Wind, der ums Haus geht und in den Regenrinnen pfeift.
Es ist Abend geworden. Nun braucht er den Himmel nicht mehr zu sehen.
Er steht auf, nimmt die Taschenlampe aus dem Küchenschrank, zieht seine Gummistiefel und seine Regenjacke an und verlässt das Haus durch die Terrassentür.
Der Wind hat aufgefrischt, der dunkle Himmel ist grau von Wolken. Er geht zwischen den Dünen hindurch und nimmt den schmalen Pfad, der zum Strand führte.
Er ist noch benommen vom Schlaf, wird aber wach und ruhig, je mehr er in den gewohnten Tritt findet.
Er hat nicht auf den Tidekalender geschaut. Er lässt sich überraschen, ob ablaufendes oder auflaufendes Wasser ist.
Der Strand ist leer, dunkel und dämmrig liegt er vor ihm. Das Meer ist im Zwielicht kaum auszumachen.
Er geht, bis er mit den Stiefeln im Wasser steht, und denkt zufrieden: Flut.
Er geht am Wellensaum entlang und lässt das Wasser an seinen Stiefeln vorbei auf den Strand strömen. Das sachte Rauschen und das Fauchen des Windes, nichts sonst. Einzelne Möwenschreie im Dämmer, und fern hört er den Ruf eines Regenpfeifers. Ein hartes tschä tschä tschä, gefolgt von einem langen, traurigen riuuuh.
Raphael wundert sich. Sind die Regenpfeifer nicht um diese Zeit noch in Afrika? Manchmal, im Sommer, macht er sich einen Spaß daraus beobachtet mit dem Feldstecher die verschiedenen Vögel, die sich am Strand und im Watt tummeln. Schnepfen, Kiebitze, Strandläufer, Möwen, Seeschwalben und das ganze Federvolk. Er hört ihre Stimmen und Rufe und kann sie mittlerweile unterscheiden.
Die Regenpfeifer gefallen ihm besonders: kleine, scheue Vögel mit kurzen Beinen und dem schwarzweißen Maskengesicht. Wie sie eifrig durch den Schlick und die Salzwiesen staksen und ihre Nahrung aufpicken. Wie sie der Wasserlinie hinaus folgen. Wie ihre Jungen rufen, wenn sie ihr Nest verloren haben. Über den Salzwiesen blüht rosenrot der Strandflieder.
Er hat den Wind im Rücken und zieht die Kapuze über den Kopf. Es ist kalt. Er hätte den dicken irischen Pullover anziehen sollen. Er hat vergessen, dass es Februar ist.
Ein wenig schaut er nach Treibholz aus, funzelt mit der Lampe den Strand entlang, findet aber nichts. Im Lichtkegel der Lampe treiben kleine, harte Schneekörnchen. Seine Hand, die die Lampe hält, wird eisig.
Es ist zu unwirtlich, denkt er. Ich komme nicht in das gewohnte Alleinsein mit dem Meer. Ich müsste eine Stunde gehen, aber dazu ist es zu kalt. Ich muss mich erst an den Winter gewöhnen.
Er geht und geht, seine Stiefel sinken im Sand ein. Manchmal bleibt er stehen und blickt hinaus auf die Nordsee, wo sich sein Blick im Dunkel verliert.
Das Meer macht ihn heute unruhig. Irgendetwas daran fordert ihn heraus. Es macht ihn geradezu wild: kühn und verwegen und rücksichtslos.
Er wird sich nachher, wenn er zurück ins Warme kommt, etwas zu essen machen. Nudeln kochen und ein Glas fertige Tomatensoße öffnen.