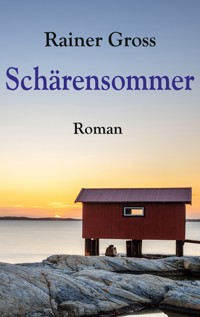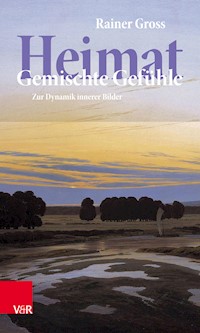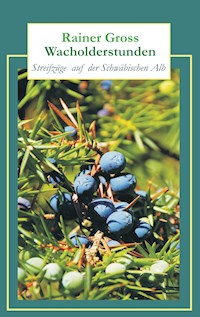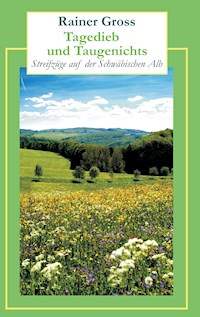Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn ich heute darüber nachdenke, was unsere Welt ausgemacht hat, dann denke ich, dass es eine Welt ohne Disteln und Dornen war. Deshalb gingen wir auch meist barfuß. Und wenn ich mich daran erinnere, ist es, als würde alles wieder lebendig und ich wäre wieder die Janine von damals, keinen Tag älter geworden und noch voll naiver Hoffnung. Wir wohnten alle im alten Herrenhaus. Es war unser Zuhause, wir kannten nichts anderes. Und wenn nicht Lena damals die dramatischen Geschehnisse in Gang gebracht hätte, gäbe es unsere Welt immer noch: unsere Welt ohne Disteln und Dornen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wenn ich heute darüber nachdenke, was unsere Welt ausgemacht hat, dann denke ich, dass es eine Welt ohne Disteln und Dornen war. Deshalb gingen wir auch meist barfuß. Und wenn ich mich daran erinnere, ist es, als würde alles wieder lebendig und ich wäre wieder die Janine von damals, keinen Tag älter geworden und noch voll naiver Hoffnung.
Wir wohnten alle im alten Herrenhaus. Es war unser Zuhause, wir kannten nichts anderes. Und wenn nicht Lena damals die dramatischen Geschehnisse in Gang gebracht hätte, gäbe es unsere Welt immer noch: unsere Welt ohne Disteln und Dornen.
Rainer Gross, Jahrgang 1962, geboren in Reutlingen, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Heute lebt er mit seiner Frau als freier Schriftsteller wieder in seiner Heimatstadt. Er erhielt 2008 den Friedrich-Glauser-Debütpreis.
Bisher sind rund siebzig Titel von Rainer Gross erschienen. Zuletzt veröffentlicht: Novemberland (2023); Schafsgezwitscher (2023); Das heiratende Mädchen (2023); Jesus trinkt den Kaffee schwarz (2024); Café im Hof (2024); Abschied in Cork (2024); Jahrtausendwende (2025); Gezeitenwechsel (2025); Tagundnachtgleiche (2025).
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil: Promenade
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Zweiter Teil: Lenas Entdeckung
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Dritter Teil: Die zehn Bräute
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Erster Teil: Promenade
1
Wenn ich heute darüber nachdenke, was unsere Welt ausgemacht hat, dann denke ich, dass es eine Welt ohne Disteln und Dornen war. Deshalb gingen wir auch meist barfuß. Und wenn ich mich daran erinnere, ist es, als würde alles wieder lebendig und ich wäre wieder die Janine von damals, keinen Tag älter geworden und noch voll naiver Hoffnung.
Das Anwesen reichte bis an den Strand und ins Hinterland bis zu den Bergen. Die Wälder und Wiesen ringsum waren so ausgedehnt, dass keine von uns je ihr Ende erreichte. Wir waren auf unseren Ausflügen auch immer nur einen, höchstens zwei Tage von zuhause fort. Auf den Chausseen waren wir immer allein, auf den Feldern schien niemand zu arbeiten.
Pferde hatten wir, herrliche Pferde, die wir regelmäßig auf die Weide führten; manche von uns striegelten sie, manche misteten die Ställe aus, und jede durfte sie reiten, wenn es die großen Schwestern erlaubten. Deshalb übernachteten wir manchmal in den Scheunen im Stroh. Die Nächte waren kühl im Vergleich zu den Tagen. Mittags war es oft so heiß, dass wir in unseren Zimmern blieben und Mittagsschlaf hielten.
Wir wohnten alle im alten Herrenhaus. Es war unser Zuhause, wir kannten nichts anderes. Weshalb es »Herrenhaus« hieß, wussten wir nicht. Es war das einzige Haus auf dem Anwesen.
Mona und Alexia sorgten für uns und waren immer für uns da. Wir konnten Tag und Nacht zu ihnen kommen, wenn wir Sorgen hatten oder Hilfe brauchten. Sie brachten uns vom Einkaufen Kleider mit und neue Schuhe, Schmuck oder die Blütenöle in den winzigen Glasfläschchen, die wir als Parfüm benutzten. Woher das alles kam, wussten wir nicht. Es war egal. Wir hatten immer alles, was wir brauchten.
Ich weiß nicht mehr genau, wie viele wir waren. Zwanzig vielleicht oder dreißig. Zwar kannten wir uns alle, aber wir waren nicht alle eng miteinander befreundet. Wir waren wie Schwestern, als kämen wir alle aus derselben Familie. Hier, im Herrenhaus, waren wir unsere eigene Familie. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendeine von uns vor den Anderen dortgewesen oder neu hinzugekommen wäre.
Ich wohnte zusammen mit Alice in einem Zimmer im ersten Stock. Wir hatten zwar keinen Balkon wie Nasti, Suzette und Tess gegenüber, deren Zimmer zum Park hinausging; aber wir hatten dafür nachmittags keine Sonne, sodass es bei uns kühler war und die drei oft herüberkamen.
Kim wohnte mit Kristina am Ende des Ganges; die beiden mochten einander zwar, stritten sich aber oft. Wir mussten dann hinüber und schlichten, besonders Anja ertrug keinen Streit.
Anja hatte zusammen mit Claire und Lena das Zimmer neben unserem; sie mochte Claire besonders gern, und wenn wir morgens nach der Versammlung loszogen zu einem unserer Ausflüge, steckten die beiden noch zusammen im Bett und hatten die Vorhänge zugezogen.
Nach der Morgengemeinschaft im alten Tanzsaal zogen wir oft los. Wir nannten unsere Ausflüge »Promenade machen«. Promenade – das passte! Wenn wir zum Strand wollten, nahmen wir die Fahrräder, weil wir für die Strecke zu Fuß zu lang gebraucht hätten. Der Strandweg führte durch den Wald, wo es kühl war und die Räder auf den Steinen hoppelten. Dann kamen die Dünen und kleinen Strandgehölze, wo wir abstiegen und den heißen Sand an den Füßen spürten. Dort gab es eine steile Böschung, in der Schwalben ihre Löcher gebaut hatten. Wir saßen auf der Kante und sahen ihnen zu, wie sie heransegelten und abflogen und immerzu ihre spitzen Schreie ausstießen.
Am Strand war für uns ein Zelt aufgebaut, ein großes, rotes Zelt, in dem wir uns müde verkriechen konnten. Es war oft von den nächtlichen Gewittern ramponiert, aber wir stellten es wieder auf und brachten es in Ordnung. Bianca hatte so empfindliche Haut, dass sie keine halbe Stunde in der Sonne bleiben konnte; sie blieb immer bleich oder hatte einen Sonnenbrand. Wir nannten sie »Weißchen«. Einmal vertrieben Claire und Anja sie aus dem Zelt, und vor lauter Angst vor der Sonne rannte sie Hals über Kopf in den Wald hinein und verstauchte sich an einer Wurzel den Knöchel.
Das Baden in der Brandung machte Spaß. Ich schwamm oft weit hinaus, bis dorthin, wo es tief wurde. Da spürte ich die Kraft der Strömung und die Wucht der Wellen, ich ließ mich schaukeln und treiben und gelangte drüben an die Felsen, wo ich ein Versteck hatte. Alexia, die auf uns aufpasste, sah das nicht gern. Aber sie wusste, dass ich ein vernünftiges Mädchen war.
Dort bei den Felsen gab es einen Kiesstrand, die Steine waren rund und glatt und glänzten in allen Farben: dunkelgrün, blau, weiß,. rot. Niemand kannte mein Versteck. Außer Alexia vielleicht, die wusste ohnehin immer alles. Ich kauerte mich in die kleine Höhle, die die Felsen bildeten, und horchte auf die Brandung. Der Sand war nass und die Kühle des Steins tat gut.
Dort habe ich viel nachgedacht, über mich selbst und unser Leben hier, und habe mich manchmal gefragt, ob ich glücklich bin. Am liebsten wäre ich auch abends dort gesessen, wenn die Sonne im Meer unterging und mir in der Stille und Einsamkeit ganz weh ums Herz wurde. Ich sehnte mich damals nach etwas und wusste nicht wonach. Irgendetwas schien zu fehlen, obwohl es ein herrliches Leben war, das wir führten.
Ich redete nur mit Mona darüber.
Einmal fand ich Suzette in meinem Versteck. Irgendwie hatte sie es ausfindig gemacht, vermutlich war sie vom Land her über die Felsen geklettert. Zuerst wollte ich mir nichts anmerken lassen, aber dann wurde ich doch traurig. Sie versprach, es geheim zu halten. Aber ich merkte genau, dass sie es nun als unser gemeinsames Versteck ansah, und das wollte ich nicht.
Von meinem Versteck aus gelangte man über die Felsen in einen lichten Wald. Dort war es windstill, das Harz roch, und an den Sohlen klebten die welken Nadeln. Merkwürdige Bäume gab es da, ihre Blätter fächelten immerzu, auch wenn es windstill war, und das Licht zitterte zwischen ihnen. Ich wusste nicht, was das für Bäume waren. Sie hatten gefiederte Blätter und eine schwammige Borke, die fühlte sich an wie Kork.
Lena kannte sich damit aus, Lena konnte man alles fragen, was mit Pflanzen zu tun hatte. Sie kannte jede Blume, jeden Baum, jedes Kraut. Wir nannten sie »die Gärtnerin«. Ihr zeigte ich einmal diese Bäume, und ich sehe sie noch vor mir, wie sie zierlich und klein unter den hohen Stämmen stand, die Borke befühlte, den Kopf in den Nacken legte, um in die Wipfel emporzuschauen. Ich blickte in ihr schmales Gesicht, sie hatte die Brille abgenommen, und das Muttermal unter ihrem rechten Auge war deutlich zu sehen. Vielleicht trug sie die Brille auch nur, um es zu verdecken.
»Das sind Flaumeichen«, sagte sie dann leise. »Solche Bäume sind selten. Die gibt es nur hier.«
Später blieb sie oft verschwunden und kam erst zum Abendessen zurück, wir vermuteten, dass sie wieder auf einem ihrer Streifzüge war. Auch das sah Alexia nicht gern. Sie ermutigte Lena oft, sich zu den anderen zu gesellen und nicht der Gemeinschaft fernzubleiben. Aber beide, Alexia und Mona, ließen Lena den Freiraum, den sie offenbar brauchte. Erst Tage später kam ich zufällig noch einmal dorthin und entdeckte sie unter den Flaumeichen sitzen, die Augen geschlossen, als ob sie schliefe. Ich traute mich nicht, sie anzurufen, und schlich leise davon.
2
Wenn wir am frühen Abend Tee tranken, saß Lena bei uns im Zimmer. Von ihren Streifzügen brachte sie alle möglichen Blüten und Kräuter mit, die sie uns in den Tee mischte. Das schmeckte herrlich. Wenn wir sie dann lobten, wurde sie rot und schaute weg. Schweigend saß sie unter uns, hörte uns zu, lachte ein wenig mit, freute sich an unserem Zusammensein. Aber niemand wusste so recht, was in ihr vorging.
Wir machten uns darüber keine Gedanken. Lena war einfach Lena: mit ihren Blumenketten und bunten Sträußen, mit denen sie unsere Zimmer schmückte, mit ihren grünen Augen und der Brille. Keine hatte sie je für etwas Besonderes gehalten. Und doch war gerade sie diejenige, die die ganzen Geschehnisse ins Rollen brachte. Vielleicht hatte sie von Anfang an gewusst, was passieren würde. Vielleicht hatte sie von Anfang an geahnt, was ihre Entdeckung in Wirklichkeit bedeutete.
Manchmal frage ich mich, wie alles ausgegangen wäre, wenn sie es für sich behalten hätte. Dann wäre womöglich gar nichts passiert. Dann wären wir womöglich immer noch auf dem Anwesen, im Herrenhaus, und unsere Welt gäbe es weiterhin: unsere Welt ohne Disteln und Dornen.
Unsere Promenaden führten uns auch ins Hinterland. Dort gab es weite Felder und Kiefernhaine und Buchenwälder, in denen wir umhertollten wie in einem hellen, hohen Saal. Wir hatten einen kleinen Fluss, das war einer unserer Lieblingsplätze, das Wasser strömte kalt und klar über Felsblöcke und bildete dunkle Becken, aus deren Tiefe der Kiesgrund wie Gold heraufschimmerte. Dort saßen wir oft, wenn es auf den Feldern zu heiß war. Eine Höhle gab es auch; wenn wir dort saßen, konnten wir den ganzen Platz überblicken. Suzette war die erste gewesen, die die Höhle erkunden wollte. Eines Tages nahm sie eine Lampe mit und kroch einfach hinein. Keine von uns getraute sich, ihr zu folgen. Ich selber hatte zwar keine Angst vor der Höhle, aber an einem schönen Tag durch Lehm und enge Löcher zu kriechen schien mir nicht sehr erstrebenswert. Die einzige, die Suzette folgte, war Kim. Sie hatte sich zuvor nackt ausgezogen, hüpfte lang und hager herum und als sie wieder herauskam, war sie von oben bis unten mit Dreck beschmiert. Suzette war schlauer gewesen, sie hatte alte Kleider angezogen, die sie hinterher im Wasser wusch. Kim aber zitterte vor Kälte. In der Sonne wärmte sie sich auf und ließ den Lehm auf der Haut trocknen. Nur um zu sehen, wie sich das anfühlte.
Dann sprang sie ins Wasser und tauchte in einem der Becken bis auf den Grund. Tief unten im Grün sah ich sie schwimmen wie ein seltenes Tier. Ihr langes schwarzes Haar floss wie ein Schleier hinter ihr her. Als sie auftauchte, war sie weiß und sauber. Sie stieg heraus, schüttelte sich, und ich konnte ihr in die grünen Augen schauen. Sie waren so grün wie das Wasser in den Becken. Das war mir nie zuvor aufgefallen. Wassertropfen hingen wie Perlen an ihren Wimpern, ihre Brauen sahen aus wie mit einem Tuschpinsel gezogen, Kim war schön. Wie oft hatte ich das bemerkt, und wie oft gleich wieder vergessen. Dann wollte sie mich ins Wasser schubsen, aber stattdessen sprang Suzette hinein und spritzte uns alle nass.
Am Fluss waren wir meist alle gemeinsam, wir zehn Freundinnen. Den Weiher aber kannten nur wenige von uns. Er lag ostwärts in einem Waldstück in einer labyrinthischen Heckenlandschaft. Der Weg dorthin war besonders schön. Für ihn nahmen wir uns Zeit. Trotz der Mittagshitze schlenderten wir gemütlich den Sandweg entlang, meist strahlte der Himmel tiefblau, und von Süden her türmten sich Wolken auf. Manchmal sprangen und hüpften wir, weil wir vor Freude nicht still sein konnten, manchmal sangen wir aus vollem Hals und versuchten dabei, einander die Hüte vom Kopf zu stoßen.
Nasti pflückte einen Strauß aus wilden, struppigen Feldblumen, aber Lena riet ihr, Gräser und Kamille hineinzuflechten, und schon war aus dem garstigen Gebinde ein herrlicher Strauß geworden. Nasti verehrte ihn Tess, die nahm ihn mit einem übertriebenen Knicks und umarmte Nasti, als wären sie ein Liebespaar.
Dann legten wir uns mitten ins Feld und schauten zwischen den schwankenden Ähren hindurch in den Himmel hinauf. Die Erde war warm und trocken, Raubvögel zogen am Himmel, und manchmal konnten wir zusehen, wie einer flügelschlagend auf der Stelle stand und sich dann plötzlich wie ein Stein fallen ließ.
Nasti fing an zu dichten. Die Verse reimten sich nicht, aber das war egal. Wir zogen die Blusen aus, lüfteten unsere Röcke, streckten die Beine in die Sonne. Ich konnte Tess’ Nabel sehen, der wirklich so weit hervorstand, wie die anderen immer behaupteten. Er sah aus wie eine runde Insel im Meer. Nasti kitzelte sie, bis sie sich kichernd wegdrehte. Claire fiel immer das besondere Licht auf, das am Himmel herrschte.
»Ein Brauthimmel«, sagte sie dann. »Heute haben wir wieder einen richtigen Brauthimmel. Wer will sich verheiraten?«
Wir lachten und schlugen scherzend Anja vor.
»Anja ist die richtige Braut«, riefen wir.
Anja freute sich. Sie wurde übermütig und krabbelte auf Claire hinauf, die beiden kugelten herum, bis Claire plötzlich aufsprang. Ich sah die Wut in ihrem Gesicht, bevor sie lachen und einen Scherz machen konnte. Worüber war sie so wütend?, fragte ich mich.
»Janine ist auch eine Braut«, rief sie.
Sie stand über uns wie ein Leuchtturm, das durchsichtige Kleid wehte im Wind, sie breitet die Arme aus und hob sie gen Himmel, legte den Kopf zurück und stieß einen Schrei aus, einen langen, schrillen Schrei, sodass mir eine Gänsehaut über den Rücken lief. Jetzt sah sie aus wie eine Prophetin, eine verrückte Seherin, die in die Zukunft schauen konnte und die sich im nächsten Moment in die Lüfte schwingen würde, emporgerissen von einer unsichtbaren Kraft.
Claire im Himmel – so nannten wir sie seither.
Am Weiher gab es eine große Wiese, die von Holunderbüschen umstanden war. Die Büsche waren zu einem Dickicht verwachsen, bildeten regelrecht Höhlen und Gänge, in denen wir herumkriechen konnten. Oft kam man ganz woanders heraus, als wo man hineingekrochen war. Es gab auch kleine, vom Holunder überwölbte Kammern, in denen wir es uns behaglich einrichteten. Im geheimnisvollen grünen Zwielicht hörten wir einander in nächster Nähe kichern und reden und konnten einander doch nicht sehen.
Wir hatten Rucksäcke dabei mit Trinken und Obst und Keksen und hielten es so ganze Nachmittage dort aus. Anja und ich hatten uns eine Kammer ausgesucht; wir aßen von den Keksen und teilten die Äpfel miteinander, und weil Anja großen Durst hatte, überließ ich ihr die Flasche Wasser allein.
Eine Zeit lang saßen wir schweigend nebeneinander. Anja war mir anvertraut, wenigstens ein bisschen. Jede von uns hatte eine jüngere Schwester, um die sie sich mehr als um andere kümmerte. Bevor Mona und Alexia es übernahmen, jede in die Geheimnisse unserer Jungfernschaft einzuweihen, standen wir für vertrauliche Gespräche und peinliche Fragen zur Verfügung.
Anja war drei Jahre jünger als ich. Sie war ein lebenslustiges, aufgewecktes Mädchen, aber manchmal hatte sie eine Scheu, die ich nicht recht verstand. Sie strich mit ihren Händen nachdenklich über ihre Beine. Sie schien über etwas sprechen zu wollen und traute sich nicht.
»Hast du Sonnenbrand?«, fragte ich entgegenkommend.
Sie lächelte verschämt und strich ihre dunklen Härchen glatt, die sie verstruwwelt hatte.
»Sonnenbrand? Nein. Aber ... ich hätte gerne auch so blonde Haare wie du, Janine. Die sieht man fast gar nicht. Das ist nur so ein goldener Schimmer bei dir. Meine sieht man überall. Das sieht hässlich aus.«
»Ach was«, widersprach ich. »Das sieht man gar nicht. Du hast Dinge, die viel schöner sind als blonde Haare.«
»Was denn zum Beispiel?«
»Deine blauen Augen zum Beispiel. Meine sind wie helles Wasser, Anja. Aber deine sind tiefblau wie der Himmel oder das Meer.«
Anja schwieg wieder. Dann atmete sie tief ein und fragte, bevor sie der Mut verließ:
»Was genau ist eine Jungfrau? Alexia und Mona sagen, dass wir Jungfrauen sind und das unser kostbarstes Gut ist. Was meinen sie damit?«
Ich ´überlegte kurz. Dann sagte ich behutsam:
»Unsere Jungfernschaft ist etwas Heiliges. Und zugleich ist es das Natürlichste der Welt. Sie zeichnet uns aus. Sie ist etwas Besonderes … «
»Ja, aber was ist damit gemeint? Ich hab versucht, mir zwischen die Beine zu sehen. Mit dem Handspiegel. Aber ich konnte vor lauter Haaren nichts erkennen. Was ist das da unten, das uns zu Jungfrauen macht?«
»Das werden dir Alexia und Mona alles genau erklären. Sie werden es dir zeigen. Aber das ist ein ernster Moment. Wir sind Jungfrauen, Anja. Ob wir es sehen können oder nicht. Niemand hat je unsere Blume entblößt. Nur wir dürfen das tun. Warum willst du es sehen?«
»Weil ich nicht verstehe, was das heißt: eine Jungfrau. Wir sind doch alle Schwestern.«
So eine Frage hätte ich eher von Kristina erwartet. Die machte sich über solche Dinge Gedanken, darüber, was wir tun durften und was nicht und weshalb.
»Eine Jungfrau ist wie eine verborgene Quelle. Eine ungeöffnete Blüte. Eine Perle, die noch kein Lichtstrahl berührt hat. Sie trägt in sich das Heilige und Reine, und deshalb ist sie zugleich das Schönste und Wahrste, was es auf der Welt gibt. Sie ist ein versteckter Garten, eine schlummernde Erde, die empfangen will und noch von keinem Geist belebt wurde.«
Ich verstummte und dachte über meine eigenen Worte nach. Mona hatte es mir so erklärt, als ich ihr einmal die gleiche Frage gestellt hatte. Ihre Antwort hatte ich nicht ganz verstanden, und ich begriff immer noch nicht, wozu wir Jungfrauen waren, wenn es doch nur uns Schwestern gab.
Worauf sollten wir denn warten? Was sollen wir empfangen? Da konnte nichts kommen. Wir waren uns selbst genug. Jede für sich. Dass wir als große Familie beieinander waren, verdankten wir nur einem großen Glück. Das Anwesen war unsere Zuflucht.
Ich war gespannt, ob Anja nicht ebenso unbefriedigt war von dieser Antwort, doch offensichtlich begnügte sie sich damit.
Zum Schluss meinte sie: »Kann ich zu dir kommen, wenn ich wieder eine Frage habe?«
Ich nahm sie in den Arm und sagte: »Natürlich, jederzeit.« Und ich freute mich, Anja eine richtige Schwester sein zu können.
3
Manchmal war es einfach zu heiß oder wir waren müde. Dann blieben wir zuhause oder kehrten am Nachmittag schon zurück und verkrochen uns in den Zimmern. Durch die Steinwände war es dort kühl, wir konnten die Vorhänge offen lassen. Die Sonnenwärme wich rasch von unserer Haut, wir verglichen, wie braun wir geworden waren. Durch die Fenster flutete weißes Licht. Wir stellten uns davor, und unsere Haut schimmerte silbern vom zarten Haarflaum, der im Licht leuchtete. Auch die Kleider, die wir anhatten, leuchteten.
Wir betrachteten einander aus dem Innern des Zimmers heraus. Wenn wir hinaussahen, hinaus in den Nachmittag, sahen wir alle Wege, alle Felder und Wiesen und Waldränder, wo wir gewesen waren. Draußen wartete noch alles auf uns, nichts würde verloren gehen, wir würden jederzeit wiederkommen können.
Alice schlief ungern nachmittags. Ich aber und Nasti und Suzette lagen gern beieinander in dem großen Himmelbett in ihrem Zimmer. Es hatte Tücher und Vorhänge aus Gaze, die wir zuziehen konnten, und einen Haufen weicher Kissen. Wir legten uns kreuz und quer, deckten uns nicht einmal mit einem Laken zu, weil es lästig gewesen wäre, und erzählten uns etwas. Oft sprachen wir über die anderen, aber auch über uns selbst. Wir zogen uns gegenseitig aus, streiften uns die dünnen Kleider vom Leib. Sie schienen mir so dünn wie Kokons, kleiner Sommervogel, nannte mich Suzette immer.
Für mich war es jedesmal ein kribbelndes und befreiendes Gefühl, auf einmal nackt zu sein. Als würde ich verborgene Stellen entblößen, an die bisher niemand herangekommen wäre. Und ich bekam Lust, mich wie eine Katze an den anderen zu reiben. Wenn Nasti mir im Liegen über den Nacken strich, bekam ich jedesmal eine Gänsehaut. Irgendwann dösten wir ein, so lagen wir dann bis zum Abend. Ein schönes Bild musste das sein.
Tess sah ich einmal eingeschlafen auf dem Sessel am Fenster, sie hatte die Arme auf dem Fensterbrett verschränkt, den Kopf daraufgelegt und die Beine angezogen. Ihr Rock fiel darüber und der Blusenärmel war weit hochgezogen. Ich betrachtete sie eine Zeitlang und dachte, das könnte genauso gut ich sein. Vielleicht träumte sie. Vielleicht träumte sie von mir. Von uns. Vielleicht träumten wir von voneinander. Dieses Bild prägte sich mir tief ein. Mir war klar geworden, dass wir alle zueinander gehörten.
Viele schliefen nachmittags, aber manche saßen in ihrem Zimmer und lasen ein Buch aus der Bibliothek oder schrieben etwas oder banden Blumensträuße. Wir hatten alle Türen offen stehen, sodass ein leichter Luftzug herrschte und die Vorhänge bauschte. Manchmal huschten wir von einem Zimmer zum andern und waren gespannt, wen wir vorfinden würden und wie.
Manchmal kam eine von uns auf verrückte Einfälle, und dann geisterten wir im Haus herum oder besuchten Mona und Alexia. Wir langweilten uns nie. Wir lebten auch nicht in den Tag hinein. Wir machten aus allem ein Spiel und ein Glück, und irgendetwas drängte uns, das Geheimnis, das wir ständig in uns spürten, auszudrücken durch das, was wir fühlten und taten und sagten.
Wir verschlossen nie eine Tür. Aber trotzdem war es manchmal wichtig, allein zu sein. Allein in seinem Zimmer wie in einer Höhle oder einer Burg. Jede kannte solche Stunden. Ich zog dann immer die Vorhänge zu, sodass es dämmrig war im Zimmer. Die Stille machte mich träumerisch und wehmütig. Ich stellte mich vor den Spiegel und betrachtete mich: meinen Körper, die knochigen Schultern, die ein wenig zu langen Arme, den runden Po, den schmalen Rücken, die schlanken Beine. Meine Haut war fast durchsichtig, davon schimmerten meine Haare heller als sonst.