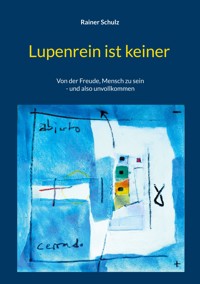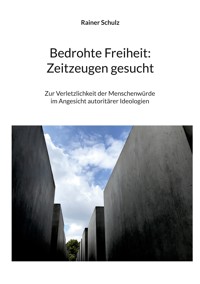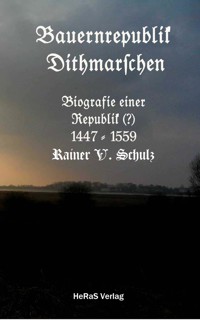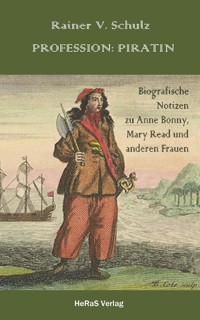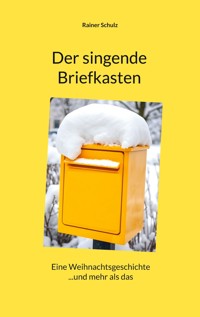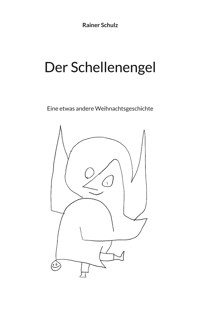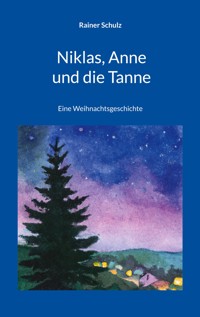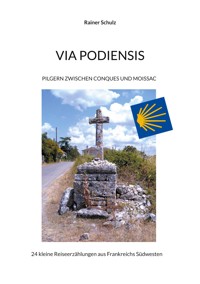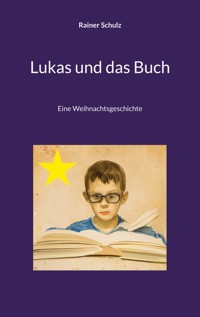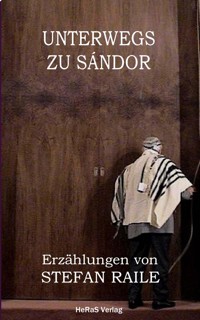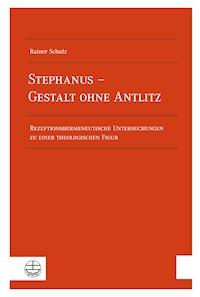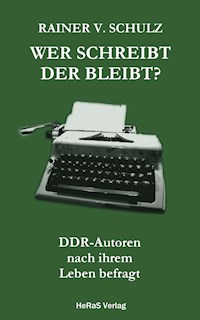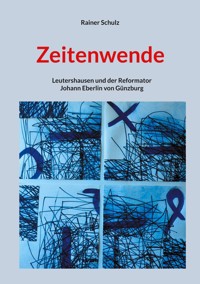
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Zeitenwende" beleuchtet Dynamik und Herausforderungen der Reformation im mittelfränkischen Leutershausen anhand der Biografie und des Wirkens von Johann Eberlin von Günzburg (ca. 1465-1533). In einer Zeit tiefgreifender kirchlicher und gesellschaftlicher Veränderungen wird Eberlin als engagierter Theologe, Reformator und Vermittler porträtiert, dessen Schriften und sozialethische Reformvorschläge die regionale Reformationsgeschichte maßgeblich prägten. Das Werk verbindet historische Quellen, wissenschaftliche Forschung und anschauliche Darstellung, um Eberlins Beitrag zur Entwicklung von Kirche, Gemeinde und Pfarrhaus als Institutionen einer neuen Zeit lebendig werden zu lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 52
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Rainer Schulz, geboren 1954, Dr. theol., war evang. Gemeindepfarrer in Bayern und Chile (Punta Arenas, 1986–1995). Für seinen Einsatz für Frieden und Gewissensfreiheit in Chile erhielt er die Friedensmedaille der römisch-katholischen Kirche. Er promovierte an der AHS Neuendettelsau mit einer Dissertation über den biblischen Märtyrer Stephanus. Eine mehrbändige NS-Dokumentation „Die Partei ruft“ wurde von der Evang.-Luth. Kirche in Bayern im November 2024 mit dem Wilhelm-Freiherr-von-Pechmann-Preis gewürdigt.
INHALT
Einleitung
Quellen und Forschungslage
Johann Eberlin – biografische Skizze
Eberlin als Reformator und Theologe
Theologische Grundsätze
Eberlins Bedeutung als Reformationstheologe
Die Priesterehe und soziale Reformen
Kritik am Pflichtzölibat
Eberlins Sicht der Rolle und Stellung der Frau
Eberlins Wirken in Leutershausen
Der Kontext: Politische und kirchliche Spannungen
Vermitteln, ordnen, festigen: Eberlins Amtsführung
Eberlin: Vergessen bis unbekannt?
Nachwort
Anhang
Ortsregister
Namensregister
Literatur und Quellen
Einleitung
Das 16. Jahrhundert war für die Regionen Mittelfrankens und entsprechend für das Dekanat Leutershausen eine Zeit tiefgreifender Umbrüche, Herausforderungen und Neuorientierungen. Im Sog der Reformation, wesentlich ausgelöst durch Martin Luthers „95 Thesen“ im Jahr 1517, gerieten nicht nur die großen Städte und Fürstentümer, sondern auch die ländlichen Gemeinden in einen Strudel von Glaubensfragen, politischen Machtkämpfen und gesellschaftlichen Veränderungen. Während die historischen Darstellungen der Reformation zumeist die bekannten Zentren und Persönlichkeiten in den Mittelpunkt stellen, eröffnet der Blick auf die lokalen Akteure und deren Wirken in den Gemeinden eine ganz eigene „Zeitenwende“-Perspektive.
Reformator zwischen Tradition und Aufbruch
Zu den prägenden Gestalten dieser Epoche zählte Johann Eberlin von Günzburg (ca. 1465–1533), dessen Lebensweg vom Franziskanermönch zum engagierten Reformator und wortgewaltigen Publizisten führte. Eberlin steht exemplarisch für jene Theologen, die im Spannungsfeld zwischen Tradition und Aufbruch, zwischen kirchlicher Ordnung und evangelischer Freiheit, zwischen theologischer Reflexion und sozialer Verantwortung wirkten. Sein Eintreten für die Priesterehe, seine Flugschriften und seine Beteiligung an theologischen Beratungen – etwa bei einem Treffen mit Markgraf Georg von Ansbach im Jahr 1531 – ließen ihn zu einer Schlüsselfigur im regionalen Reformprozess werden.
Konflikte, Kompromisse und lokale Dynamik
Die Einführung der Reformation im Dekanat Leutershausen war ein langwieriger, von Konflikten und Kompromissen geprägter Prozess. Unterschiedliche Herrschaftsverhältnisse, das Nebeneinander von katholischen und evangelischen Kräften, Patronatsrechte und kirchliche Strukturen führten zu teils jahrzehntelangen Auseinandersetzungen um die Besetzung von Pfarrstellen, die Gestaltung des Gemeindelebens und die Umsetzung reformatorischer Ideen. Gerade in dieser Gemengelage wurde die Rolle der Pfarrer und Theologen – darunter auch Eberlin – zum entscheidenden Faktor für den Verlauf und die Nachhaltigkeit der Veränderungen.
Das vorliegende Buchprojekt unternimmt den Versuch, am Beispiel Johann Eberlins von Günzburg, seiner Biografie und seines Wirkens die Dynamik der Reformation in einer fränkischen Region exemplarisch nachzuzeichnen. Dabei werden nicht nur die theologischen und kirchenpolitischen Entwicklungen beleuchtet, sondern auch die sozialen, kulturellen und alltäglichen Herausforderungen, mit denen sich die Gemeinden und ihre Geistlichen konfrontiert sahen. Besonders jene archivalischen Quellen, Zeitzeugenberichte und wissenschaftliche Studien, die 2017 im Rahmen des Leutershausener Projekts „Das Jahrhundert der Reformation im Dekanat Leutershausen“ zusammengetragen wurden, bilden die Grundlage für die folgende Darstellung.
Ziel dieses Buches ist es, die Persönlichkeit Eberlins im Kontext seiner Zeit lebendig werden zu lassen und zugleich die Bedeutung regionaler Akteure für das Gelingen der Reformation sichtbar zu machen. Es versteht sich als Einladung, die Geschichte nicht als abgeschlossenes Kapitel, sondern als offene Erzählung zu begreifen – als Erinnerung an die Zukunft.
Quellen und Forschungslage
Das Jahrhundert der Reformation
Das im Jahr 2017 begangene 500. Jubiläum von Martin Luthers 95 Thesen gab an vielen Orten Anlass, die lokalen und regionalen Entwicklungen der Reformation zu beleuchten – so auch im mittelfränkischen Dekanat Leutershausen.
Ein Ergebnis war das 2017 erschienene Buch „Das Jahrhundert der Reformation“.1 Es präsentierte eine umfassende Betrachtung der lokalen und regionalen Entwicklungen der Reformation im Dekanat Leutershausen. Verarbeitet wurden umfangreich Quellen und Zitate aus fünf Jahrhunderten, darunter Kirchenführer, Vortragsmanuskripte, Briefe, handschriftliche Aufzeichnungen, Zeitungsartikel, Gemeindebriefbeilagen, wissenschaftliche Werke, Internetseiten und Archivalien. Ziel dieser Sammlung war es, verstreutes Material aus Archiven, privaten Sammlungen und Publikationen zusammenzuführen, um eine Momentaufnahme der Einführung der Reformation und ihrer unmittelbaren wie langfristigen Folgen zu ermöglichen.
Das methodische Vorgehen bestand darin, vorhandene, oft unbearbeitete Materialien aus den Kirchengemeinden systematisch zu sichten und in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Im Verlauf der Arbeit kristallisierte sich ein Kanon wiederkehrender Themen heraus: der Bauernaufstand von 1525, das Ringen um die Einführung der Reformation, das Verhältnis von kirchlichen und weltlichen Institutionen, die Überwindung des Pflichtzölibats, die Entwicklung neuer kirchlicher Strukturen und Ämter, die Einführung verbindlicher Kirchenordnungen, Bildungskampagnen und die alltägliche Verwaltung.
Ein besonderer Stellenwert kam den Biografien der Pfarrer und der Baugeschichte der Kirchen und Pfarrhäuser zu. Die Lebensläufe der Geistlichen, dokumentiert besonders im „Ansbachischen Pfarrerbuch“ von Matthias Simon2, wurden ergänzt durch lokale Chroniken, Visitationsprotokolle, Prüfungsakten, Verwaltungsdokumente und Kirchenbücher, die für die Rekonstruktion von Familienstrukturen, sozialen Netzwerken und dem Wandel der Gemeinde-Identität von großem Wert waren. Die Materialfülle ermöglichte eine differenzierte Darstellung der Reformation im Dekanat Leutershausen, blieb aber zwangsläufig perspektivisch und lückenhaft.
Johann Eberlin von Günzburg im Fokus
Im Zentrum der folgenden Untersuchung steht Johann Eberlin von Günzburg, der am Ende seines Lebens in Leutershausen wirkte. Seine Biografie und sein Wirken sind exemplarisch für die Dynamik und Ambivalenzen der Reformationszeit.
Anhand seines Lebensweges lassen sich die theologischen, kirchenpolitischen, sozialen und persönlichen Dimensionen der Reformation im regionalen Kontext nachvollziehen.
Eberlin steht stellvertretend für die vielfältigen Herausforderungen, denen sich die Kirchengemeinden im 16. Jahrhundert gegenübersahen: das Ringen um die Einführung der Reformation, die Auseinandersetzung zwischen weltlicher und kirchlicher Macht, die Entwicklung neuer kirchlicher Strukturen, die Förderung von Bildung und die Bewältigung alltäglicher Verwaltungsaufgaben.
Eberlins Rolle macht deutlich, dass die Reformation kein linearer, von einzelnen Persönlichkeiten getriebener Prozess war, sondern sich in einem Geflecht aus Erfahrungen, Konflikten und Lösungsversuchen entfaltete. Sein Wirken verdeutlicht, wie regionale Akteure die Reformation prägten und wie ihre Biografien, zusammen mit der physisch sichtbaren Geschichte der Kirchengebäude aus jener Zeit, bis heute das Bild und die Erinnerungskultur der Region bestimmen.
1 RAINER SCHULZ, Das Jahrhundert der Reformation. Zitate, Quellen und Themen zum Jahrhundert der Reformation im Dekanat Leutershausen, Leutershausen 2017.
2 MATTHIAS SIMON, Ansbachisches Pfarrerbuch. Die evang.-lutherische Geistlichkeit des Fürstentums Brandenburg-Ansbach 1528-1806, Nürnberg, 28.
Johann Eberlin – biografische Skizze
Ein authentisches Porträt oder zeitgenössisches Bild von Johann Eberlin von Günzburg ist nicht überliefert. Weder in den einschlägigen wissenschaftlichen Nachschlagewerken noch in den regionalen oder kirchlichen Archiven findet sich ein gesichertes Gemälde, ein Holzschnitt oder ein Kupferstich, das Eberlin eindeutig zeigt.