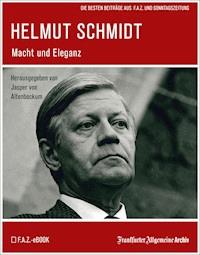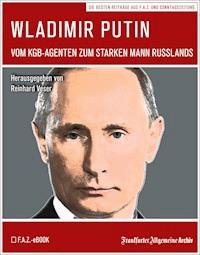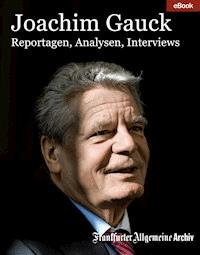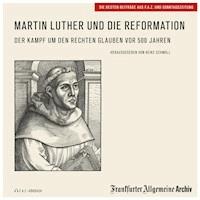Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schulden, Griechenland, Flüchtlinge, Brexit: Die Europäische Union taumelt seit Jahren von einer Krise in die andere. Eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte, die geprägt war von Erweiterungswellen und der Vertiefung der Integration, scheint an ihr Ende gekommen zu sein. Der Fortbestand der EU, zumindest in der heutigen Form, gilt nicht mehr als sicher. Die Vorstellungen, welchen Weg die europäische Einigung in Zukunft einschlagen soll, gehen weit auseinander. Wie konnte es so weit kommen? Warum hat die Idee des gemeinsamen Europas derart an Attraktivität verloren? Wie lässt sich das europäische Projekt retten? Antworten auf diese drängenden Fragen finden sich in einer vielbeachteten Artikelserie, die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seit mehr als einem Jahr erscheint. Maßgebliche politische Akteure wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, der österreichische Bundeskanzler Christian Kern, Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Horst Seehofer, SPD-Chef Martin Schulz und viele andere prominente Autoren, darunter Udo di Fabio und Thilo Sarrazin, legen in ihren Essays ihre Sicht auf die Probleme der EU dar und skizzieren Lösungen für die Zukunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zerfällt Europa?
Die Europäische Union in ihrer größten Krise
F.A.Z.-eBook 49
Frankfurter Allgemeine Archiv
Herausgeber: Berthold Kohler
Redaktion und Gestaltung: Hans Peter TrötscherIllustrationen: Mart Klein, Miriam Migliazzi, Daniel Garcia
Projektleitung: Olivera Kipcic
eBook-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb und Vermarktung: [email protected]© 2017 Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Titel-Grafik: © Fotolia.com / robsonphoto
ISBN: 978-3-89843-451-5
Vorwort
Eine Schicksalsgemeinschaft
Von Berthold Kohler
Schulden, Griechenland, Flüchtlinge, Brexit: Die Europäische Union taumelt seit Jahren von einer Krise in die andere. Keine davon kann schon als endgültig überwunden angesehen werden. Eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte, die geprägt war von Erweiterungswellen und der Vertiefung der Integration, scheint an ihr Ende gekommen zu sein. Noch nie wurde die Frage nach der Raison d'Être so laut und voller Vorbehalte gestellt. Der Fortbestand der EU, zumindest in der heutigen Form, gilt nicht mehr als sicher. Die Vorstellungen, welchen Weg die europäische Einigung in Zukunft einschlagen soll, gehen weit auseinander. Wie konnte es so weit kommen? Warum hat die europäische Idee derart an Attraktivität verloren? Wie lässt sich das Projekt noch retten? Oder schweißen die anderen Krisen und Veränderungen im politischen Gefüge der Welt, von Amerika bis nach Asien, die Europäer vielleicht sogar wieder zusammen?
Antworten auf diese Fragen finden sich in diesem eBook. Es enthält alle Artikel einer vielbeachteten Serie, die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Januar 2016 bis März 2017 unter dem Titel »Zerfällt Europa?« erschien. Politiker, Wissenschaftler und Publizisten aus Deutschland und seinen Nachbarländern legen in ihren Essays ihre Sicht auf die Probleme der EU dar und skizzieren Lösungen für die Zukunft.
Auch in diesen Beiträgen offenbart sich die Heterogenität des politischen Denkens und der politischen Kulturen in Europa. Gleichgültigkeit spricht jedoch aus keinem der Texte. Denn keinem Europäer guten Willens kann es gleich sein, ob die Errungenschaften des europäischen Einigungsprozesses Bestand haben oder nicht. Die Überwindung nationaler Gegensätze trug maßgeblich dazu bei, dass der Kontinent sich einer beispiellosen Ära des Friedens, der Stabilität und des Wohlstands erfreuen kann. Die Europäer sind, wie es zum fünfzigsten und zum sechzigsten Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge in feierlichen Erklärungen hieß, zu ihrem Glück vereint. Wer das angesichts durchaus kritikwürdiger Zustände und Entwicklungen in der EU für Schönmalerei hält, möge die heutige Lage Europas mit dem Unglück vergleichen, das in früheren Jahrhunderten so oft die Europäer in schrecklichster Weise miteinander verband. Wir waren, sind und bleiben eine Schicksalsgemeinschaft.
Viele Wege führen nach Rom
Der Versuch, Europa in mehreren Geschwindigkeiten zu integrieren, ist gescheitert. Jetzt kommt es darauf an, der Vielfalt der wirtschaftskulturellen Bedingungen Europas Rechnung zu tragen und den Kontinent auf unterschiedlichen Wegen zu einigen.
Von Professor Dr. Werner Abelshauser
Erfolg und Zerfall internationaler Integrationsanstrengungen lassen sich nur schwer vorhersagen. Ist der Weg einmal eingeschlagen, zögern die Akteure bis zuletzt, politischen Misserfolg zu bilanzieren. Steigt der Leidensdruck ins Unerträgliche, kann es aber schnell gehen. Beispiele dafür gibt es genug. Der Goldstandard, von 1870 bis 1931 europäische Einheitswährung und Weltgeld zugleich, erwies sich nach der Börsenkrise von 1929 und der auf sie folgenden Bankenkrise als Hindernis für eine erfolgreiche Strategie gegen die Weltwirtschaftskrise. Gleichwohl gaben sich alle Beteiligten noch Anfang September 1931 überzeugt, dass der Goldstandard unabdingbar wäre. Als dann aber am 20. September Großbritannien, seine Führungsmacht, die Flinte ins Korn warf, folgten dreißig weitere Mitglieder, um ihre geldpolitische Souveränität wiederzuerlangen.
Das Beispiel zeigt, dass es sich lohnen könnte, auf den Zerfall vertrauter europäischer Kulissen vorbereitet zu sein, zumal der Leidensdruck steigt. Und da sich der europäische Integrationsprozess nicht zum ersten Mal krisenhaft zuspitzt, stellt sich auch die Frage, ob es nicht alternative Wege zum Ziel gibt, wenn sich die bisher eingeschlagenen als unzulänglich erweisen.
Die Lage
»Der europäische Einigungsprozess ist an einen kritischen Punkt seiner Entwicklung gelangt.« Mit diesem Satz eröffneten vor dreiundzwanzig Jahren Wolfgang Schäuble und Karl Lamers ihre »Überlegungen zur europäischen Politik«. Kritisch sahen sie die »Überdehnung der europäischen Institutionen« ebenso wie die »zunehmende Differenzierung der Interessen«, »Arbeitslosigkeit« und »überlastete Sozialsysteme«. Vor allem aber beklagten sie die »Zunahme eines ›regressiven Nationalismus‹ in (fast) allen Mitgliedsländern, der die Folge einer tiefen Verängstigung – hervorgerufen durch die problematischen Ergebnisse des Zivilisationsprozesses und durch äußere Bedrohungen wie der Migration – ist.« Am Ende stand der Vorschlag, auf der Rollbahn zur europäischen Einheit »mehrere Geschwindigkeiten« zuzulassen.
Was sie nur wenige Jahre nach Unterzeichnung des Maastrichter Vertrages für die Ursachen einer »gefährlichen Entwicklung« hielten, führt uns die Hartnäckigkeit der Integrationshindernisse vor Augen, die 1994 schon seit zwanzig Jahren wirksam waren.
Heute könnte man eine Denkschrift über den Stand der europäischen Integration fast wortgleich einleiten. Allerdings ist mindestens ein Problem hinzugekommen, das Schäuble und Lamers schon allein deshalb nicht berücksichtigen konnten, weil sie mit ihrem Vorschlag eines Europas der zwei Geschwindigkeiten ja gerade seine Entstehung verhindern wollten: die Instabilität der EU, deren Mitgliedstaaten nicht nur über ganz unterschiedliche Fähigkeiten (kollektive Mentalitäten) zur Einhaltung von Regeln verfügen, sondern sich auch in ihrer wirtschaftskulturellen Prägung grundlegend unterscheiden, also in der Art und Weise des wirtschaftlichen Denkens und Handelns (institutionelle Spielregeln) sowie in der Organisationsweise ihrer Wirtschaft.
Auch die Praxis der in mehreren Geschwindigkeiten abgestuften Integration hat offenbar nicht verhindern können, dass der Integrationsprozess heute wieder an einem kritischen Punkt angelangt ist. Sowohl innerhalb des Euroraumes als auch zwischen den Euroländern und den übrigen Mitgliedern der Union haben sich weitere Gräben geöffnet. Wenn aber eine bestimmte Vorstellung vom Funktionieren des Integrationsprozesses über ein halbes Jahrhundert hinweg nicht zu befriedigenden Ergebnissen führt, sollte die Zeit gekommen sein, über Alternativen nachzudenken. Ein Weiter-so verbietet sich dann von selbst.
Unterschiede im Entwicklungsgrad der Mitgliedstaaten lassen sich binnen weniger Jahrzehnte angleichen. Wirtschaftskulturelle Prägungen sind in der Regel historisch sehr tief verwurzelt. Gemessen an den Zeittakten der politischen Praxis, können sie als nahezu unveränderbar gelten. Sie sind auch keineswegs immer anpassungsbedürftig. Im Gegenteil, funktionierende Institutionen sorgen für komparative institutionelle Wettbewerbsvorteile, die ihnen den bevorzugten Zugang zu unterschiedlichen Märkten öffnen. Eine alternative Strategie für Europa verlangt daher nach einer Wirtschaftspolitik, die in der Lage ist, unterschiedliche Entwicklungspfade nicht einzuebnen, sondern klug zu vernetzen, um so Einheit in der Vielfalt zu gestalten.
Deutschlands Interesse
Deutschland operiert als eine der führenden Handelsnationen von einer sicheren europäischen Marktbasis weltweit mit großem Erfolg. Umso wichtiger ist der europäische Binnenmarkt als Glacis und Instrument deutscher Handelsmacht. Muss aber darüber hinaus Europa als Ganzes, als geschlossene Wirtschaftsmacht in Stand gesetzt werden, führenden Welthandelsnationen wie den USA und Japan aber auch emerging markets wie China oder Indien auf Augenhöhe zu begegnen? Für die Bannerträger Europas steht dieses Ziel gegenwärtig weit oben auf der Agenda, weil es wie kein anderes geeignet scheint, die Notwendigkeit eines europäischen Superstaates zu unterstreichen. Für die Mitgliedstaaten der EU birgt dieses Szenario freilich das Risiko, nicht länger souverän über hinreichende wirtschafts- und finanzpolitische Mittel zu verfügen, um ihre komparativen institutionellen Wettbewerbsvorteile auf dem Weltmarkt zu sichern und weiterzuentwickeln.
Auch im weiteren Bereich der Außenpolitik scheint eine europäische Vergemeinschaftung weder vorstellbar noch wünschenswert. Die westeuropäischen Vetomächte im UN-Sicherheitsrat werden sich im eigenen Interesse gegen ein gemeinsames europäisches Mandat sträuben. Auch eine europäische Außenwirtschaftspolitik wird den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen müssen, der im Zweifel keinem ihrer Mitglieder gerecht werden kann.
Wie sonst nur einige wenige nationale Flächenstaaten könnte die multilaterale Europäische Union zwar ebenfalls über die wirtschaftlichen, militärischen und technologischen Fähigkeiten zugleich verfügen, die notwendig sind, um als Weltmacht aufzutreten. Es fehlen ihr aber auf absehbare Zeit sowohl der Gestaltungswille als auch die Fähigkeit, das europäische Interesse einheitlich abzubilden – wie zuletzt die Brexit-Entscheidung demonstriert hat.
Mitgliedstaaten wie Frankreich oder Deutschland wären durchaus in der Lage, als klassische Großmächte zu agieren, auch wenn Deutschland bisher ausdrücklich keine Bereitschaft zur Machtpolitik zeigt. Angesichts dieser Konstellation sollte sich die Außenwirkung der Europäischen Union darauf beschränken, ein konzertiertes Vorgehen von Mitgliedstaaten gleicher Wirtschaftskultur auf dem Weltmarkt möglich zu machen und ihnen gleichzeitig die Freiheit zu lassen, ihre Interessen im Rahmen der global governance auf eigene Rechnung (und Gefahr) zu vertreten.
Für Deutschland ist der Spagat zwischen Europa und der Welt besonders schwierig. Eine formale Anerkennung seiner wirtschaftlichen Dominanz ist heute in Europa ebenso schwer vorstellbar wie vor 1914 und nach 1945. Deutschland wird nicht nur aus diesem Grund in einer europäischen Vertragsunion souveräner Staaten mit divergenten Wirtschaftskulturen keine formale Führungsposition anstreben. Es genügt, wenn es seine Handlungsfreiheit behält, um mit sicherem europäischem Rückhalt weltwirtschaftlich agieren zu können.
Es erscheint dies ein realistischer Ansatz, weil andere ambitionierte Mitglieder der Union – wenn auch mit weniger Aussicht auf Erfolg – diese Freiheit ebenfalls für sich in Anspruch nehmen. Allerdings liegen deren Machtressourcen vor allem außerhalb der wirtschaftlichen Sphäre. Frankreich stützt seinen weltpolitischen Anspruch in erster Linie auf den diplomatischen Status, den es seinem historischen Kapital als ständige Vetomacht im Sicherheitsrat und seiner Stellung als Atommacht verdankt. Es kompensierte damit in der Vergangenheit seinen schwindenden Einfluss als klassische Weltmacht. Dagegen hat die Bundesrepublik ihre Option, Atommacht zu werden, die sie im Dezember 1956 durch den Kabinettsbeschluss, Atomwaffen in Deutschland zu produzieren, bestärkt hat, 1969/73 endgültig aufgegeben.
Eine Neuorientierung der deutschen Außenpolitik weg vom Blockdenken hin zu neuen Optionen in einer multipolaren Welt lässt sich ein Vierteljahrhundert nach Ende des Kalten Krieges kaum vermeiden – wie immer der Präsident der Vereinigten Staaten auch heißen mag. Der komparative politische Vorteil Deutschlands liegt dabei in seiner wirtschaftlichen Nähe zu den Märkten in Brasilien, Russland, Indien oder China. Ihre wirtschaftskulturelle Prägung macht die deutsche Wirtschaft zum Spezialisten für nachindustrielle Maßschneiderei auf Märkten für diversifizierte Qualitätsproduktion. Anders als die alten Westmächte steht Deutschland (und einige seiner Nachbarn) damit nicht im direkten Wettbewerb mit diesen aufstrebenden Volkswirtschaften, sondern unterstützt deren wirtschaftliche Ambitionen – von denen es selbst profitiert. Diese Rolle als begehrter Ausrüster der emerging markets sollte es Deutschland leichtmachen, das Gespräch mit den Prätendenten einer neuen, multipolaren Weltordnung zu suchen, um gemeinsame Interessen im Rahmen der global governance abzustecken und durchzusetzen.
Die wirtschaftskulturelle Landschaft Europas
Aus der Nähe betrachtet, löst sich der europäische Wirtschaftsraum in ebenso viele Spielarten des Kapitalismus auf, wie es dort verschiedenartige Wege in die Moderne gibt. Seine Entstehungsgeschichte unterscheidet ihn insbesondere von dem der Vereinigten Staaten, die auf eine einheitliche Wirtschaftskultur verweisen können. Im Wesentlichen sind es vier Kulturkreise, die den Auftritt der europäischen Wirtschaft in der Weltwirtschaft bestimmen.
Die angelsächsische Wirtschaftskultur setzt ihr Vertrauen in die unsichtbare Hand des Marktes und lässt der Fähigkeit zur spontanen Soziabilität weniger Raum als auf dem Kontinent. Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat Großbritannien seiner früh ausgeprägten industriellen Wirtschaftskultur den Rücken gekehrt, um sich auf den globalen Kapitalmärkten Anlageformen zuzuwenden, die rentabler sind. Dem Niedergang der britischen Industrie im 20. Jahrhundert war dann die Verschmelzung mit der amerikanischen Kapitalmarktkultur geschuldet, die in den 1980/90er Jahren endgültig ihren globalen Siegeszug antrat. Auch wenn Großbritannien nicht selbst zum Euroraum gehört, die EU bald verlässt und nie an der Spitze der europäischen Bewegung marschierte, lässt sich die angloamerikanische Wirtschaftskultur als eine treibende Kraft der europäischen Integration nicht wegdenken.
Das europäische Kerngebiet schritt auf anderen Wegen in die Moderne. Sie führten kreuz und quer durch den Kontinent, und es gibt wenige Regionen, die nicht irgendwann an diesem Weg lagen. Der französische Spitzenmanager und Autor Michel Albert hat die Wirtschaftskultur, die so entstanden ist, capitalisme rhénan (Rheinischer Kapitalismus) genannt. Er meinte damit einen historisch gewachsenen Wirtschaftsraum, der von Skandinavien bis Norditalien und von der Seine bis an die Oder reicht. Das Itinerar seiner Entstehungsgeschichte beginnt auf der West-Ost-Transferstraße der Hansezeit und setzt sich fort auf jenen sich quer durch Kontinentaleuropa ziehenden Entwicklungsachsen von Brügge nach Genua und von Antwerpen nach Venedig, auf denen zunächst die Messen der Champagne, dann die oberdeutschen Industriereviere um Augsburg und Nürnberg zu Knotenpunkten institutioneller Innovationen der Moderne wurden. Heute verkörpert der Rheinische Kapitalismus den starken Kern des Euroraumes und verleiht ihm ein gewisses Maß an wirtschaftskultureller Geschlossenheit. Als dichte Landschaft freiwillig akzeptierter »Spielregeln« steht seine Wirtschaftskultur geradezu im idealtypischen Gegensatz zur Ideologie der Marktwirtschaft der unsichtbaren Hand, wie sie seit dem 18. Jahrhundert in England Gültigkeit hat.
Kennzeichen der im Süden Europas vorherrschenden Wirtschaftskultur ist eine distanzierte Haltung der wirtschaftlichen Akteure zum Staat, ihre gering ausgeprägte Fähigkeit, Sozialkapital zu bilden und zu nutzen, sowie eine der agrarisch-tertiären Produktionsweise geschuldete Tradition weicher Währungen. Es ist sicher kein Zufall, dass praktisch alle Länder des Mediterranen Kapitalismus (aber auch der Balkanstaat Griechenland) im 20. Jahrhundert gründliche Erfahrungen mit faschistischen Bewegungen machen mussten, die angetreten waren, das offenkundige Defizit an staatlicher und gesellschaftlicher Wirksamkeit durch autoritäre Ordnung zu kompensieren.
Das soll nicht heißen, der Süden Italiens und die übrigen Länder des Mittelmeerraumes hätten keine eigene Wirtschaftskultur. Sie haben eine andere – mit komparativen institutionellen Vorteilen durch stabilen wirtschaftlichen Familismus, auf den Dienstleistungsmärkten und einer erstaunlichen Vitalität kleiner und mittlerer Betriebe. Die Iberische Halbinsel verfügt noch dazu über ein großes außenwirtschaftliches Potential durch ein weltweites Netzwerk von Handelsbeziehungen. Hier müsste eine Ordnungspolitik der sichtbaren Hand ansetzen, die geeignet ist, die derzeit schwache Verfassung von Teilen der mediterranen Wirtschaft zu überwinden und gleichzeitig ihre potentiellen Wettbewerbsvorteile zu stärken.
Die wirtschaftskulturelle Orientierung Europas ist noch nicht abgeschlossen. Das betrifft zum einen die Staaten des Balkans, die über Jahrhunderte unter osmanischer Herrschaft nachhaltige Prägungen erfahren und dabei den Anschluss an wichtige europäische Entwicklungen der Wirtschaft verloren haben. Es gilt aber vor allem auch für die Transformationsstaaten im Osten, die dabei sind, an eigene Traditionen anzuknüpfen oder die institutionelle Ordnung anderer Wirtschaftskulturen zu übernehmen. Es geht dabei nicht darum, dass sich die überlegene Wirtschaftskultur am Ende durchsetzt. Wirtschaftskulturen kennen keine hierarchische Ordnung. Entscheidend sind allein ihre Eignung im Wettbewerb auf konkreten Märkten und die Funktionsfähigkeit ihrer Institutionen unter den gegebenen, historisch gewachsenen Voraussetzungen.
Alles spricht dafür, dass die vielschichtige wirtschaftskulturelle Landschaft Europas nicht nur ein lästiges historisches Erbe ist, auf das nolens volens bei der Gestaltung des europäischen Integrationsprozesses Rücksicht genommen werden müsste. Von John Stuart Mill, der 1859 fest davon überzeugt war, dass Europa gerade von der Pluralität seiner Entwicklungspfade profitiert, bis Douglass C. North, dem Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 1993, der gerade im Fehlen eines europäischen Einheitsstaates die historische Grundlage für Wachstum und Wohlstand sieht, zieht sich wie ein roter Faden die Einsicht, dass gerade der Wettbewerb der Wirtschaftskulturen den Wohlstand in Europa gegenüber der übrigen Welt gefördert hat.
Konsequenzen für den Euroraum
In der Modellwelt des optimalen Währungsraumes schienen zunächst alle wirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben, um die Währungsunion zum Motor einer supranationalen Umformung der europäischen Vertragsgemeinschaft souveräner Staaten zu machen. Die Euroländer verfügten über hohe Flexibilität und Mobilität der Arbeits- und Gütermärkte, und auch ihre Integration in den Welthandel (Offenheitsgrad) ließ wenig zu wünschen übrig. Blieb nur noch der Appell an die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, einige wenige Regeln einzuhalten, die für den Zusammenhalt des Währungsraumes unabdingbar seien. Die Beachtung dieser 1992 im Vertrag von Maastricht festgelegten Kriterien setzt freilich kollektive Mentalitäten in den Euroländern voraus, die sie befähigen, Staat und Gesellschaft so zu organisieren, dass diese Regeln auch eingehalten werden können. Die Verfechter einer europäischen Einheitswährung zweifelten keinen Augenblick daran, dass sich allgemein verbindliche Standards für Budgetdefizit, Verschuldungsquotient oder Inflationsrate unter dem Druck der Kapitalmärkte ganz selbstverständlich durchsetzen würden. In ihrer Vorstellungswelt schien die soziale und politische Kompetenz, gemeinsam gesetzte Regeln auch einzuhalten, zu einer bloßen Willensfrage politischer Disziplin zu schrumpfen.
Spätestens 2010, als die heute noch schwelende Bankenkrise das Problem wachsender Staatsverschuldung zahlreicher Euroländer akut werden ließ und sich deren Refinanzierung auf den Kapitalmärkten immer schwieriger gestaltete, trat die Instabilität des Euroraumes offen zutage. Gleichzeitig mehrten sich die Anzeichen, dass der schwierige Umgang seiner Mitglieder mit den Maastricht-Kriterien auch noch andere gravierende Gründe hat. Neben der Zähigkeit kollektiver Mentalitäten kollidieren auch unterschiedliche wirtschaftskulturelle Voraussetzungen im gemeinsamen Währungsraum mit der Notwendigkeit, die Währungsunion durch strikte Vereinheitlichung von Regeln und umfassende wirtschaftspolitische Intervention zu disziplinieren. Es stellt sich nämlich die Frage, ob die Stabilisierung des europäischen Währungssystems nicht eine einheitliche, harmonisierende Herangehensweise, sondern differenzierte Strategien von Wirtschafts- und Finanzpolitik erfordert, die der Dynamik historisch gewachsener Wirtschaftskulturen mit ihren jeweils eigenen Denk- und Handlungsweisen gerecht werden.
Im Übrigen gehört eine Einheitswährung nicht zu den unabdingbaren Voraussetzungen gut funktionierender europäischer Märkte. Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Anton Börner, hat diese Selbstverständlichkeit im November 2011, auf dem Höhepunkt der Euro-Krise, in dieser Zeitung nüchtern ausgesprochen: »Wir können ohne den Euro leben.« Tatsächlich reicht ein möglichst umfassendes europäisches Währungssystem mit festen Wechselkursen, um die wichtigsten währungspolitischen Ziele zu erreichen. Als »Zone stabiler, aber anpassungsfähiger Wechselkurse« bot das Europäische Währungssystem (EWS) vor Einführung des Euros in den Augen des BDI »über lange Zeit eine vergleichsweise sichere Kalkulationsgrundlage«. Was die europäische Wirtschaft wirklich braucht, sind kalkulierbare Währungsverhältnisse, die möglichst für ganz Europa gelten.
Auch wenn Europa ohne den Euro erfolgreich am Weltmarkt operieren kann, wie die Erfahrungen des EWS vor der Einführung der Einheitswährung und die gegenwärtige Praxis der EU außerhalb der Eurozone lehren, so scheinen die Mitglieder der Eurozone doch fest entschlossen, auf lange Sicht mit dem Euro leben. Umso notwendiger wird dann aber für die Währungsunion eine Strategie, die der Rigidität der Einheitswährung entgegenwirkt, die Mitgliedstaaten mit Weichwährungstradition vor Anpassungsprobleme an alte und neue Herausforderungen stellt. Auch hier öffnet sich ein weites Feld für alternative Strategien europäischer Integrationspolitik. Europa à la carte ist damit nicht gemeint. Was die EU braucht, sind Regeln, die Einheit in der Vielfalt zulassen, und ein Währungssystem, das damit kompatibel ist.
Was ist zu tun?
Voraussetzung für einen Kurswechsel in der Europa-Politik ist die Vergemeinschaftung jener Ordnungspolitik der sichtbaren Hand, die einige Mitgliedstaaten – vor allem aber das Bundeswirtschaftsministerium in der Ära der Sozialen Marktwirtschaft – bisher schon mit Erfolg eingesetzt haben, um ihre komparativen institutionellen Wettbewerbsvorteile zu verbessern. Vor allem in den Kernregionen Kontinentaleuropas ist die Bereitschaft der Akteure am Markt groß, freiwillig die eigene Handlungsfreiheit einzuschränken und Spielregeln zu akzeptieren, von deren Einhaltung sie sich Vorteile versprechen. Dort, wo diese Bereitschaft fehlt oder das Trittbrettfahrerproblem den gesamtwirtschaftlichen Vorteil marktwirtschaftlicher Spielregeln zunichtemacht, ist staatliches Handeln geboten, das dabei ordnungspolitischen Vorstellungen folgen muss.
Wie differenziert diese Ordnungspolitik der sichtbaren Hand in Europa ausfallen müsste, zeigt allein schon die Verschiedenartigkeit der sozialen Produktionssysteme, die sich in divergenten Organisationsweisen des Bankensystems, der Berufsausbildung, der Arbeitsbeziehungen, der Interessenpolitik, des Branchensystems, der corporate governance und in der Vielfalt der Denk- und Handlungsweisen ausdrückt, die dort vertreten sind. Sie erfordert jeweils differenzierte Strategien, um ihre spezifischen Wettbewerbsvorteile zu nutzen.
Solange der wirtschaftliche Integrationsprozess mit der Errichtung und Vollendung der Zollunion und eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes gleichzusetzen war, erschien eine Strategie der Harmonisierung durchaus sinnvoll. Sie ließ sich mit dem klassischen ordnungspolitischen Instrument der Durchsetzung gleicher Wettbewerbsbedingungen auf übersichtliche und vertraglich kodifizierte Weise realisieren. Jetzt, da der Binnenmarkt vollendet ist und zufriedenstellend funktioniert, stellen sich der Europapolitik komplexere Aufgaben. Eine wirksame Strategie der Integration muss sich immer der komparativen institutionellen Vorteile der betroffenen Wirtschaftskulturen bewusst sein und die Unterschiede in den sozialen Systemen der Produktion respektieren. Der Brüsseler Apparat der EU wäre in seiner jetzigen Verfassung gewiss überfordert, derart komplexe wirtschaftspolitische Strategien zu entwickeln und auszuführen. Hier ist vielmehr die Kompetenz der Mitgliedstaaten gefragt, die sich auf Regeln für die Gestaltung einer Sozialen Marktwirtschaft à l'européenne verständigen müssten.
An Vorüberlegungen im europäischen Rahmen fehlt es dazu nicht. Als die »Kleine Weltwirtschaftskrise« der 1970er Jahre die Integrationspolitik der Gemeinschaft unter Druck setzte, machten die Spitzenverbände der europäischen Industrie ein »Übermaß an Harmonisierungs- und Vereinfachungsbestrebungen« für das Scheitern einer gemeinsamen Politik verantwortlich: »Es dürfte inzwischen erwiesen sein, dass diese systematische und wenig realistische Integrationspolitik nicht geeignet ist, das bisher Erreichte zu festigen und zu vervollkommnen und den Interessen der europäischen Unternehmen zu dienen. Deshalb könnte die Gesetzgebung künftig durch Richtlinien harmonisiert werden, die sich auf die Festlegung der Ziele beschränken und den Mitgliedstaaten die Wahl der Modalitäten und Mittel überlassen.« Auch der 1976 von der EG in Auftrag gegebene Bericht des belgischen Ministerpräsidenten Leo Tindemans hob darauf ab, das »europäische Bauwerk«, das »ins Wanken geraten ist«, mit mehr Flexibilität in der Integrationspolitik zu stabilisieren. Er führte dazu das Konzept der »abgestuften Integration« ein. Alle Vorschläge liefen auf eine Stärkung des Subsidiaritätsprinzips hinaus, das im Maastrichter Vertrag prominent hervorgehoben worden war, in der Praxis aber wenig Beachtung fand.
Nach Artikel 5(3) des Vertrages über die Europäische Union wird die Gemeinschaft im Bereich der konkurrierenden Zuständigkeit nur tätig, sofern und soweit die angestrebten Ziele auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können. Zur Geltung gekommen ist diese Generalklausel freilich nicht – wie so vieles andere, was in den europäischen Verträgen steht. Jetzt wäre Gelegenheit, dort wieder anzuknüpfen. Nachdem die strategische Innovation der neunziger Jahre – Europa in mehreren Geschwindigkeiten zu integrieren – nicht zum Ziel geführt hat, wäre es an der Zeit, der Vielfalt der wirtschaftskulturellen Bedingungen Europas Rechnung zu tragen und den Kontinent auf unterschiedlichen Wegen zu einigen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.03.2017
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de
Europas Werte, Europas Würde
Die hermetischen Grenzschließer und die enthusiastischen Grenzöffner hatten beide Gründe für ihr Handeln – rechtliche, demokratische, mediale und moralische. Ein Rendezvous mit der Globalisierung indes hatten beide Seiten.
Von Professor Dr. Udo Di Fabio
Die europäischen Verträge formulieren grundlegende Werte der Union: Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Damit werden die richtungweisenden Ideen moderner Verfassungsstaatlichkeit auf die Union übertragen. Kaum eine politische Debatte über den Zustand der EU kommt jedoch ohne den Hinweis aus, wie weit die politische Wirklichkeit von diesen Idealen entfernt sei.
Die Freiheit der Bürger gilt seit langem als zugedeckt durch bürokratische Brüsseler Regelungswut. Technokratische »Harmonisiererei« gilt als eine der Erblasten europäischer Einigung. Unter Gleichheit werde nicht Gleichheit vor dem Gesetz, sondern Gleichmacherei verstanden, die Bekämpfung der Diskriminierung von Minderheiten sei längst übers Ziel hinausgeschossen, in den Augen mancher ist sie sogar zu einem Einschüchterungsprogramm der Mehrheit geworden.
Ist Europa noch eine Rechtsgemeinschaft? Allein die Frage löst bei manchem Kritiker kaum mehr als resignativen Sarkasmus aus. Europäisches Recht sei längst ein beliebiges politisches Instrument geworden. Ein Verordnungstext oder ein Beschluss werde manchmal just so vereinbart, dass der Rechtsbruch von Beginn an einkalkuliert werde, so wie bei der Härtung der Stabilitätskriterien oder der gemeinsamen Asylpolitik im Dublin-System.
Auch die Demokratie als gemeinsamer Wert gilt nicht als über alle Zweifel erhaben. Dass in Brüssel oder Straßburg anregender, lebendiger Meinungsstreit herrsche, wurde schon bislang selten ernsthaft vertreten. Doch manche Mitgliedstaaten beginnen jetzt einen Flirt mit der autokratischen Verführung nach russischem oder türkischem Vorbild. Andere Regierungen liebäugeln mit Ideen, die bereits die Wirtschaft Venezuelas zugrunde gerichtet haben. Das Virus des Populismus scheint zu grassieren, von rechts und links, manchmal innerhalb ein und derselben Partei. Die vom wachsenden Populismus blockierten Eliten schließen ihre Reihen mit steigenden Konformitätserwartungen und lähmen so zusätzlich den lebendigen Meinungsstreit. Und was ist mit Menschenrechten und der Menschenwürde?
Migrationskrise und Wanderungsbewegungen, Fragen humanitärer Schutzverantwortung und solche nach der Kontrolle über Grenzen haben eine Diskussion ausgelöst, die das Selbstverständnis der europäischen Gesellschaften in seinem Kern berührt. Nirgendwo sonst prallten die Vorstellungen von Volksherrschaft und internationaler Rechtsbindung so aufeinander und wurden zum Symbol für den Konflikt zwischen traditionellen Funktionseliten und einem als Populismus gekennzeichneten Rumoren in den öffentlichen Meinungen der Länder. Als die Bundesregierung sich mit einem entschiedenen Kanzlerwort entschloss, aus humanitären Gründen die deutschen Grenzen zu öffnen, geschah dies explizit unter Berufung auf die Würde des Menschen, die zu achten und zu schützen sei. Der angenommene humanitäre Imperativ stieß indes innerhalb Europas auch auf Widerspruch. Länder wie Ungarn, die Tschechische Republik, Dänemark, England oder Polen, später auch Österreich und Schweden halten die Kontrolle über die Einwanderung für ihre ureigene demokratische Materie.
Die Weigerung vieler Mitgliedstaaten, international Schutzsuchende aufzunehmen, ist vor allem in Deutschland von manchem Kommentator geradezu als Anschlag auf das europäische Wertesystem verstanden worden. Und selbst die Politik der Bundesregierung, die außenpolitisch durch ein Rückführungsabkommen mit der Türkei zu einer Lösung der Migrationskrise kommen wollte, sieht sich nun dem doppelten Vorwurf ausgesetzt, sowohl den Wert der Demokratie (in der Türkei) als auch die Menschenrechte nicht sonderlich ernst zu nehmen. Für den lauter werdenden Chor der Kritiker der europäischen Integration versagt die EU damit nicht nur wirtschaftlich – gefangen in der Schuldenkrise und im Korsett der Währungsunion –, sondern nun auch noch moralisch.
Ist diese Kritik berechtigt? Oder droht in den schwelenden Krisen nicht die Kritik an der EU ihr Maß zu verlieren? Jeder politische Herrschaftsverband braucht Kritik. Es war dem gemeinsamen Projekt letztlich nicht zuträglich, dass die europäischen Funktionseliten jede Infragestellung des jeweils nächsten Integrationsschritts als mangelnde Loyalität zum europäischen Friedenswerk diskreditiert und stattdessen bunte Werbesträuße gebunden haben. Solche Strategien mögen auf kurze Sicht ganz gut funktionieren, auf längere Sicht aber höhlen sie demokratische Legitimationsgrundlagen aus. Sie befördern das Ressentiment und machen diejenigen stark, die sich in Heldenpose setzen, die Wahrheit auszusprechen und mit einfachen Rezepten Remedur zu schaffen.
Heute scheint die Stimmung bereits gekippt. Es fällt schwer, die EU nüchtern zu bilanzieren, Fehlentwicklungen zu diskutieren, ohne gleich Applaus von der falschen Seite zu bekommen oder als allzu leiser Ton kein Gehör zu finden. Dabei ist es für die Unionsbürger dringend an der Zeit, sich die EU kritisch und nachholend wieder anzueignen, die politische Grundidee erneut offenzulegen, dabei Widersprüche und Ambivalenzen zu benennen, ohne gleich zu skandalisieren.
Die EU leidet heute unter dem Grundproblem, dass sie in erheblichem Umfang über Querschnittszuständigkeiten und weit ausgreifende Rechtsetzungsmacht verfügt, aber nicht wirksam regieren kann. Ihre organisatorische Uneindeutigkeit wird umso mehr zum Problem, als ihre Zuständigkeiten ins Bundesstaatliche wachsen, während die politische Zustimmung ins Staatenbündische zurücksinkt. Die Folge ist eine fleißige Produktion von Verordnungs- und Richtlinienrecht in einem eigentümlichen Brüsseler Ambiente zwischen Machtstreben, nationaler Interessensteuerung, Lobbyismus und dem erheblichen Einfluss von Nichtregierungsorganisationen. Das so geschaffene Recht steht in manchen Bereichen aber vor der Notwendigkeit, fallweise zurückweichen zu müssen aus Furcht vor antieuropäischen Emotionen und angesichts der demokratischen Realitäten in den Mitgliedstaaten.
Die Union kann man nur als gestuftes Herrschaftssystem verstehen, das mehr ist als eine Freihandelszone, aber gegenwärtig keine Chance auf souveräne Bundesstaatlichkeit hat. Dafür fehlt die kritische Masse an Zustimmung der Unionsbürger. Damit bleiben die Staaten legitime und für Richtungsentscheidungen maßgebliche Akteure; sie bleiben trotz aller intensiven (Ver-)Bindung Herren der Verträge. Schon früh hat ein Teil der Rechtswissenschaft versucht, der Entwicklung vorzugreifen und die völkerrechtliche Souveränität der Staaten über das faktisch beobachtbare Maß hinaus zu relativieren, sei es gegenüber dem Unionsrecht, sei es zugunsten eines Vorrangs universeller Menschenrechte. Dabei wird der Idee der Volkssouveränität ihre Funktionslosigkeit bescheinigt oder ihr lediglich antiquarischer Wert zugemessen. Im Ergebnis wird so die parlamentarische Demokratie in den Dienst genommen für ein häufig unbestimmtes Europa- und Weltrecht in der Hand von engagierten Interpreten, die sich keiner Wahl stellen müssen.
Die EU selbst und ihre Organe stimmen dem gerne zu, solange damit die Staaten im Zaum gehalten werden; sie reagieren allerdings selbst ausgesprochen unwillig, wenn sie ihrerseits auf diese Weise gebunden werden sollen. Der Europäische Gerichtshof hat das bei der Relativierung von UN-Sicherheitsratsbeschlüssen gezeigt. Selbstbehauptungsansprüche gibt es eben nicht nur bei nationalen Verfassungsgerichten, sondern auch in Luxemburg. Sie gehören zum System eines Mehrebenenverbundes. Doch hinter der inzwischen üblichen lyrischen Rede vom Mehrebenenverbund, vom Verbund der Staaten, der Verfassungen, der Gerichte, der Behörden, verbirgt sich eine grundlegende Spannungslage, die man nicht zudecken sollte.
Universelle oder europäische regionale Menschenrechte stehen dem Demokratieanspruch eines selbstregierten Volkes gegenüber oder auch der Autonomie des EU-Regelsystems – zwar nicht antagonistisch, aber doch auch in Konkurrenz und in einer Spannungslage. Wer die Verfassungsdokumente der nordamerikanischen Kolonien auf dem Weg in die Unabhängigkeit wie die Grundrechteerklärung von Virginia 1776 und die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 liest, der spürt den heißen Atem der Aufklärung. Die Aufklärung macht aus dem Renaissancehumanismus, der Reformation, dem naturwissenschaftlichen Rationalismus und dem Naturrechtsdenken ein politisches Programm. Dieses Programm fordert aus derselben Prämisse sowohl die Selbstregierung des Volkes als auch individuelle Freiheitsrechte: Es ist jene Dignitas der vernunft- und willensbegabten Gattung, die jeden Menschen als gottesebenbildliches Geschöpf versteht, ausgezeichnet mit einer unantastbaren, unveräußerlichen Würde. Das westliche Denken sieht jeden Menschen als Herrn seines eigenen Schicksals und zugleich als sozial auf den anderen gerichtet. Wegen der Gattungssolidarität, die bereits in der Dignitas des Menschseins steckt, ist uns die vollkommene Ellbogengesellschaft trotz eines in dieser Hinsicht durchaus robusten Wirtschaftssystems fremd. Im modernen Verfassungsstaat ist wirksame Hilfe der konstitutive Begleiter der persönlichen Entfaltungsfreiheit und ein Fixpunkt des sozialen Staatsziels.
In einem Punkt treffen sich religiöse und weltliche Zugänge. Die Entscheidung zur Hilfe ist eine genuin freie Entscheidung, denn sie muss ebenso die eigene Existenz gewichten und bei mehrfacher Hilfepflicht Solidaritätskonflikte lösen. Nächstenliebe ohne Handlungsfreiheit verliert nicht nur ihren Wert als »gute Tat«, sondern ihre sittliche Qualität.
Was für den Einzelnen gilt, wird auch für Demokratien gelten müssen. Gerade in einem Weltsystem ist politisch zu entscheiden, wie Ressourcen genutzt und in welcher Weise verantwortlich gehandelt wird. Dabei heißt politisch handeln, abzuwägen zwischen eigenen Interessen, den Interessen in einem Verbund und humanitären Verantwortlichkeiten. Das Grundgesetz will hier keine Gegensätze, sondern verklammert beide Perspektiven: die Würde des Einzelnen und den Umstand, dass alle Staatsgewalt, auch die verfassunggebende Gewalt, vom Volke ausgeht.
Die Verfassung der Deutschen zollt den Menschenrechten als naturrechtlicher Zivilisationsgrundlage tiefsten Respekt, wenn sie in Artikel 1 Absatz 2 das Bekenntnis des Deutschen Volkes zu »unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt« abgibt. Dem juristischen Blick bleibt indes nicht verborgen, dass damit kein Geltungsvorrang überstaatlichen Rechts oder naturrechtlicher Moral angeordnet wäre. Es handelt sich um eine ideelle Orientierung, eine posttotalitäre Klarstellung, dass aus der Demokratie heraus nicht abermals eine totalitäre Richtungsentscheidung getroffen werden darf. Es handelt sich um eine Verdeutlichung, dass Deutschland Teil jenes Westens sein und bleiben will, der in der Atlantikcharta der westlichen Alliierten 1941 und in der Gründung der Vereinten Nationen einschließlich der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1948 seine bis heute maßgebliche Richtung eingeschlagen hat.
Jede Verfassung der Freiheit, die individuelle Entfaltungsrechte und politische Selbstbestimmungsansprüche unter einen Hut bringen muss, operiert mit einer spannungsgeladenen Wechselbezüglichkeit. Das Universelle braucht die Macht des Partikularen ebenso wie jede partikulare Zivilisation dem Universellen verpflichtet ist. Es war das Volk der Franzosen, ihre Nationalversammlung, die die allgemeinen Menschen- und Bürgerechte erklärte. Es sind die Völker der Welt, die in den Vereinten Nationen Menschenrechte deklarieren. Die Würde des Menschen ist angeboren vor jeder Staatszugehörigkeit, aber sie wird erst mit der modernen Republik wirksames Recht. Alles Universelle ist auf partikulare Macht zur Rechtsdurchsetzung durch die Demokratien angewiesen, wenn der Rechtsbegriff nicht entleert und virtualisiert werden soll.
Es hat keinen Sinn, ist jedenfalls gefährlich, den Zusammenhang von freier politischer Gemeinschaft und Menschenrechten konzeptionell zu lösen. Die großen Demokratien mit ihrer verfassunggebenden Gewalt und Volkssouveränität sind keine bloßen Erfüllungsgehilfen eines universellen Weltrechts, das von einer international vernetzten juristischen Elite selbstbezüglich interpretiert oder von Marktkräften beherrscht wird, denen kein vernünftiger Ordnungsrahmen gezogen wird.
Die Beziehung zwischen verfassungsstaatlicher Demokratie und internationaler Menschenrechtsentwicklung, ebenso wie die zu einer sozial gut geordneten Marktwirtschaft, bleibt wechselseitig befruchtend, wenn beide Sphären die jeweils andere als grundlegend für die eigene Wirksamkeit und Legitimation verstehen. Individuelle Freiheit kann sich nur in einer rechtsstaatlichen Demokratie entfalten, und eine Demokratie bleibt nur Demokratie, wenn sich die Bürger ihrer Grundrechte wie ihrem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit oder der Meinungs- und Pressefreiheit oder der Eigentumsfreiheit sicher sein können.
Die normative Doppelhelix individueller Grundrechte und demokratischer Selbstregierung gilt nicht nur im Innern des Verfassungsstaates, sondern sie bestimmt auch das richtige Verständnis des europäischen Wertefundaments. Wenn unter dem Druck einer großen Migrationswelle gesagt wird, die Staaten Europas seien menschenrechtlich wegen der Würde aller schutzsuchenden Menschen zur Hilfe verpflichtet, möglicherweise auch durch Aufnahme ins Land, so ist das ebenso richtig, wie es falsch wäre, daraus einen unbedingten, unbegrenzten Anspruch auf Einreise herzuleiten. Das würde den Anspruch der Demokratien leugnen, selbstbestimmt zu entscheiden, in welcher Form sie internationale Hilfe leisten, wie sie humanitäre Schutzverantwortung wahrnehmen.
Dass die EU 2015 in der Migrationskrise gleichsam kalt erwischt wurde, hat manche Gründe in verfehlter Rechtsetzung und politischen Fehlern. Aber das Grundproblem ist ein systematisches für eine humanitäre Zivilisation und sollte deshalb nicht dem europäischen Integrationsprojekt als Verfallserscheinung angerechnet werden. Eine absolute Aufnahmepflicht zu fordern bedeutete die Ausdehnung des Schutzversprechens vom begrenzbaren Volk und Territorium auf die Menschheit und die Welt. Damit würde jene konstruktive Spannung aufgelöst, die zwischen partikularer, begrenzter Staatsgewalt und universeller Menschenrechtsidee besteht. Von den damit in Kauf genommenen Stabilitätseinbußen der rechtsstaatlichen Demokratien würden der Schutz der Menschenrechte und die Achtung der Würde des Einzelnen nicht profitieren, wohl aber antiwestliche Autokratien und Diktaturen.
Schon der preußische Spätaufklärer Immanuel Kant hat in seiner Schrift »Zum ewigen Frieden« die Dialektik von Partikularität und Universalität, von Staatsverfassung und Menschenrechten gesehen. Für Kant existiert ein konstitutiver, jedenfalls ein praktisch nicht zu beseitigender Spannungsbogen zwischen universellem Weltbürgertum und der Tatsache einer segmentierten Staatenwelt, die man nicht zur einen oder anderen Seite auflösen kann, ohne ein Zerstörungswerk in Gang zu setzen. Seine Forderung nach einem föderativen Völkerbund mit Friedensgebot und freiem Welthandel (»Es ist der Handelsgeist, der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann«) geht von der Einsicht aus, dass ein universeller Weltstaat gerade nicht förderlich für die universellen Menschenrechte wäre. Selbst wenn er eine gleichgeordnete Staatenwelt als einen unerwünschten Zustand der Interessengegensätze und damit als Quelle für Kriege ansieht, so ist doch nach Kant dieser Zustand der Staaten »besser als die Zusammenschmelzung derselben, durch eine die andere überwachsende, und in eine Universalmonarchie übergehende Macht«. Der Philosoph nimmt an, dass eine Weltregierung mit der dann entstehenden notwendigen Distanz an Wirksamkeit und Lebensnähe verlieren müsste, »weil die Gesetze mit dem vergrößerten Umfange der Regierung immer mehr an ihrem Nachdruck einbüßen, und ein seelenloser Despotismus, nachdem er die Keime des Guten ausgerottet hat, zuletzt doch in Anarchie verfällt«. Ist das bereits eine in Umrissen erkennbare Vision des Europas, das uns droht, wenn die Mitgliedstaaten Opfer populistischer Bewegungen werden und die Rechtsgemeinschaft schwindet, weil längst nach Regeln des »moral hazard« gespielt und der Zentralismus, je notwendiger er scheint, umso wirkungsloser werden wird?
Das atlantische Völkerrecht verbindet die Idee eines friedlichen Zusammenlebens selbstbestimmter Völker, die sich in einer Privatrechtsordnung grenzüberschreitenden Handels zusammenfinden, mit der Achtung der Würde und Rechte eines jeden Individuums. Das große Projekt der Europäischen Union konkretisiert das atlantische Völkerrecht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, den unionsrechtlichen Grundfreiheiten eines Binnenmarktes und den politischen Aushandlungsprozessen im europäischen Organsystem. Die grassierende Kritik am Zustand der EU sollte ernst genommen werden, darf aber nicht zu falschen Schlüssen verleiten. Die europäische Integration ist die bedeutendste politische Innovation seit der Erfindung des neuzeitlichen Staates. Sie hat immer von der Spannung zwischen Vision und Pragmatik gelebt, dabei manchmal die Wirklichkeiten und Eigenwilligkeiten in den Nationen und Regionen nicht angemessen wahrgenommen. Die politischen Eliten sind mit der Währungsunion oder dem Schengen- und Dublin-System vielleicht manchmal allzu energisch vorgeprescht, haben einen theoretisch möglicherweise stimmigen Rechtsrahmen verabschiedet, der sich inzwischen hart an den politischen Bedingungen in den Mitgliedstaaten stößt. Die Bürger wollen nicht die Kontrolle über ihre Demokratie, ihre Möglichkeiten zur Selbstregierung aufgeben. Wer diesen Anspruch als historisch überwunden und geradezu reaktionär abtut, der wird keine Antwort finden auf die Frage, wo dann das ebenso selbstbewusste wie zerbrechliche Individuum praktischen Schutz finden wird, wenn nicht in geordneten und stabilen Verfassungsstaaten.
Auch die internationalen Organisationen und die Akteure der Zivilgesellschaft sind auf stabile Demokratien existentiell angewiesen; sie sollten deren Identität und Funktionsfähigkeit auch achten. Die EU ist der notwendige Komplementär europäischer Staaten, deren Freiheitsfähigkeit, Stabilität und Integrationsbereitschaft ausschlaggebend für das Gelingen der Union ist. Während wir vielleicht allzu abgehoben die offene und die eine Welt mit Menschenrechten der dritten und vierten Generation verfassten, breiteten sich in den von den intellektuellen Eliten abgeschriebenen Nationalstaaten populistische Bewegungen aus mit Neigungen zum Protektionismus, zur Fremdenfeindlichkeit. Der demokratisch-sozialtechnische Weg staatlich vernetzten Regierens stößt auf Grenzen der Legitimationsfähigkeit und auf ein revoltierendes Potential, wo allzu forsch über »Befindlichkeiten« regional bestimmter Welten hinweg regiert wurde. Das ist brandgefährlich. Tabuisierungen, das Verbot von Plebisziten und die Verfolgung von Demagogen wäre gewiss einem Metternich eingefallen, half aber schon nach 1815 wenig und hilft heute gewiss nicht. Europa sollte nicht seinen Feinden und engstirnigen Abbruchkommandos überlassen werden.
Bei alledem muss auch kein allzu pessimistischer Grundton vorherrschen. Das, was Europa – durchaus auch im Dissens – zur Bewältigung der Migrationskrise bislang gezeigt hat, darf mit guten Gründen als iterativer, manchmal schmerzhafter Lernprozess begriffen werden. Zwei allzu einfache und deshalb für sich genommen falsche Positionen haben sich angenähert und werden dadurch pragmatisch und konzeptionell stimmiger. Die hermetischen Grenzschließer und die enthusiastischen Grenzöffner hatten beide Gründe für ihr Handeln – rechtliche, demokratische, mediale und moralische.
Ein Rendezvous mit der Globalisierung indes hatten beide Seiten. Die einen mussten begreifen, dass das europäische System gemeinsamer und koordinierter Grenzkontrollen nicht einfach verabschiedet werden darf, dass Europa eine Identität als Schutzmacht für bedrohte und verfolgte Menschen besitzt. Das bedingt im Namen humanitärer Schutzverantwortung besondere außenpolitische und sicherheitspolitische Verpflichtungen, bis hin zur aufwendigen und riskanten Bekämpfung von Fluchtursachen. Andere mussten einsehen, dass es verwoben mit Elend und Verfolgung auch ein international florierendes Geschäft ist, in dem organisierte Schlepperkriminalität jede sich auftuende Chance auf Einreise in liberale Sozialstaaten ohne zeitliche Verzögerung in Geschäftsmodelle ummünzt – und deshalb eine wirksame Kontrolle der Staatsgrenzen und die Formulierung von rechtlich verlässlichen Einreisebedingungen eine unabdingbare Grundlage der Weltoffenheit bleiben.
Wer wirksam helfen will, wer dem Frieden der Welt in Verantwortung vor dem Schicksal aller Menschen dienen will, der muss wirtschaftlich und politisch stark sein. Die westlichen Demokratien stoßen inzwischen recht deutlich auf eine komplexe, eine sperrige Welt, in der religiöser Fanatismus, die Wiederkehr militärischer Gewalt als Machtinstrument, Feindschaft gegenüber Demokratie und Marktwirtschaft, Staatenzerfall und Ordnungsverluste bis in die Alltagswelt wieder eine große Rolle spielen. Doch der Westen ist nicht nur wirtschaftlich stark, sondern auch ideell und konzeptionell. Er muss seine außen- und sicherheitspolitischen Ressourcen stärken und gemeinsam besser entfalten, seine institutionellen Grundlagen entschiedener pflegen.
Europa klug zu rekonstruieren auf den Prinzipien der Grundfreiheiten und Eigenverantwortung, bei wechselseitigem Verständnis und Bereitschaft zur Hilfe: das ist die entscheidende Aufgabe, damit die Bürger wieder Vertrauen in das Einigungsprojekt fassen. Eine immer engere Union der Völker entsteht nicht, indem wir alle Trennwände einreißen und füreinander Rechnungen begleichen, sondern wenn der Sinn für das Gemeinsame im koordinierten Erfolg der Vielfalt wieder wächst. Die Leitidee von der Würde des sich frei entfaltenden, mündigen Menschen, der im anderen sich selbst zu sehen imstande ist, sie lebt gegen alle Verführungen des sozialtechnischen Paternalismus. Sie ist das Fundament der Zivilisation.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.05.2016
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de
Zu unserem Glück vereint?
Die Geschichte der europäischen Nationalstaaten belegt, dass sich Gefühle der Verbundenheit und Nähe nicht verordnen lassen. Aber es hätte der EU nicht geschadet, symbol- und geschichtspolitisch mehr zu tun und früher damit zu beginnen. Zu spät ist es nicht.
Von Professor Dr. Ute Frevert
Was hat Europa mit Gefühlen zu tun? Welche Rolle spielen sie in der Geschichte europäischer Einigung und Entzweiung? Sind Gefühle – und wenn ja, welche? – Europas Verdruss oder seine Zukunft?
Es ist kein Zufall, dass solche Fragen heute gestellt werden, 65 Jahre nach Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Vorläuferin und Inkubator der EU. 1951 war von Gefühlen nicht die Rede, dem Pariser Vertrag ging es um Märkte, Verbraucher und Preise. Lediglich in der Präambel ließ sich ein leicht gefühliger Ton entdecken, wenn sie eine »vertiefte Gemeinschaft unter Völkern« verhieß, »die lange Zeit durch blutige Auseinandersetzungen entzweit waren«.
In deutschen Ohren war der Begriff Gemeinschaft mit schwerem emotionalem Gepäck beladen – und hörte sich gerade deshalb in einem Atemzug mit Kohle und Stahl mal placé an. Ohnehin ging man in den Anfangsjahren der Bundesrepublik eher auf Distanz zu Gefühlen. Nie wieder sollte ihnen in der Politik eine ähnlich prominente Bedeutung zukommen wie während des Nationalsozialismus.
Heute hat sich der Wind gedreht. Gefühle sind in der Politik ein heißes Thema geworden. Sie stehen versteckt oder offen auf jeder politischen Agenda, keine Wahlwerbung kommt ohne sie aus. Das hat viele Gründe, manche sind politikintern, andere extern. Dass Politik immer stärker personalisiert wird – nicht nur in den Vereinigten Staaten und im dortigen Präsidentschaftswahlkampf –, ist einer davon. Personen wiederum »funktionieren« nicht ohne Gefühle. Die Therapeutisierungswelle der 1980er Jahre tat das Ihre, um Gefühle auch außerhalb des Privaten zu positionieren. »Wie fühlst du dich jetzt?«, »Wie fühlt sich das an?«: Solche Fragen stehen ebenso hartnäckig im Raum wie die Erwartung, darauf eine »ehrliche«, »authentische« Antwort zu bekommen und ihr eine entsprechende Anschlusskommunikation folgen zu lassen. Gefühle zu haben und über Gefühle zu sprechen ist von größter öffentlicher Bedeutung, ebenso wie das Management von Gefühlen mittlerweile zum Standard jedes CEO-Coaching gehört und die modischen Selbstführungsdiskurse anleitet.
Was heißt das für Europa und das Projekt europäischer Einigung, über dessen Zerfall so viel geunkt wird? Europa hat, so die These, ein emotionales Defizit, das sich derzeit besonders deutlich zeigt. Das »Glück«, das die Berliner Erklärung anlässlich des 50. Jahrestags der Unterzeichnung der Römischen Verträge im Jahr 2007 so vollmundig beschwor, will sich partout nicht einstellen. Zugleich verblasst die Erinnerung an die europäischen Bürgerkriege. Sie hat in den 1950er Jahren den »Traum« einer europäischen Friedensordnung angeschoben. Heute scheint jener Traum verwirklicht, und die Leistungen der EU, was den freien Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen betrifft, gelten als selbstverständlich – oder werden in Frage gestellt. Europakritische oder gar -feindliche Bewegungen gewinnen an Zulauf und mobilisieren mit hochemotionalen Parolen. Dagegen setzen social marketing-Kampagnen à la »Ich will Europa« ein positives Bekenntnis, dessen Eindringtiefe allerdings zweifelhaft ist.
Was also ist zu tun, um dem Gefühlsdefizit der EU beizukommen? Welche Gefühle braucht sie, und wie könnte man sie aktivieren? Lassen sich Gefühle überhaupt »herstellen«? Auf welche Erfahrungen der europäischen Geschichte kann man dabei zurückgreifen?
Denken sie an Brüssel, kommen vielen EU-Bürgern sofort achtundzwanzig Kommissare, Heerscharen gutbezahlter Beamter und Bataillone von Lobbyisten in den Sinn. All das betrachten sie eher mit Skepsis als mit überschäumender Freude. Auch wenn man sagt, die Zahl der bei der Kommission beschäftigten Mitarbeiter inklusive Hausmeister und Ortskräfte sei nicht viel höher als die der Kölner Stadtverwaltung, verschwindet die Skepsis nicht. Denn der Kölner Klüngel scheint Kölner Bürgern nah, vertraut und bei aller Kritik doch irgendwie lebensnotwendig. Die Brüsseler Administration hingegen liegt nicht nur räumlich in der Ferne, sondern ist auch in ihren Kompetenzen, Abläufen und Beschlüssen undurchschaubar.
Aufklärungs- und Informationskampagnen, wie sie Europa-Parlamentarier von Zeit zu Zeit starten, helfen da nicht viel. Negative Medienberichte, Skandalisierungen bestimmter Entscheidungen – über Gurkenkrümmungen oder das Verbot offener Olivenölkännchen in Restaurants – und eine populistische Anti-Europa-Bewegung, die rechte und linke Gruppen gleichermaßen umfasst, füttern ein Ressentiment, das sich nicht zuletzt in Umfragen niederschlägt. Seit 2014 ist der Anteil derjenigen, die ein positives Bild der EU haben, in Deutschland von 37 auf 29 Prozent gefallen und liegt damit auf gleicher Höhe mit denen, die der EU negativ gegenüberstehen (wobei er immer noch größer ist als in Frankreich oder Großbritannien, aber kleiner als in Polen oder Litauen). Mit 41 Prozent relativ konstant geblieben ist die Gruppe jener, die ihre Haltung zur EU als »neutral« beschreiben. Das ist die Mehrheit der Befragten.
Nun ist Neutralität, man könnte auch sagen: Indifferenz, nicht per se ein Problem. Anders als in Nordkorea werden Bürger hierzulande nicht gezwungen, Politikern und Institutionen zuzujubeln und auf Knopfdruck Tränen zu vergießen, wenn ein Staatsführer das Zeitliche segnet. Es gibt in den meisten europäischen Staaten auch keine Wahlpflicht, weder in kommunalen, nationalen oder europäischen Angelegenheiten. Freiheitliche Demokratien zeichnen sich eben auch dadurch aus, dass sie ihren Bürgern freistellen, sich für Politik zu interessieren oder andere Dinge zu tun.
Zugleich ist mit dauerhaft gleichgültigen Bürgern wenig Staat und noch weniger Demokratie zu machen. Fällt die aktive Teilnahme unter ein bestimmtes Niveau, bröckelt die Legitimität – nicht formal, aber substantiell. Es gibt ein stilles Quorum, das über die Vitalität und Anerkennung eines politischen Gemeinwesens entscheidet. Betätigen zu viele Menschen die emotionale Exit-Taste, werden diejenigen, die drinbleiben, zur Minderheit. Je nach Bedarf nimmt man sie von außen als elitär oder naiv, stark oder schwach wahr. Die Außenstehenden wiederum laufen Gefahr, von radikalen Neinsagern umarmt zu werden. Indifferenz schlägt schnell in Ressentiment um, wenn entsprechende Angebote und Umstände dazu einladen.
Ressentiment, meinte Friedrich Nietzsche 1887, sei das Gefühl der Sklaven, das schlussendlich im Aufstand gegen die vornehme Moral schöpferisch werde. Als jüngstes Beispiel fiel ihm die Französische Revolution ein: Hier hätten sich die »volkstümlichen Ressentiments-Instinkte« gegen das klassisch-aristokratische Politik-Ideal erhoben, bevor Napoleon, »jener einzelnste und spätestgeborene Mensch, den es jemals gab«, noch einmal die »furchtbare und entzückende Gegenlosung vom Vorrecht der Wenigsten« in Anschlag brachte.
Man muss Nietzsches Affekt gegen die moderne, inklusive Demokratie nicht teilen, um in seiner Analyse des Ressentiments etwas Wahres zu entdecken. Das Ressentiment heutiger Europagegner wirkt tatsächlich oft so, wie es in seiner »Genealogie der Moral« beschrieben ist: als verdruckstes Neidgefühl angeblich Zu-kurz-Gekommener, die sich als Verlierer und Opfer ökonomischer, sozialer und kultureller Prozesse begreifen; als »rachsüchtige List der Ohnmacht«, die aus der eigenen Schwäche eine »Tugend«, eine »Tat« und ein »Verdienst« macht; als Bündel »versteckt glimmender Affekte« aus Rache und Hass, die sich gegen die angeblich Starken, Selbstgewissen, Elitären wenden. Wer solchem Ressentiment auf den Straßen von Dresden, Stoke-on-Trent oder Marseille begegnet, der sehe sich vor. Es kann in Sekundenschnelle zu blanker Gewalt eskalieren.
Nun sind glücklicherweise nicht alle, die die EU in schwarz-grauen statt in hellen Farben sehen, gewaltbereite Randalierer, die für ihre Politiker nur Verachtung übrighaben und sie an den Galgen wünschen. Doch können patente Anführer das in dieser Gruppe versammelte Ressentiment hochputschen und verbreitern. So wurde aus dem guten Drittel der Briten, die die EU 2014 negativ bewerteten, zwei Jahre später eine knappe Mehrheit von Brexit-Befürwortern. Von diesen 52 Prozent haben wir inzwischen ein relativ klares Profilbild gewonnen: Es sind eher ältere Bürger mit niedrigerem Bildungsstand, die außerhalb der großen Städte wohnen und weder Schotten noch Nordiren sind. Den Schotten ist Brüssel als Gegengewicht zu London lieb und teuer, ebenso wie sich in der katalonischen oder baskischen Peripherie mehr EU-Befürworter finden als im kastilischen Zentrum Spaniens.
Diese Beobachtung ist insofern von Interesse, als sie den Blick auf nationale Integrations- beziehungsweise Desintegrationsprozesse lenkt, die emotionsgeschichtlich aufschlussreich sind. In vielen Staaten Europas hat sich die Nationbildung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts nicht flächendeckend vollzogen. Selbst in Frankreich, das schon unter den absolutistischen Königen als Zentralstaat par excellence galt, gab es Provinzen, später Departements, in denen die französische Sprache nur unter großem Druck heimisch wurde und die Identifikation mit Paris eher schwach ausgeprägt war.
»Bauern zu Franzosen machen«: So fasste der amerikanische Historiker Eugen Weber in seinem Klassiker »Peasants into Frenchmen« aus dem Jahr 1976 die Anstrengungen der Dritten Republik zwischen 1870 und 1940 zusammen, die national indifferenten Landbewohner durch Schule, Militärdienst und Symbolpolitik in national gesinnte Bürger zu verwandeln. Bretonen oder Provenzalen mit einer ausgeprägten eigenen Kultur und Sprache taten sich dabei deutlich schwerer als die Bewohner der Île-de-France. Liebe zum Vater- oder Mutterland, jene allseits geschätzte Tugend des 19. Jahrhunderts, hieß hier etwas anderes als dort, und le petit pays zog meist sehr viel liebevollere Gefühle auf sich als la grande nation.
Auch in Deutschland stellte sich Patriotismus weder von allein ein, noch bezog er sich immer auf dasselbe Territorium. Dynastische Anhänglichkeiten waren bis ins 20. Jahrhundert hinein weit verbreitet. Selbst im Kaiserreich, dem ersten Nationalstaat auf deutschem Boden, fühlte man sich eher als Preußin, Bayerin, Sächsin denn als Deutsche. Die Reichssymbolik stieß an Grenzen: So gab es zwar überall (und bis heute) Bismarck-Denkmäler, doch Kaiser Wilhelm I. war selbst als steinerner Gast in außerpreußischen Landen nicht willkommen. Der Versuch, dem aus zahlreichen Einzelstaaten zusammengesetzten Reich eine gemeinsame, »von oben« verordnete nationale Identität zu verordnen, ging gründlich schief. Wenn überhaupt, kam es erst in den Kriegen des 20. Jahrhunderts zu einer emotionalen Vergemeinschaftung, und sie hatte immense Kosten.
Kriege schweißten die Nation zusammen und produzierten eine über regionale, aber auch soziale, konfessionelle oder ethnische Grenzen hinweg gleitende Einigkeit. Die Franzosen sprachen 1914 von der union sacrée, die britischen Feministinnen tauften ihre Zeitung The Suffragette in Britannia um, und in Deutschland, dessen Kaiser nur noch Deutsche kennen wollte, schloss man Burgfrieden. Begleitet wurde dieser Wille zur Einheit von lautstarker Propaganda, die diese Einigkeit in Wort und Bild in Szene setzte und das Lied vom geliebten Vaterland in allen möglichen Tonarten anstimmte.
Aber Propagandisten, aus der Mitte des Volkes ebenso wie aus der staatlichen Öffentlichkeitsarbeit, taten noch mehr: Sie heizten den Hass auf den Gegner an und zogen dabei alle gefühlspolitischen Register. In den Entente-Staaten zeichnete man Deutsche als Barbaren, die belgische Frauen vergewaltigten und Kindern die Hände abschlugen. In Deutschland beschwor man das Selbstbild des friedlichen Michel, der, von geldgierigen Engländern, rachsüchtigen Franzosen und wilden russischen Horden umzingelt, um das eigene Überleben kämpfen musste. Der Zweite Weltkrieg setzte diese Bildprogramme in radikalisierter Form fort, mit dem Unterschied, dass der alliierte Barbaren-Vorwurf jetzt zu Recht erhoben wurde.
Angesichts dieser Exzesse an symbolischer und materieller Gewalt ist es immer wieder erstaunlich, dass Europäer nach Kriegsende überhaupt wieder aufeinander zugingen. Die traumatischen Erlebnisse und Verluste der Kriegsjahre zur Seite zu schieben und Feindschaft in Freundschaft umzukodieren fiel 1945 nicht leichter als 1918. François Ozons Film »Frantz«, derzeit in den Kinos, zeugt ebenso von den Schwierigkeiten wechselseitiger Annäherung wie die Erfahrung jener Deutscher, die sich in den 1970ern, immerhin ein Jahrzehnt nach dem Élysée-Vertrag, um Partnerschaften mit französischen Städten und Gemeinden bemühten.
Am besten und schnellsten gelang der emotionale Neuanfang unter jungen Leuten, und der deutsch-französische Jugendaustausch gehört nicht zufällig zu den stabilsten Bausteinen, mit denen sich ein grenzüberwindendes, auf Frieden geeichtes (West-)Europa errichten ließ.