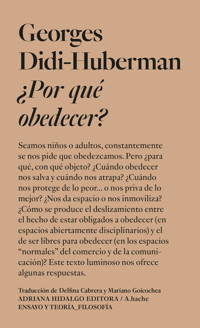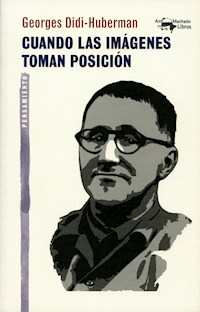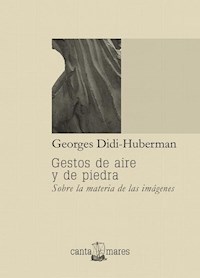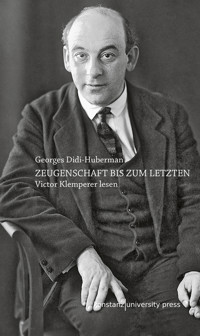
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konstanz University Press
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zeuge zu sein bedeutet, einfühlsam zu sein. Was ist damit gemeint? In einem Gerichtsverfahren wird von einem Zeugen nur verlangt, genau zu sein und faktentreu zu berichten. Wer sich jedoch unaufgefordert dazu entschließt, gegen alle Widrigkeiten und politischen Widerstände auszusagen, befindet sich in einer anderen Position. Er beansprucht, Gefühle zu teilen. Unausgesprochen nimmt er an, dass seine Emotionen an sich schon Fakten der Geschichte oder sogar Ausdruck politischer Haltungen sind. Das dokumentiert Victor Klemperers Tagebuch in der Lektüre von Georges Didi-Huberman. Klemperer schrieb es zwischen 1933 und 1945 heimlich in Dresden, wo er als Jude die gesamte Entfesselung der nationalsozialistischen Unterdrückung durchlitten hat. Es ist ein außergewöhnliches Zeugnis aufgrund seiner genauen Analyse der totalitären Funktionsweise von Sprache, die Klemperer als Philologe vornimmt. Aber das Tagebuch beeindruckt auch durch die Sensibilität des Autors, seine an der Literatur geschulte Offenheit für die Komplexität der Affekte und die ethische Position des Teilens, die diese Sensibilität voraussetzt. Georges Didi-Huberman zeigt, wie sich mit der totalitären Sprache und der Niederschrift dieses Tagebuchs zwei Positionen gegenüberstehen, die mit affektivem Geschehen konträr umgehen. Es handelt sich um einen politischen Kampf, der in jedem Winkel, jeder Wendung dieser wertvollen Schrift und dieser wertvollen Zeugenschaft lesbar wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Georges Didi-Huberman
ZEUGENSCHAFT BIS ZUM LETZTEN
Victor Klemperer lesen
Aus dem Französischen von Petra Willim
Konstanz University Press
Titel der Originalausgabe:
Le Témoin jusqu’au bout. Une lecture de Victor Klemperer
© 2022 Les Éditions de Minuit, Paris
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds und aus Mitteln der DFG (Leibniz-Preis für Prof. Dr. Juliane Vogel) gefördert.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie;
detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Konstanz University Press 2024
www.k-up.de | www.wallstein-verlag.de
Konstanz University Press ist ein Imprint der
Wallstein Verlag GmbH
Umschlaggestaltung: Eddy Decembrino
ISBN (Print) 978-3-8353-9174-1
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-9766-8
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-9767-5
»Ich war auf einen Stuhl in der Diele gezwungen worden, mußte alles mitansehen und -hören und zitterte immer um mein Tagebuch. Ich mußte beim Abhängen der schweren Gemälde helfen. Bisher war mir wenig Übles geschehen. […] Ich glaubte schon, aus der Gefahr zu sein, als Der Mythus des 20. Jahrhunderts und mein Notizblatt daneben zur Katastrophe führten. Das vorige Mal, bei einem offenbar etwas höheren Beamten, hatten Buch und Notizen kaum Widerspruch erregt. Diesmal wurde mir diese Lektüre als furchtbares Verbrechen angerechnet. Das Buch wurde mir auf den Schädel gehauen, ich wurde geohrfeigt, man drückte mir einen lächerlichen Strohhut Kätchens auf […] (Ohrfeigen und Tritte waren auch auch diesmal erträglich – aber mein armes Herz und die Angst um die weitere Entwicklung!) […] Nur wurde unter heftigsten Drohungen darauf gedrungen, das Buch abzugeben und uns nicht zu unterstehen, weiter eine Leihbibliothek zu benutzen. […] Gestern, und heute tagsüber, war ich sehr zerschlagen, der verstärkte Druck der Lebensgefahr, die weitere Drosselung, die grausame Unsicherheit lasteten sehr. Jetzt, gegen Abend, bin ich schon wieder beruhigter. Es muß auch so weitergehen. Irgendwelche bereichernde Lektüre wird sich schon finden, und das Tagebuch werde ich weiter wagen. Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten.«
Victor Klemperer, Tagebuch, 11. Juni 1942
»Was ihn bewegt, bewegt.«
Gottfried Ephraim Lessing, zitiert von Hannah Arendt in: Menschen in finsteren Zeiten (1959)[1]
Inhalt
Von der emotionalen Tyrannei: »Es gibt kein Dennoch«
Spaltung, Teilen, Isolation
Victor Klemperer, Philologe der totalitären Sprache
Teilen, betrachten, widerstehen
Die kritische Entscheidung: der abscheulichen Sprache zuhören
Gibt es eine vox populi?
Im Räderwerk der Unterdrückung
Protokoll des affektiven Geschehens
Verzweiflung und Ekel umlenken
Von der ethischen Möglichkeit: »Es gibt ein Dennoch ...«
»An meinem Bleistift klettere ich aus der Hölle«
Auf der Suche nach der hoffnungsfrohen Zeit
Damit eine Erzählung Energie freisetzt
Bibliographischer Hinweis
Abbildungsverzeichnis
Anmerkungen
Von der emotionalen Tyrannei: »Es gibt kein Dennoch«
Gefühle führen in uns eine Teilung herbei. Vielleicht entsteht gerade wegen dieser mit den Gefühlen einhergehenden Teilung häufig der Wunsch, uns anderen mitzuteilen. Was macht ein Gefühl, wenn es in uns aufkommt, sich äußert oder gar herausplatzt? Es spaltet die Einheit des »Ich«. Es nagt an seiner Selbstbeherrschung, untergräbt die Kontrolle über Körper und Seele. Die Beschaffenheit jeder Sache – im Selbst und außerhalb des Selbst – gerät durcheinander, nur ein wenig (eine leichte Erschütterung des Gleichgewichts) oder im Übermaß (ein großer Ausbruch von Ungekanntem). Gefühle können im Gewebe der Welt einer Farbschattierung entsprechen oder einer Falte, ein vorübergehendes Rascheln erzeugen oder einen endgültigen Riss, einem kaum wahrnehmbaren Sandkorn gleichen oder dem allgemeinen Zusammenbruch der gesamten Umwelt. Die Schwierigkeit, Gefühle bis ins Letzte zu begreifen oder auch nur schlicht zu beschreiben, gründet darin, dass ihr unmittelbares Auftreten fast immer durch die Komplexität und Tiefe eines Symptoms verstärkt oder verhindert wird. Das Gefühl besteht nicht nur aus der spontanen Geste, in einem bestimmten Moment mit der Faust auf den Tisch zu schlagen; es umfasst ebenfalls den Zeitraum, in dem die Wut geschürt wird, bis sie in dieser Geste hervorbricht, wie auch das Danach. Solche Wut zu erfassen ist also keineswegs einfach, da sie alle möglichen psychischen Veränderungen voraussetzt, auf deren Grundlage dann die plötzliche Geste hervorbricht.
Ein Gefühl äußert sich häufig in einem Ausbruch, einer Gebärde. Und dennoch lässt es im Hintergrund sehr wohl andere Konturen erkennen, andere Gefilde oder Abgründe: einen ganzen Wald emotionaler Zustände. Ich mag wütend sein, unddennoch ist meine Zärtlichkeit oder meine Achtung gegenüber der Person, vor der ich mit der Faust auf den Tisch schlage, noch da, ungebrochen. Hinter meiner Geste mag ich vieles zurückhalten – aber es ist trotz allem zugegen und wirkmächtig. Ein Gefühl ließe sich mit dem gesprochenen Wort vergleichen, das zugleich viel Unausgesprochenes, viele Nuancen in sich trägt: In jedem »affektiven Geschehen« stecken zumindest zwei Bedeutungen, zwei Emotionen. Die Vielgestaltigkeit eines Gefühls – sein Anteil an Freiheit, könnte man sagen – sorgt dafür, dass sie stets sein Gegen-Motiv oder seine Gegen-Handlung mit einem undDennoch hervorruft, das uns innerlich spaltet, sich aber auch insgeheim oder ausdrücklich an den anderen wendet. Man tadelt jemanden, unddennoch bewundert man ihn heimlich. Man bewundert ihn, unddennoch zeichnet sich dahinter das Schreckgespenst einer Rivalität, einer unausgesprochenen Aggressivität ab. Man legt verwegene Freude an den Tag, unddennoch stirbt man innerlich vor Angst. Man empfindet Furcht, unddennoch provoziert man jemanden dreist. Man errötet vor Scham, unddennoch vollzieht man ansatzweise eine Geste der Lust. Man ist verzweifelt, unddennoch verfolgt man starrköpfig das Ziel seiner Wünsche.
Viele bedeutende Schriften zeichnen sich dadurch aus, dass sie die unendliche Farbpalette dieser zwiespältigen, subtilen, paradoxen oder dialektischen Gefühle nachzuzeichnen verstanden. Das reicht von der klassischen Kurzformel »Geh’, ich hasse Dich doch nicht …« – die weit mehr als eine Negation, weit mehr als eine Litotes ist, schon allein wegen des »Geh’«, das, indem es fast nichts sagt, so viel ausdrückt – bis hin zu den unendlich vielen Schattierungen emotionaler Erfahrungen in der Proustschen Welt. Diese Welt läuft mit Blick auf dieses »Un-Ding« Emotion auf das Gleiche hinaus wie die gesamte Malerei Monets, die die Undinglichkeit von »Blumen«, »Gras«, »Wasserspiegel« oder »Himmel« zutage fördert: eine bis ins Unendliche wuchernde Mikrographie oder Mikrologie der Variationen und Unterschiede. Das heißt, es gibt eine Fülle von sensorischen und emotionalen Nuancen in ein und demselben empfindungsfähigen Leben.
Andere Arten des Schreibens – häufig die Zeugnisse aus sehr »finsteren Zeiten« – machten es dringlich, die Frage von hinten aufzurollen. Was wäre eine Emotion ohne ein und Dennoch? Welche Schreibweise wäre in der Lage, ihre Existenzweise nachzuvollziehen und zu entschlüsseln? Mir kommt die berühmte – äußerst aufschlussreiche – Passage aus dem zweiten Kapitel von Primo Levis Erzählung »Ist das ein Mensch?« in den Sinn: »Durstig wie ich bin, sehe ich vor dem Fenster in Reichweite einen schönen Eiszapfen hängen. Ich öffne das Fenster und mache den Eiszapfen ab, doch gleich kommt ein großer und kräftiger Kerl, der draußen herumging, und reißt ihn mir mit Gewalt aus der Hand. ›Warum?‹ frage ich in meinem beschränkten Deutsch. ›Hier ist kein Warum‹, gibt er mir zur Antwort und stößt mich zurück.
Die Erklärung hierfür ist grauenhaft und doch so einfach: an diesem Ort ist alles verboten; nicht aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, sondern weil das Lager zu diesem Zweck geschaffen wurde.«[2]
Wenn das Konzentrationslager der Ort par excellence ist, an dem es kein Warum gibt, könnte man dann nicht entsprechend die Hypothese aufstellen, dass der totalitäre Raum – in seinem sozialen, politischen, administrativen, juridischen, alltäglichen und affektiven Programm – grundsätzlich derjenige ist, der den menschlichen Emotionen dieses keinDennoch aufzwingt? Diese ethische Frage wirft eine andere, mehr anthropologische auf: Gibt es nicht zumindest zwei einander entgegengesetzte Formen, mit der – intrapsychischen oder intersubjektiven – Erfahrung der Spaltung umzugehen, indem man entweder das undDennoch in unseren affektiven Geschehnissen akzeptiert oder verweigert?
Das undDennoch akzeptieren: Das meint, dass ein Gefühl, sobald es uns spaltet, uns dazu bringt, aus uns herauszugehen, uns dem anderen zuzuwenden, uns nicht in uns zu verschließen. Es liegt in der Kraft des Wortes teilen, das es zugleich die konstitutive Trennung (etwas zerteilen) wie auch die notwendige Vergemeinschaftung (etwas miteinander teilen) in sich trägt. Deshalb ist das, was uns im Inneren zerreißt, uns zerteilt, dasjenige, weshalb wir uns auf den anderen zubewegen und mit ihm fühlen. Mit dieser Geste akzeptieren wir die Andersartigkeit, die Alterität, genauso wie unsere Gemütsbewegung, die Alteration. Zweifellos sind wir gespalten, aber nicht gegenüber der Welt oder den anderen isoliert. Das undDennoch auf sich nehmen bedeutet letztlich, dass wir in – und trotz – der konstitutiven Fragilität des affektiven Geschehens in uns abwägen und damit dessen beunruhigende Komplexität akzeptieren.
Die entgegengesetzte Haltung besteht darin, diese Fragilität, diese Komplexität zu verleugnen und jedes Abwägen (zwischen zwei oder mehreren Polen) auf eine Parteinahme zugunsten einer Seite einzufrieren. Dieser Haltung gemäß muss man sich für das keinDennoch entscheiden: ohne Nuancen, ohne Zögern. Sie versucht, die emotionale Unruhe zu verringern, wenn die Gefühle einen Eiertanz aufführen. Aber was man dabei an Gewissheit und Macht gewinnt, verliert man bald an Andersartigkeit und Kraft. Der Affekt des kein Dennoch verschanzt sich und isoliert sich gewaltsam gegenüber jeder Andersartigkeit: keine Nähe, kein Pardon, keine Frage … Dieser Affekt basiert auf dem Ausschluss, auf der puren emotionalen Rivalität. Er blockiert jegliches Hinhören, jegliche Möglichkeit auf einen Dialog zwischen den Emotionen. Um dies zu erreichen, muss er seinen eigenen Ausdruck und seine eigenen Inhalte so weit wie möglich vereinfachen, die Sprache auf ein Dies fixieren, das nichts von einem Jenes wissen will. Keine Nuancen mehr: Die den affektiven Vorgängen innewohnende Lebhaftigkeit wird zu einem unbeweglichen Block selbstbewusst auftretender Affektivität. Jede andere Emotion wird zur feindlichen Emotion.
Und schon entsteht eine emotionale Tyrannei, auf die die tatsächlichen – historischen, politischen – Tyranneien immer wieder zurückgegriffen haben. Schon Thukydides hebt in einer berühmten Passage des Peloponnesischen Krieges diesen Moment hervor, in dem der Krieg in ein Stadium gerät, das die schlimmsten tyrannischen Wünsche und mit ihnen die schlimmsten Leidenschaften entfesselt. Was er beschreibt, ist nichts anderes als eine breite Palette von psychischen Symptomen und kriminellen Gelüsten, die auf der von »Habgier (pleonexía) und […] Ehrgeiz (philotimía)« angetriebenen »Herrschsucht« beruhen.[3] Schon vorab legt Thukydides Nachdruck auf die entscheidende Tatsache: nämlich dass sich der pathologische Gehalt eines solchen Phänomens darin kundtut, dass die ethischen Werte von den affektiven völlig losgelöst sind und dass damit der Sinn der Wörter, das Niveau der Sprache selbst verloren geht: »Und die bis dahin übliche durch Bezeichnungen ausgedrückte Bewertung von Verhaltensweisen wurde verändert, wie man es für richtig hielt: Hirnloses Draufgängertum galt plötzlich als tapferer Einsatz für die Freunde […]; wie wahnsinnig zu toben hielt man für männlich. […] Wer unentwegt hetzte, galt als vertrauenswürdig, wer ihm widersprach, als verdächtig. […] Und Verwandtschaft wurde zu einer loseren Bindung als Parteizugehörigkeit, weil diese eher bereit war zu skrupellosem Handeln; denn nicht mit den geltenden Gesetzen zu gutem Zweck agieren derartige Gruppen, sondern wider das bestehende Gesetz zur Bereicherung. […] wer in den Städten in führende Positionen gekommen war, pflegte in beiden politischen Lagern mit klangvollen Parolen« sich selbst zu preisen; »in ihrem mit allen Mitteln ausgetragenen Ringen um die Vormacht schreckten sie vor keiner Schandtat zurück […]; und ob sie nun durch rechtswidrige Abstimmung oder durch nackte Gewalt sich die Vorherrschaft zu sichern versuchten, sie ließen dabei kein Mittel aus, ihre augenblickliche Gier nach dem Sieg zu befriedigen. Heilig war somit weder den einen noch den anderen irgendetwas; mit scheinheiligen Worten aber verschafften sich die, denen eine hässliche Tat geglückt war, einen besseren Namen (euprepeía logou).«[4]
Spaltung, Teilen, Isolation
Jeder tatsächlichen Tyrannei entspricht als Grundlage eine emotionale Tyrannei, die sich im öffentlichen Raum in einem bestimmten Sprachgebrauch niederschlägt: kein Dennoch und bald schon auch kein Warum … Wer auf seine Emotionen hört, stellt sie zugleich in Frage – Was? Wie? Warum?; und indem er das tut, verwendet er eine Sprache des Teilens und des undDennoch. Wer aber sich oder anderen Emotionen gewaltsam aufzwingen möchte, spricht eine andere Sprache, nämlich die der undifferenzierten Isolation, Bedeutungsblock steht gegen Bedeutungsblock. Die beiden Verwendungsformen von Sprache unterscheiden sich demnach nicht weniger als die beiden affektiven Schemata, indem sie über ihre unterschiedliche Semantik und der ihr jeweils entsprechenden Syntax die Signifikanten gemäß ihrer heterogenen psychischen Funktion organisieren. Es verwundert nicht, dass Sigmund Freud schon sehr früh diese Differenz problematisieren wollte. Er kommt nach einem größeren Zeitraum, der seine gesamte klinische Praxis und Theorie umfasst, wieder darauf zurück – ein Hinweis darauf, dass es sich hierbei in seinen Augen um ein grundlegendes anthropologisches oder »metapsychologisches« Paradigma handelt.
Mit der Spaltung der Psyche hat sich Freud tatsächlich schon zu Beginn befasst. In uns tun sich Risse auf – aus denen die Symptome emporschießen –, weil wir ständig ein Spielball unserer Konflikte sind. Hierbei handelt es sich um ein konstitutives Faktum: Von Geburt an sind wir zwiegespalten, unser Heranwachsen, Denken und Handeln ist zwiespältig. In einem seiner ersten Aufsätze, 1894 veröffentlicht, entwickelte Freud die grundlegende Hypothese von einer »Bewußtseinsspaltung« und, später im Text, einer »Spaltung des Bewußtseinsinhaltes«, die aus der »Unverträglichkeit« einer Vorstellung mit dem sonstigen Selbstbild hervorgeht und damit auf der emotionalen Ebene – mithin auf der Ebene des Verhaltens und der Sprache – einen Konflikt auslöst; denn die in Frage stehende, im Grunde schmerzhafte, Spaltung trennt die psychische Vorstellung von ihrem ursprünglichen Affekt. Es entstehen aus dieser »Unverträglichkeit« entweder körperliche Leiden oder »falsche Verknüpfungen«, mithin Zwangsvorstellungen, oder Halluzinationen: folglich Symptome.[5]
Die klinische Beobachtung veranlasste Freud dazu, ein unterschiedliches Funktionieren dieser Spaltung zu konstatieren: Es gibt mindestens zwei Formen des Gespaltenseins. Bei der ersten verteidigt sich das Ich durch Verdrängung.[6] Die unverträgliche Vorstellung wird verworfen, aber nicht der Affekt; dieser ist weiterhin lebendig, wird aber verschoben und äußert sich auf unverständliche oder »symptomatische« Weise: »[…] ihr frei gewordener Affekt aber hängt sich an andere, an sich nicht unverträgliche Vorstellungen an […].«[7] In dieser Situation ist das Ich folglich der ständigen Gefahr einer Wiederkehr des Verdrängten ausgesetzt: Das ist das Schicksal aller Neurosen. Die andere Form der Spaltung ist radikaler: Sie mündet in die erbarmungslose Welt der Psychose. Freud schreibt, »daß das Ich die unerträgliche Vorstellung mitsamt ihrem Affekt verwirft […].«[8] Diese Art der Spaltung erlaubt nicht mehr die Realität des Konflikts und die Ambivalenz des Teilens: Sie mündet in eine Einbahnstraße, in das verhängnisvolle Schicksal einer unwiderruflichen Isolation, die Lacan dann im Gegensatz zur Verdrängung als Verwerfung bezeichnen wird.
Diese Unterscheidung taucht schon bei Freud unter anderem in Der Wolfsmann auf, von dem er schreibt: Dieser »verwarf« die Bedeutung der Kastration, er habe von ihr »im Sinne der Verdrängung« nichts wissen wollen: »Damit war eigentlich kein Urteil über ihre Existenz gefällt, aber es war so gut, als ob sie [die Kastration] nicht existierte.«[9] Ist damit nicht gesagt, dass es an der Schwelle zur Psychose kein Urteil (keine geistige Beunruhigung) und keinDennoch (keine affektive Beunruhigung) gibt? Wir kennen all die theoretischen Lehren, die Lacan aus der Freudschen Unterscheidung zwischen den Prozessen der Neurosen und der Psychosen zu ziehen verstand: Verdrängung auf der einen Seite und Verwerfung (von Lacan 1956 mit »retranchement« und später mit »forclusion« wiedergegeben) auf der anderen.
In der Verdrängung, könnte man sagen, ›geht alles weiter‹ – selbst wenn ›es schlecht geht‹ oder ›schiefläuft‹ –, während bei der Verwerfung ›gar nichts mehr geht‹: ›Es gibt kein Durchkommen mehr‹. Lacan betont entsprechend, dass »die Verdrängung […] nicht von der Wiederkehr des Verdrängten unterschieden werden [kann], weshalb das Subjekt das, wovon es nicht sprechen kann, aus allen seinen Poren herausschreit.«[10] »Die Verwerfung« hingegen »hat damit jeder Bekundung der symbolischen Ordnung […] ein Ende bereitet.«[11] Was also »das Subjekt so verworfen hat«, das isoliert es tyrannisch von jeglicher Versprachlichung, von jeglicher »Offenheit zum Sein«[12] – also von den anderen. Das ist der typische Prozess der Psychose: Was sprachlich verboten ist, wird im Realen wieder auftauchen, beispielsweise in der Form der »tatsächlichen Tyrannei«, wie Thukydides sie einstmals in Erinnerung rief. »Was nicht ans Licht des Symbolischen gekommen ist, erscheint im Realen«,[13] schreibt Lacan, und das Reale wiederum erwartet »nichts vom Sprechen«.[14] In seinem Aufsatz über die Psychose von 1959 – ein Text, der auf 1957–1958 datiert ist, aber aus seinem Seminar 1955–1956 hervorgegangen ist –, gibt er diesen Sachverhalt mit folgenden Begriffen wieder: »Die Verwerfung wird also von uns für die Verwerfung[forclusion]des Signifikanten gehalten werden. […] Das ist die einzige Form, in der es uns möglich ist, das zu begreifen, dessen Ergebnis uns Schreber als das eines Schadens präsentiert« und wofür Schreber selbst »das Wort ›Seelenmord‹« gebraucht.[15]
Der Hinweis auf die paranoische Psychose ist hier keineswegs Zufall. Schon in seinen ersten Schriften über Paranoia, angefangen bei seiner Doktorarbeit in Medizin im Jahre 1932,[16] verwendet Lacan den Begriff der Verwerfung. Mehr noch: Vielleicht erinnerte sich Lacan daran, dass die Frage der Psychose für ihn in einem historischen und politischen Kontext auftauchte, jenem der 1930er Jahre, in dem das Aufkommen des Faschismus seine paranoischen Botschaften, seine »Seelenmorde« und seine Sprechverbote gewaltsam durchsetzte, bevor in der Realität die Morde ganzer Bevölkerungen durch die politische und militärische Organisation »tatsächlicher Tyranneien« zum Vorschein kamen. Freud selbst, trotz seiner scheinbaren Zurückhaltung und apolitischen Haltung, versäumte es nicht, auf die tyrannischen Geschehnisse seiner Zeit zu reagieren, und zwar mit einer Reihe von Überlegungen über die unterschiedlichen Arten, mit der die Verwerfung des Symbolischen die schlimmsten Affekthandlungen und die schlimmsten politischen Auswirkungen entfesselt: Das beginnt bei »Zeitgemäßes über Krieg und Tod« von 1915, setzt sich fort mit Massenpsychologie und Ich-Analyse von 1921 und DieZukunft einerIllusion von 1927 und mündet schließlich in Das Unbehagen in der Kultur von 1930.[17]
Ist es verwunderlich, dass Freud an seinem Lebensabend, nachdem er gezwungen war, vor der nationalsozialistischen Unterdrückung zu fliehen, es unternahm – ohne dass er seine Schrift beenden konnte –, ein weiteres Mal die Auswirkungen der Spaltung zu überdenken?[18] Ist es verwunderlich, dass er in ebendiesem Jahr 1938 für sein letztes Werk, Der Mann Moses unddie monotheistische Religion, zwei verschiedene Vorworte verfassen musste, eines von Wien aus (vor dem sogenannten »Anschluss« Österreichs ans Dritte Reich im März) und das andere (im Juni) von London aus? »Wir leben in einer besonders merkwürdigen Zeit. Wir finden mit Erstaunen, daß der Fortschritt ein Bündnis mit der Barbarei geschlossen hat.«[19] Was soll man angesichts dessen tun? Freud antwortete, dass man einfach – mögen die Umstände auch noch so kompliziert sein – beharrlich weiter fragen und denken müsse und deshalb nicht aufhören dürfe,