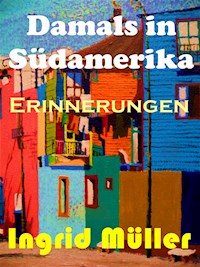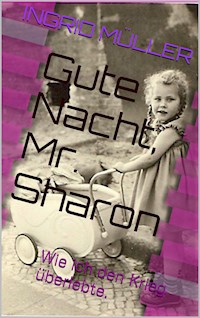9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit nur zwei Minuten Abstand kamen wir als eineiige Zwillinge auf die Welt, unsere Leben waren von Geburt an untrennbar miteinander verknüpft. Seitdem bauen wir fest aufeinander und vertrauen uns bedingungslos. Im Jahr 2008 nahm unser unbeschwertes Leben jedoch eine radikale Wendung. Im Abstand von zwei Monaten erhielten wir die gleiche niederschmetternde Diagnose: Brustkrebs. Wir lernten das Land der Kranken kennen und durchliefen ein monatelanges medizinisches Programm: Operation, Chemotherapie, Strahlenbehandlung – optisch waren wir keine Zwillinge mehr. Wir wollen erzählen, wie wir unsere Verzweiflung und Angst in den Griff bekamen und Zuversicht und Vertrauen lernten, um die Fächer unserer Leben in der Hand zu behalten. Aber auch, welche Momente uns zusammenschweißten und welche Erfahrungen unsere Zwillingsbeziehung veränderten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Ingrid Müller • Renate Müller
Zwillingskrebs
Ein Schicksal, zwei Geschichten
Über dieses Buch
Mit nur zwei Minuten Abstand kamen wir als eineiige Zwillinge auf die Welt, unsere Leben waren von Geburt an untrennbar miteinander verknüpft. Seitdem bauen wir fest aufeinander und vertrauen uns bedingungslos.
Im Jahr 2008 nahm unser unbeschwertes Leben jedoch eine radikale Wendung. Im Abstand von zwei Monaten erhielten wir die gleiche niederschmetternde Diagnose: Brustkrebs. Wir lernten das Land der Kranken kennen und durchliefen ein monatelanges medizinisches Programm: Operation, Chemotherapie, Strahlenbehandlung – optisch waren wir keine Zwillinge mehr.
Wir wollen erzählen, wie wir unsere Verzweiflung und Angst in den Griff bekamen und Zuversicht und Vertrauen lernten, um die Fächer unserer Leben in der Hand zu behalten. Aber auch, welche Momente uns zusammenschweißten und welche Erfahrungen unsere Zwillingsbeziehung veränderten.
Vita
Ingrid Müller, Jahrgang 1967, studierte Biologie und Chemie, arbeitete lange als freie Journalistin für verschiedene Fachmagazine und die dpa. Heute ist sie Chefredakteurin des Gesundheitsportals «Netdoktor.de».
Renate Müller, Jahrgang 1967, studierte ebenfalls Biologie, arbeitete als Reporterin bei der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», «Berliner Zeitung» und der dpa. Seit 2000 ist sie als Moderatorin, Redakteurin und Reporterin für den Hessischen Rundfunk unterwegs.
Achim Greser gehört zu den bekanntesten Karikaturisten Deutschlands und zeichnet seit vielen Jahren im Duo «Greser & Lenz» für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung», den «Stern» und die «Titanic».
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, April 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Illustrationen Achim Greser
Lektorat Regina Carstensen
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München (Ilustration: Achim Greser)
ISBN Buchausgabe 978-3-499-62707-1 (1. Auflage 2011)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-44111-8
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Für meine Schwester
Vorwort
Angst
Loreley
Höllensturz
Wandlung
Obamas-faule-Lehman-SPD
Marianengraben
Gute Geister
Tumorformel
Mützenluder
Himmelbett
Kellerkinder
Hoffnung
Literatur
Internetadressen
Danksagung
Für meine Schwester
Vorwort
Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen.
LUDWIGWITTGENSTEIN
Wer bist du eigentlich?» Für uns eineiige Zwillinge ist und war die Frage ein Dauerbrenner. Da hilft es wenig, wenn das Muttermal bei der einen (Renate) rechts, bei der anderen (Ingrid) links im Gesicht sitzt. Irgendwann gaben wir unsere Erklärungsversuche auf, gewöhnten uns daran, dass sich unser Umfeld in zwei Lager spaltet: Die einen Menschen erkennen den Unterschied sofort, die anderen lernen es leider nie.
Mit nur zwei Minuten Abstand kamen wir als eineiige Zwillinge auf die Welt, unsere Leben waren von Geburt an untrennbar miteinander verknüpft. Seitdem bauen wir fest aufeinander und vertrauen uns bedingungslos. Unangenehme Dinge würden wir uns gegenseitig am liebsten sofort aus dem Weg räumen. Jeder leidet heftiger, wenn es dem anderen schlechtgeht, ganz egal, in welchen Problemen man gerade selbst steckt. Danebenstehen und einfach nur zusehen ist schwer, die Empathie ein Dauerzustand und ein Unbeteiligtsein unmöglich. Jahrelang teilten wir eine WG, absolvierten ein ähnliches Studium und managten eine Kneipe, nur Krankheit war für uns ein Fremdwort. Bestenfalls Husten, Schnupfen, Heiserkeit – allerdings lebt eine von uns mit, die andere ohne Blinddarm.
Im Jahr 2008 nahm unser unbeschwertes Leben eine radikale Wendung. Im Abstand von zwei Monaten erhielten wir eine niederschmetternde Diagnose: Brustkrebs. Neun Monate lang durchliefen wir ein medizinisches Programm mit Operation, Chemotherapie, Strahlenbehandlung. Optisch waren wir keine Zwillinge mehr.
Gleiche Gene, gleiches Schicksal – für viele sieht das nach einer Geschichte aus. Aber trotz der gleichen Krankheit bleibt: zwei Menschen, zwei verschiedene Leben. Denn so ähnlich wir äußerlich auch sind, so unterschiedlich reagierten wir in manchen Momenten der tiefsten Krise. Doch neben der Verzweiflung warf dieselbe Diagnose auch viele Fragen auf: Wie individuell ist eine solche Erkrankung? Ist das, was für die eine richtig ist, ebenso für die andere gut? Gibt es eine Art «Rezept», wie man mit der Krankheit umgeht – und taugt es ebenfalls für die Schwester? Was sollten wir besser voreinander verbergen, was klar sagen, damit die andere nicht mutlos wird? Können sich zwei Menschen, die sich von Geburt an so nahestehen, in einer solchen Situation überhaupt helfen? Und wenn ja: wie?
Schnell wurde uns klar, dass wir viel zu wenig über Brustkrebs wussten, dass es buchstäblich jede Frau treffen kann. Rund 57 000 Frauen erkranken jedes Jahr neu an diesem Tumor. Eine beängstigende Zahl, hinter der sich ebenso viele Tragödien verbergen. Ein Drittel der Frauen ist jünger als fünfzig – zu ihnen gehören wir. Einige davon haben wir in den langen Monaten unserer Behandlung kennengelernt. Dabei entstand auch die Idee für dieses Buch.
In den größten Krisen stellten wir fest, dass Humor ein elementarer Bestandteil fürs Überleben ist. Skurrile und komische Situationen – und die gab es trotz allen Leids zuhauf – brachten uns immer wieder zum Lachen, auch auf den Krebsstationen. Deshalb haben wir unseren Wegbegleiter Achim Greser als Dritten in das Projekt eingebunden – zumal er selbst (freiwillig) Teil unserer Geschichte wurde. Er zeichnet seit Jahren im Duo «Greser & Lenz» für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, für den stern und die Satirezeitschrift Titanic. Als wir ihm vorschlugen, das Buch malerisch zu unterstützen, sagte er: «Witze und Krebs – das ist eine echte Herausforderung.»
Für viele ist eine Krebserkrankung in Zeiten von «schön, fit und ewig jung» immer noch ein Tabu, wird bestenfalls in Chemotherapiezimmern und in der Familie verhandelt. Deshalb erzählen wir, wie man sich den Arzt zum Partner und die Krankheit nicht zum Feind macht, wie man sich Verbündete sucht und warum ein Netzwerk aus Freunden so wertvoll ist. Wichtig ist uns aber auch, zu zeigen, wie wir der Krankheit mit Mut und Optimismus begegneten und aus körperlichen und seelischen Tiefs gemeinsam wieder herauskamen, wie wir die Angst vor Krankheit und Tod thematisierten und überwanden. Das Buch schildert zwölf Stationen, es ist eine Art «persönlicher Kreuzweg». Je besser wir uns selbst mit der Krankheit auskannten, desto besser konnten wir mitreden und mündige Entscheidungen treffen. Ein Satz eines Freundes trug uns beide durch dunkle Momente: «Gewinne Zuversicht und Vertrauen, lerne Gelassenheit, das Schicksal lässt sich gemeinsam besser meistern.» Wir hoffen, dass er auch anderen hilft.
Angst
Drei Zigaretten werden ein Leben retten.
«Willst du etwa mit dem Rauchen aufhören?», frage ich belustigt den Mann, der schon seit Stunden neben mir am Tresen einer Münchner Bar sitzt, in freundschaftliche Gespräche vertieft, aus denen er soeben aufgetaucht ist.
«Ja», lacht er, «ich versuch’s immer wieder.» Er packt sich eine der drei Zigaretten, die er, sorgsam gehütet wie Juwelen, vor sich auf dem Tresen drapiert hat, und schon stehen wir vor der Kneipentür, in Qualm eingehüllt, verwickelt in ein kurzweiliges Gespräch über Rauchen, Fitness, Abnehmen und ein gerissenes Kreuzband. Fasziniert bin ich von seiner aufgeschlossenen Art, beinahe untypisch für Theaterschauspieler, die es erfolgreich ins Fernsehen geschafft haben. Deshalb hatte ich ihn auch sofort erkannt. Sein Humor zieht mich an, etwa wie er über seinen Beruf redet: «Manchmal sage ich Sätze, die die Welt nicht braucht.»
Interessanter Typ, dieser Markus, denke ich, während Ingrid und ihr Lebensgefährte Jürgen, die mit mir schon den ganzen Abend in der Bar waren, nachts um zwei ein Taxi zur nächsten Kneipe herbeitelefonieren. Die soll bis morgens um fünf Uhr geöffnet haben, ein skurriler Hort für alle Nachtschwärmer. Zu dritt machen wir uns auf den Weg, Markus und sein schwergewichtiger Schauspielkollege folgen mit dem nächsten Wagen. Wir rücken an im Stoßtrupp, trinken Wein, die Musikbox spielt Richard Wagners Götterdämmerung. Kaum vorstellbar, dass hier tagsüber feinster Kuchen serviert wird. Während es draußen hell wird, tausche ich Küsse mit dem Zigarettenmann unter einer verblichenen Alpentapete.
Es wird eine außergewöhnliche Nacht. In dem Taxi, das Markus schließlich zum Hotel Bayerischer Hof fährt, finde auch ich mich wieder. Magisch angezogen. Eine Stunde nachdem wir uns durch die fremden Kissen gewühlt haben und der Satz «Wieso bleibt so jemand wie du nur alleine?» noch in meinen Ohren nachklingt, merke ich, wie Markus plötzlich stutzt. Dann folgt eine Schicksalsfrage: «Sag mal, was ist denn das? Hast du das schon länger? Das musst du unbedingt nachschauen lassen.» Er insistiert mehrfach auf seiner Feststellung und streicht vorsichtig über eine Stelle an der rechten Brust.
«Ach, das ist dort oft so knotig», antworte ich achtlos und sehe dem Morgen beim Aufwachen zu. Es ist sieben Uhr früh. Der Mann, der neben mir liegt, ein wunderbarer Fremder. Er muss zum Dreh, ich zurück nach Frankfurt. Wir verabschieden uns, heiter beschwingt, vermutlich auf Nimmerwiedersehen. Was bleibt, sind eine besondere Nacht, in deren Erinnerung ich schwelge, und dieser eine irritierende Moment, der mir nicht aus dem Kopf will. Wieder und wieder berühre ich die Stelle, erst verstohlen, dann immer vehementer, auf dem Weg zu Ingrids Wohnung, beim Kofferpacken, am Bahnhof. Kein Zweifel, da ist ein Knoten, und zwar kein kleiner.
Das kannst du nicht einfach ignorieren! Dieser Gedanke jagt mir im Zug durch den Kopf, während ich versuche, mich auf meine Zeitung zu konzentrieren. Besonders wühlt mich die Tatsache auf, dass ein Mann, der mich nicht kennt, etwas an meinem Körper besorgniserregend findet – und dass mir dieses Etwas noch keine Sekunde selbst aufgefallen ist. Klar, an der Brust waren immer irgendwelche knotigen Dinger, mal größer, mal kleiner, eine Berg-und-Tal-Landschaft, die mir aber nie gefährlich erschien. Vorsorgeuntersuchung? Ein Fremdwort. Seit mehr als zehn Jahren mache ich einen großen Bogen um Frauenärzte, also gab es auch nichts zu entdecken. Immer wieder wollte ich mich überlisten, einen neuen Anlauf nehmen, die schlechten Erfahrungen mit einem Arzt überwinden, der mich als schüchterne junge Frau ein paarmal in seinem Massenbetrieb überheblich abfertigte. Ich schaffte es nicht. Wenn das Brustkrebs ist, denke ich, während von der Sonne verbrannte Felder an mir vorbeifliegen, bist du übermorgen tot. Die Angst hat ihren Anker geworfen.
Die nächsten Wochen stürze ich mich in meine Arbeit als Journalistin beim Radio, noch gnadenloser als sonst. Interviewen, telefonieren, konferieren. Es ist 2008, die Hessen-SPD will mit Hilfe der Linken die Macht übernehmen, Wolfgang Clement soll aus der SPD ausgeschlossen werden, und es regnet olympische Medaillen in Peking. Ich hoffe, dass sich diese Wölbung an meiner rechten Seite irgendwie in Luft auflöst. Tut sie aber nicht. Morgens ist sie da und abends und nachts. Jede Sekunde. «Komm, nicht du, du bist erst vierzig», versuche ich mich zu beruhigen. «Niemand in deiner Familie hatte schon mal Brustkrebs. Nicht die Mutter, nicht die Omas, nicht die Tanten.» Parallel hallt Markus’ Frage nach: «Sag mal, was ist denn das?»
Ich kann mich kaum mehr konzentrieren. Interviewpartner, die über Tod und Trauer erzählen, erscheinen mir plötzlich in einem ganz neuen Licht. Niedergeschlagen vertraue ich mich eines Abends meiner Freundin Angela an. Ich kenne sie seit Jahren, wir waren früher Kolleginnen, dann trennten sich unsere beruflichen Wege. Warmherzig ist sie, kann gut zuhören und Probleme lösen. Vor allem die der anderen.
«Du, ich hab einen Knoten in der Brust», eröffne ich ihr in unserer Frankfurter Stammkneipe. Danach erzähle ich von der Nacht mit Markus, dass ich seitdem vor Angst vergehe, weil das Ding sich nicht verschieben lässt, was kein gutes Zeichen ist, wie ich in meinem Biologiestudium Ende der neunziger Jahre am Rande gelernt habe. Und dass ich glaube, nicht mehr an einer Untersuchung vorbeizukommen. Sie sieht besorgt aus, sehr besorgt. Sagt, sie habe eine gute Frauenärztin, wüsste aber nicht, ob sie nur Privatpatienten behandelt. Angela verspricht mir, sich auf der Stelle darum zu kümmern. Am liebsten würde ich ihr riesige Steinquader in den Weg legen, sämtliche Telefonkabel durchschneiden, ihr die Reifen am Auto platt stechen, sie einfach nur aufhalten. So groß ist meine Angst vor dem Knoten. Mit der ich aber zugleich nicht leben kann.
Die nächsten Tage hoffe ich, dass Angela die Geschichte vergisst, ihre Ärztin keinen Termin hat oder keine Kassenpatienten aufnimmt. Aber sie schickt mehrere E-Mails, hält mich auf dem Laufenden und bemerkt mein Zögern, meine Bereitschaft zu verdrängen. «Du musst dir überlegen, ob du leben willst», schreibt sie mir schließlich kurz und bündig. Das sitzt. So kenne ich sie. Die Frau der schmerzhaften Wahrheiten. Erst denke ich, so ein Quatsch, das ist doch völlig übertrieben, es geht doch nicht um Leben und Tod. Aber dann schießt die Realität geradeaus auf mich zu. Die Redaktion um mich herum versinkt, ich sehe auf den Bildschirm, meine Kollegen wuseln um mich herum, mit Kopfhörern, am Telefon. Der Lärmpegel ist wie immer immens, und ich weiß: «Verdammt, sie hat recht!» Noch heute bin ich ihr unendlich dankbar.
Der Termin bei Dr. Barbara König steht schnell. Kassenpatientin hin oder her. Es ist der 25. August. Ein Montag. Sonnig. Ich habe mich krankgemeldet und radle schlotternd und mit leerem Magen der Untersuchung entgegen.
«Kommen Sie, wir schauen gleich mal nach», empfängt mich die Ärztin, die bemerkt, dass zu viel Gerede mich jetzt um den Verstand brächte. Sie lotst mich in einen abgedunkelten Raum. Angespannt verfolge ich, wie sich ihre braunen Rehaugen konzentriert auf den Ultraschallschirm heften. «Machen Sie sich keine Sorgen», wird sie mir bestimmt gleich sagen. «Ich tippe auf eine Zyste, ein gutartiges Fibroadenom.» Ich phantasiere, während ich daliege und sie den harten Knoten mit dem Schallkopf umkreist. Offensichtlich ein Hirngespinst.
«Ich schicke Sie jetzt gleich zur Mammographie», sagt die Ärztin nach Minuten freundlich, aber sehr bestimmt. «Hier, am Schillerplatz, gleich um die Ecke. Man kann das mit dem Ultraschall allein nicht sicher sagen.» Meine Nervosität steigt. Keine Entwarnung.
Eine Stunde später betrete ich die radiologische Spezialpraxis. Hier heißt es: «Bitte gerade hinstellen, Arme hochlegen.» Es werden Brüste zwischen zwei Glasplatten eingequetscht, Röntgenstrahlen durch das Gewebe geschickt, seine Dichte, Zusammensetzung und eben auch Knoten sichtbar gemacht. Die Mammographiebilder bekomme ich nicht zu Gesicht. Tür auf, Tür zu, ein abgedunkelter Raum, eine Liege, wieder Ultraschall. Die Radiologin nimmt dicht neben mir Platz, ein ernster Gesichtsausdruck, Augenschlitze hinter schwarzer Sekretärinnenbrille, die auf Brustgewebe blicken. Kein Wort. Keine Erklärung. Keine Entwarnung. Ich frage auch nicht nach, zu verunsichert bin ich. «Warten Sie hier einen Moment, Sie bekommen einen Brief von mir mit und eine CD mit den Mammographieaufnahmen.» Das ist alles, was dieses maskenhafte Wesen äußert. Beim Hinausgehen frage ich mich, ob der Holterdiepolter-Termin und die Zurückhaltung der Radiologin auch etwas über den Ernst meiner Lage aussagen. Denn auf solche Untersuchungen muss man sonst oft wochenlang warten.
Wie betäubt finde ich mich vor Frankfurts Alter Oper wieder, ausgespuckt vor dem «Dem Wahren Schoenen Guten», das in goldener Schrift am Dachfries prangt, mit einem Kuvert in der Hand. Wo soll ich jetzt hin, was damit anfangen? Ich klettere auf mein Fahrrad, schlingere zurück zu Dr. König, die mich nach kurzer Wartezeit erneut empfängt. Der Brief, von dessen unheilvollem Inhalt ihre verdunkelten Augen künden, entfaltet seine Macht. Sie liest und zuckt unmerklich.
«Wir machen einen Biopsietermin aus», bestimmt sie und versucht Zuversicht und Ruhe zu spenden. «Da werden mit einer Nadel Zellen entnommen und analysiert, dann weiß man, ob es bösartig oder gutartig ist.» Sie greift zum Hörer. «Was, warum erst in einer Woche?», höre ich die Gynäkologin sprechen, während ich zusammengekauert auf die Uhr vor meiner Nase blicke, auf deren Zeiger eine kleine Hexe klemmt und Sekunde um Sekunde ihre Runden dreht. «Sie wissen doch, in solchen Fällen sollte man möglichst schnell reagieren», verhandelt sie beharrlich weiter. Aber es bleibt dabei. Die Biopsie kann erst am 1. September stattfinden.
«Wo?», frage ich schwach, nachdem Dr. König aufgelegt hat.
«Krankenhaus Frankfurt. Station U4, links.»
Den Briefumschlag im Gepäck – noch immer habe ich nur eine vage Vorstellung von dem, was darin steht, doch er fühlt sich tonnenschwer an –, kehre ich zurück in meine Wohnung. Es kommt mir vor, als hätte jemand das Sonnenlicht ausgeknipst. Nichts hat sich in Luft aufgelöst, rein gar nichts, nicht der Knoten, nicht die Panik, nur die Hoffnung, dass dieser Spuk zu Ende sein könnte. Schließlich wage ich einen Blick in den Mammographiebefund und bleibe ganz am Ende am Wort «Beurteilung» hängen. «Malignomsuspekt» steht da als Hinweis an Dr. König. Weiterhin: «Eine stanzbioptische Abklärung des Herdbefunds ist notwendig. Die Patientin wird sich bei Ihnen umgehend zur Planung für das weitere Prozedere vorstellen.» Es folgt eine Formel zur medizinischen Klassifizierung. Das Wort «malignomverdächtig», das ich nun entziffere, hatte meine Frauenärztin nicht in den Mund genommen, vielleicht, um mich nicht noch mehr zu beunruhigen. Nichts ist klar, alles bislang ein Verdacht. Aber das Bösartige, eine Möglichkeit namens Brustkrebs, hat sich durch einen Spalt gezwängt. Wie lange hätte ich noch zu leben, wenn …? Mir kommt eine Kollegin in den Sinn, genauso jung wie ich, die ich eines Tages mit Kleopatra-Frisur traf. «Schön siehst du aus», sagte ich, ohne die Perücke zu erahnen. Ein paar Monate später war sie tot. Brustkrebs. Schnell weg mit den Gedanken. Ganz schnell. «Mein Italienischkurs!», schrecke ich hoch, als mein guter Freund Fritz klingelt und mich wie immer abholen will.
«Na, hast du die Hausaufgaben gemacht, hai fatto i compiti?» Er nimmt mich auf den Arm, ein Running Gag zwischen uns, seitdem wir gemeinsam eine fremde Sprache lernen und uns wie früher auf der Schulbank fühlen. Aber dann gefriert ihm sein Lächeln.
«Ich war heute bei der Mammographie», vertraue ich mich ihm an. Vollkommen durcheinander bin ich, das stelle ich in diesem Moment fest. Der Italienischkurs ist vergessen. Fritz ist ein Meister des Zuhörens, des Mitgefühls und krankheitserprobt. Er bleibt, bis ich ins Bett falle. Zwei Tage warte ich, quäle mich, will meine Zwillingsschwester Ingrid, die in München lebt, nicht beunruhigen. Dann rufe ich an.
Seit sechs Uhr bin ich auf den Beinen und habe fünf Stunden Zugfahrt, unzählige Kaffees, die Süddeutsche Zeitung und hundert Seiten von Feridun Zaimoglus Roman Leyla hinter mir – ich bin eingetaucht in die fremde Welt eines Mädchens aus der türkischen Provinz, in die Familie aus fünf Geschwistern, einer unterdrückten Mutter und einem patriarchalen Vater.
«Hallo, Liebe, wo bist du?», fragt Renate.
«In Saarbrücken», antworte ich, «der ICE ist gerade in den Bahnhof eingefahren. Ich steig in diesem Moment aus.»
«Ich hoffe, es geht dir gut?»
«Ach, ich bin müde, zu wenig geschlafen, und der Geschäftstermin wird vermutlich auch ziemlich anstrengend.»
«Ich muss dir was sagen», beginnt meine Schwester, «vielleicht setzt du dich erst mal irgendwohin.»
«Klar», sage ich und suche den nächsten Stuhl in einem italienischen Café in der Bahnhofshalle. Mein Kollege Matthias gibt mir wilde Zeichen, dass wir uns beeilen müssen, das Taxi wartet, die Damen und Herren von der Zeitung auch. Mit ihnen planen wir eine Kooperation. Ich bin Journalistin für Medizin und arbeite bei einem Gesundheitsportal im Internet.
«Ich habe leider keine guten Nachrichten», setzt sie an, «bei mir besteht der Verdacht auf Brustkrebs.»
«Brustkrebs?», frage ich entsetzt. Tausend Fragezeichen hallen dahinter nach. Ein schreckliches Wort, ein böses Wort mit einer niederschmetternden Gewalt. Es zwingt mich nicht auf den nächsten Stuhl, sondern direkt auf den Bahnhofsboden. Ich fühle mich, als hätte jemand meinen Puls von null auf hundert beschleunigt. Ich kann nicht fassen, was ich da höre, Brustkrebs … Verdacht … bei Renate? Oh nein, denke ich, nicht Renate, das kann einfach nicht sein. Das Wort schleudert mich aus dem Leben, wuchtet sich in meine Welt, die bis eben noch in Ordnung war, bohrt sich in meine grauen Zellen und hakt sich dort fest. Schrecken, Angst, Panik, Ohnmacht, Trauer, Leben – und Tod, das sind die ersten Gedanken, die mir durch den Kopf schießen.
Ich bin gerade mal vierzig, nur zwei Minuten jünger als meine Schwester, als ich aus dem Leben falle. Mitten im Bahnhof sitze ich noch immer auf dem grauen Steinboden. Reisende klettern über meine ausgestreckten Beine. Das Telefon ans Ohr gepresst, versuche ich das Unglaubliche zu verstehen, das ich gerade vernommen habe. Es ist plötzlich kalt geworden.
«Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, du bist kurz vor einem wichtigen Termin», entschuldigt sich Renate.
«Dafür gibt es keinen passenden Moment», antworte ich.
«Am Montag war ich bei der Gynäkologin, dann bei der Mammographie, ich habe einen Knoten getastet.» Das ist nicht ganz die Wahrheit, wie ich ein paar Minuten später erfahre, nicht sie hat den Knoten ertastet, sondern Markus bei der Begegnung in München. «Malignomtypisch», «malignomverdächtig», was für hässliche Worte. «2,4 Zentimeter, rechte Brust», liest sie mir aus dem Mammographiebefund vor und sagt: «Aber ich verstehe auch nicht alles, was da steht, die Bezeichnungen kommen mir wie Hieroglyphen vor. Nächsten Montag ist die Biopsie, dann wird man weitersehen.»
«Renate, das heißt noch gar nichts», beschwichtige ich, aber allein der Verdacht, der reicht mir schon. «Ich werde meine frühere Kollegin Katharina anrufen», schlage ich vor. «Die ist Ärztin. Sie weiß das bestimmt besser.»
«Nein, lass mal, sie kann da vermutlich auch nichts ausrichten», wiegelt Renate ab. «Aber sie versteht vielleicht eher als wir beide, was die Daten zu bedeuten haben», versuche ich sie zu überzeugen.
«Gut, wenn du meinst, dann ruf sie an, vielleicht ist es ja doch keine schlechte Idee», willigt sie schließlich ein.
Mit zittrigen Fingern tippe ich Katharinas Nummer. Sie nimmt ab, Gott sei Dank. Ich brauche nicht viel zu erklären. «Gib mir die Nummer von Renate», meint sie. «In einer halben Stunde rufe ich sie an.» Mehr muss sie nicht sagen, um mich fürs Erste zu beruhigen.
Ich springe mit Matthias ins Taxi und überlege, dass wir Zwillingsschwestern bislang Glück gehabt hatten. Von schweren Krankheiten sind Renate und ich verschont geblieben. Eine Erkältung oder Grippe höchstens, Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, harmlose Blessuren. Immer fühlen wir uns unbeschwert, stark, manchmal übermütig, stets unverletzlich. Renate hat noch kein Krankenhaus von innen gesehen, nur ich besitze keinen Blinddarm mehr; allerdings haben wir beide vor kurzem den gleichen Backenzahn verloren. Wir hätten die Gesundheit unseres Vaters geerbt, sagten andere öfter neidisch. Jetzt ist er vierundsiebzig und noch nie richtig krank gewesen, genau wie unsere gleichaltrige Mutter.
Krebs, das haben andere, konstatiere ich, aber nicht wir. Ich durchforste geistig meine gesamte Verwandtschaft und finde keinen einzigen Krebsfall, Renate wird es ähnlich gemacht haben, vermute ich. Woher soll das also kommen?
Ich denke an ihr Leben in Frankfurt, sie hat es lange Zeit nicht wirklich geliebt, der Job beim Radio, ein einziger Stress in den letzten zwei Jahren. Oft um vier Uhr morgens aufstehen, Frühdienste, Renate ist immer eine Nachteule gewesen, keine Lerche. Genau wie ich. Nie hat sie gelernt, bei dem hohen Arbeitstempo und der extremen Belastung rechtzeitig für sich Grenzen zu ziehen. Oft landete sie am Wochenende vollkommen erledigt in München und brauchte Stunden, um überhaupt geistig bei uns anzukommen. Jürgen, mein langjähriger Lebensgefährte, und ich – wir haben uns die Zähne an ihr ausgebissen: «Renate, so ruinierst du dich seelisch und körperlich, du musst versuchen, schöne Dinge zu tun, Entspannung zu finden, deine Freizeit zu genießen.» Immer wieder haben wir auf sie eingeredet. Aber meine Schwester kann stur sein, wirklich stur. So ein Leben mit viel Hast, Hektik und wenig Gelassenheit kann krank machen, aber gleich Krebs? Ich hätte eher an einen Herzinfarkt oder an ein Burnout gedacht.
Dabei sind mir Krankheiten theoretisch nicht fremd, sie sind mein Job. Ich mache seit fast zehn Jahren nichts anderes, als über Krankheiten zu lesen, zu schreiben, zu diskutieren. Für Reportagen war ich auf einer Kinderkrebsstation, habe junge Frauen mit Essstörungen in einer WG begleitet und viel zu dicken Kindern beim Abnehmen zugesehen. Ich habe erfahren, dass es noch viel jüngere Menschen als Renate gibt, die schlimme Krankheiten treffen – auch Krebs. Aber das hier, das ist etwas anderes. Es geht mich direkt an, sie ist mir nah wie kaum jemand. Wir haben in den letzten vierzig Jahren fast alles miteinander erlebt und geteilt: ein Zehnquadratmeterzimmer, obwohl unsere Mutter uns immer wieder die vielen leerstehenden Räume in unserem Haus anpries, die Schulbank, die Führerscheinprüfung, bestanden am gleichen Tag, das erste Auto mit achtzehn, einen grünen, klapprigen Fiat Mirafiori, ein Studium – sie Biologie, ich Biologie und Chemie. Die Wohngemeinschaft, Urlaube, Freunde, die Gründung einer Kneipe, als wir Studentinnen waren. Unangenehme Dinge hätte ich ihr immer am liebsten vom Hals geschafft. Ihre Katastrophen waren gleichzeitig meine, alles hätte ich für sie gegeben – oft ist das bei Zwillingen so. Ich wäre bei Renate keine Zuschauerin, die mit journalistischer Distanz über ein menschliches Schicksal berichten würde. Es gibt zwar noch keine eindeutige Diagnose, aber meine Schwester überhaupt mit dem Wort «Brustkrebs» in Verbindung zu bringen, das erscheint mir ungeheuerlich. Ich will das nicht! Ich versuche den Überblick zu behalten, das Gefühlschaos in den Griff zu bekommen, mich ruhig zu halten, die Gedanken zu sammeln, die schleichende Angst niederzuringen. Die nächsten Stunden sind ein Albtraum, eine seelische Tortur, ich denke nur an Mammographiebefunde, Krebs, Renate. Während meines Termins bei der Zeitung bin ich geistig kaum anwesend, wie eine Schülerin, die im Unterricht abschweift und nicht aufpasst. Zum Glück übernimmt Matthias, dem ich von ihrem Anruf erzählte, das meiste.
Ich fahre wieder zurück nach München, fünf endlose Stunden, eine gefühlte Ewigkeit. Ich starre vor mich hin, kann nichts lesen und auch nicht mit Matthias sprechen, der mich rührend mit Kaffee und einem aufgeladenen Handy versorgt. Meinem Gerät ist langsam der Saft ausgegangen. Irgendwann meldet sich Katharina.
«Ich habe in der Zwischenzeit mit Renate telefoniert. Der Befund gibt deutliche Hinweise, dass es nichts Gutartiges ist. Die Ärzte haben auf jeden Fall einen begründeten Verdacht», erklärt sie mir vorsichtig.
«Das kann ich nicht glauben», antworte ich, «hoffentlich ist das alles ein riesiger Irrtum. Knoten ja, aber vielleicht ein Fibroadenom, eine Zyste oder was es sonst noch für gutartige Wucherungen in der Brust gibt? Es muss doch nicht gleich bösartig sein.» In den wenigsten Fällen ist das so, vieles stellt sich als falscher Alarm heraus, das weiß ich von meiner medizinischen Lektüre. Renate werde ich davon zunächst nichts erzählen, beschließe ich. Bitte nicht meine Schwester, bitte nicht!, bete ich inständig, ich weiß gar nicht, zu wem.
Aber auszuschließen ist es nicht. Eine von acht Frauen trifft Brustkrebs irgendwann in ihrem Leben. Warum nicht auch sie?
«Ingrid, du musst auch zum Arzt», sagt Katharina zum Schluss. «Nicht sofort, aber beizeiten, also noch in diesem Jahr, denn bei eineiigen Zwillingen hat die Schwester ein mehrfach erhöhtes Risiko.» Von dieser Vorstellung lasse ich sofort die Finger wie von einem kochend heißen Topf. Aber sie bringt mich auf die Idee, dass ich vielleicht keinen Arzt, sondern eher einen fremden Liebhaber brauche. Vielleicht sind sie die besseren Diagnostiker?
Ich rufe Jürgen aus dem Zug an, seit sechzehn Jahren sind wir ein unzertrennliches Paar, wir leben zusammen. Er ist ein kluger, besonnener Typ und nicht beunruhigt, als ich ihm von den Telefonaten mit Renate und Katharina erzähle, jedenfalls sagt er es nicht. «Das wird schon nichts sein, deine Schwester neigt öfter mal zum Pessimismus, wartet doch erst mal ab.» Ich will ihm glauben, sehr gern. Erst später erzählt er mir: «Ich habe gewusst, dass das stimmen könnte. Es klang alles sehr fundiert, was Katharina dir gesagt hat.»
Meine Welt ist nicht mehr heil, sie hat aber keinen Riss bekommen, sondern es hat sich gleich ein riesiger Krater aufgetan. Wieder rufe ich Renate an: «Wer hilft dir jetzt, soll ich vielleicht kommen? Ich könnte unterwegs aus- und umsteigen.» Am liebsten würde ich mich auf der Stelle nach Frankfurt beamen.
«Nein», meint sie, «meine Freunde kümmern sich um mich. Aber es könnte sein, dass ich dich bald brauche. Zur Biopsie, in einer Woche. Es wäre schön, wenn du da bei mir sein könntest.»
Wie ein Geisterfahrer steuere ich durch die Woche bis zum 1. September, ständig habe ich das Gefühl, versehentlich auf der falschen Spur gelandet zu sein. Die anderen schwimmen weiter im Strom, ich weiche aus. «Komm, wir machen einen Ausflug zum Vogelsberg, sehen uns die Dörfer an, kehren irgendwo ein, es gibt auch eine Sommerrodelbahn, da könnten wir hinunterfahren», schlägt mir Achim vor, den ich erst Ende April kennengelernt habe, während der «Langen Nacht der Museen». Ein Unterfranke wie ich, gesegnet mit deftigem Humor, den er seit Jahren als Satirezeichner auslebt. Sympathie von der ersten Sekunde an. Von einem drohenden Brustkrebs lässt er sich nicht abschrecken. «Na ja, meine Nerven sind sowieso schon zerrüttet», entgegne ich auf seinen Rodelbahnvorschlag. «Ich glaube, ich brauche keinen weiteren Kick, schon gar nicht eine steile Abfahrt. Lieber ein langsamer Spaziergang, das entspricht eher meinem inneren Zustand.» Achim ist einverstanden.
Zwei Tage später, am Wochenende, mache ich mich auf nach München. Ich bin Single, jetzt kann ich einfach nicht alleine sein und lasse mich in die Arme meiner Schwester fallen. Sie hat schon ihren Koffer gepackt, eine Woche Urlaub genommen und begleitet mich zurück nach Frankfurt. Es wird eine traurige, nachdenkliche Zugfahrt in die Mainmetropole, der Biopsie entgegen.
Dreizehn Stockwerke türmt sich das Klinikum außerhalb Frankfurts auf, der Himmel darüber ist ein schmaler Spalt. Wie ein gestrandeter Wal liegt es da und schluckt seine Kranken. Willkommen in einem abweisenden Plattenbau, die Fassade anthrazit-weiß gekachelt, Fenster, so weit das Auge reicht, ein Fleckchen sorgsam gestutzter Rasen davor. Zwanzig Abteilungen, mehr als tausend Betten. Hochleistungsbetrieb. Am liebsten würde ich auf dem Absatz kehrtmachen, keinen Fuß in die Drehtür setzen, die grau aussehende Menschen in Bademänteln sanft nach draußen ins Rauchereck schubst. Manche sitzen im Rollstuhl, manche gehen an Schläuchen verkabelt mit einem Infusionsständer umher. Der Glimmstängel dabei als Strohhalm fürs Leben. Doch der Wal atmet uns ein. Ingrid und Fritz begleiten mich zur Biopsie, Station U4 links. Wie man es mir gesagt hatte.
Fritz ist um die fünfzig, ein Mann mit Stil, zurückhaltend, bedächtig. Seit Jahrzehnten arbeitet er als Radiomoderator, er selbst hat schon viele Krankenhäuser von innen gesehen, geplagt von chronischen Erkrankungen. Er vergräbt die Hände im Trenchcoat aus feinstem Zwirn, lugt durch die Hornbrille und geht voran. Die Käsebrote, die mir Ingrid zum Frühstück verordnet hatte, liegen quer im Magen. «Wir brauchen eine Grundlage, die so schwer wiegt, dass sie uns am Boden hält – luftige Erdbeeren bringen uns hier nicht weiter», hatte sie morgens festgestellt. Noch immer kann ja alles gut werden.
Am Eingang der Station hängt ein Schild: «Gynäko-Onkologie, ambulante Chemotherapie, Zutritt auch für Angehörige». Eine Tür aus dickem, undurchsichtigem Glas öffnet sich, das ist die Schwelle zum Reich der Krebskranken, das ich zum ersten Mal betrete. Aus dem Augenwinkel bemerke ich das Chemotherapiezimmer gleich links. Es wimmelt von Frauen mit bunten Kopftüchern und Turbanen, junge, alte, kurzhaarige, kahlköpfige, die sich ebenfalls am Infusionsständer festhalten wie an einem Hirtenstab; manche haben sich bei ihren Männern untergehakt. Erstaunlich fröhlich, plaudernd die einen, mit stumpfem Blick vor sich hin stierend, die Zeichen der Krankheit im Gesicht, die anderen. Vorsichtig luge ich in den Raum, über dessen Tür das furchteinflößende Wort «Chemotherapie» steht. Psychologisch geschickt ist das nicht. Um Gottes willen, hoffentlich lande ich da nicht!, schießt es mir durch den Kopf, und ich befehle meinen Beinen, sie mögen gefälligst Schritte machen.
«Ich habe einen Biopsietermin», presse ich heraus, am Ende des langen Linoleumflurs angekommen, nachdem ich mich durch einen Tunnel voller Leid gearbeitet habe. «Seit einer Woche warte ich darauf, bin mit den Nerven völlig runter.»
«Oh, das tut mir leid, warum haben Sie das nicht bei der Anmeldung gesagt? Wir haben immer Notfalltermine, das geht dann schneller», sagt die Schwester erstaunt.
Ich traue meinen Ohren nicht, stiere sie an, als wäre sie verrückt geworden. Eine Woche elenden Wartens völlig umsonst? War etwa ein Azubi am Telefon? «Aber eine Biopsie ist doch immer dringend», murmle ich ratlos.
Danach bugsiert uns die Schwester ins Wartezimmer, ein Raum, der den Charme eines alten Klassenzimmers versprüht: Holzstühle mit brauner Ledersitzfläche, Zeitschriften, die nicht nach «Lesezirkel» aussehen, nach Bella oder Bunte, ein Tablett mit Tee, Kaffee und einer ganzen Batterie Mineralwasserflaschen.
Eine Ärztin holt Renate ab. Sie geht mit ihr, Fritz und ich bleiben zurück, in der Hand hält meine Schwester die CD mit den Mammographieaufnahmen. Auf dieser silbernen Scheibe kann der Tod eingebrannt sein. Fritz und ich stehen ziellos herum, wir sind uns bislang nur einige Male begegnet. Beide sind wir nervös, reden über Krankheiten, die ihn nicht verschont haben. Offenbar hat er Unterzucker. Oder Angst. Jedenfalls kippt er sich tütchenweise Kristallzucker in den Mund. Ich frage mich ernsthaft, ob Renate in dieser Klinik in guten Händen ist. Gedanklich wandere ich noch einmal zur Anmeldung, die mich an das Arbeitsamt erinnerte: «Patientenaufnahme! Bitte eine Nummer ziehen.» Danach die Cafeteria mit weißen Plastiktischen und hellen Stühlen; sie hatte eher die Ausstrahlung einer Mensa. Weiter zum kleinen Supermarkt, der Zigaretten, Alkohol, Seife, Schokolade und Zeitungen mit den neuesten Schlagzeilen verkaufte, bis zum Schwimmbecken mitten im Gang – Goldfische zogen dort ihre Kreise. «Nicht füttern», stand auf einem Schild am Beckenrand, «das stört das biologische Gleichgewicht.» Das ist doch hier bei allen Menschen aus dem Takt, denke ich. Ich versuche mir vorzustellen, ob Renate sich mit dieser Umgebung anfreunden könnte. Da müsste meine Schwester schon sehr krank sein, ist mein Fazit. Zum Schluss lande ich wieder im Wartezimmer auf Station 4, bei Fritz, und dann wird mir endgültig klar, wo wir sind. Onkologie. Krebsstation. Der Hinweis der Schwester über die Notfalltermine bringt mich weiter ins Grübeln. Eine Kollegin hatte mir vor ein paar Tagen die Telefonnummer ihres Vaters gegeben, der plastischer Chirurg in Frankfurt und Spezialist für Brustrekonstruktionen ist. Von ihm wollte ich wissen, ob die Mammographie am Schillerplatz eine gute Adresse ist, und auch, was er von dieser Klinik hält. «Beides kann ich nur empfehlen», sagte er und fügte noch hinzu: «Brustkrebs ist heute übrigens nicht mehr tödlich, er ist heilbar, wenn er früh entdeckt wird.»
Renate und ich arbeiten zwar beide als Journalistinnen, aber bislang gab es keinen Anlass, sich derart genau über eine Krankheit zu informieren. Langsam beginnt jetzt mein Erwachen. Mit den Heilungschancen von Brustkrebs beschäftige ich mich, wenn er tatsächlich diagnostiziert wird, das hatte ich nach dem Telefonat mit dem Chirurgen beschlossen. Mich interessierte an erster Stelle die Biopsie, wie sie funktioniert und wie zuverlässig das Ergebnis ist. Nur diesen Aspekt recherchierte ich im Internet.
An der Wand entdecke ich ein Regal mit Zeitschriften und Broschüren: «Ihr Perückenladen in der Manhardtstraße … Gesund kochen lernen mit Dieter … Jeden Montagabend Schminkkurs bei Susanne …» Auch das kommt später, entscheide ich. Wenn überhaupt. Aber bei dem freundlich aufgemachten, orange-pinkfarbenen Heft Mamma Mia! bleibt mein Blick haften. Die Zeitschrift kenne ich von meinem Schreibtisch in der Redaktion, es ist das erste und einzige Brustkrebsmagazin in Deutschland. Das Titelbild: eineiige Zwillingsschwestern, beide dunkelblond, schwarze, ausgeschnittene T-Shirts, jünger als wir, eine davon schwanger – beide Frauen sind gleichzeitig an Brustkrebs erkrankt. Wie in einen heftigen Strudel zieht es mich in diesen Artikel hinein. Ich lese: «Wir waren Bettnachbarinnen im Krankenhaus … vermissen heute die gemeinsame Zeit dort … Partnerlook mit Glatze … wurden ständig verwechselt … tiefe Seelenverwandtschaft … gemeinsam ist es leichter …» Ich bin so erschrocken, dass ich Fritz Teile der Geschichte laut vorlese. Es kann auch mich treffen, der Artikel über die Zwillinge macht mir endgültig klar, dass es nicht unmöglich ist. «Leg’s weg!», sagt Fritz streng. Ich stecke das Heft zurück, als wäre es selbst krank.
Dr. Clara de Martinez, eine zierliche Frau mit blonder Hochsteckfrisur und fulminant klingendem Namen, lotst mich um die Ecke ins Untersuchungszimmer, in dem am Rande ein Gynäkologenstuhl wie aus der vorigen Jahrhundertwende steht.
«Bitte machen Sie den Oberkörper frei und legen Sie sich danach hier auf die Liege», fordert sie mich freundlich auf. Sie setzt sich neben mich, taxiert mit ihren Augen behutsam meinen Gemütszustand, schlingt sich die Schnur des Ultraschallgeräts um den Hals und sagt dann: «Ich sehe mir das erst mal an, danach sprechen wir.» Anschließend beginnt die mir schon bekannte Fahrt mit dem Schallkopf durchs holprige Brustgewebe. Ich verstehe ihren Satz als Aufforderung, den Mund zu halten, keine Fragen zu stellen, ihre Konzentration nicht zu stören. Das leuchtet ein. «Vielleicht kann die Ärztin ja auch gleich Entwarnung geben», hatte mir Ingrid vorhin noch mit auf den Weg gegeben.
Lange Minuten verstreichen, während ich versuche, ihr Mienenspiel zu enträtseln: Was sieht sie? Was denkt sie? Dass das Krebs ist? Wieder und wieder umfährt sie den Knoten, bis es fast schmerzt. Sie zögert, kreist ein, druckt Schwarzweißbilder aus wie die, auf denen Schwangere zum ersten Mal ihr Kind sehen. Plötzlich denke ich: Es fühlt sich nicht gut an. Ihr Gesicht verrät nichts, als sie ruhig ankündigt: «Ich mache jetzt eine Biopsie, betäube die Brust lokal, dann werde ich aus der verdächtigen Stelle zwei, drei Proben entnehmen. Das tut nicht weh. Sind Sie bereit?» Na ja, deshalb bin ich doch da, wundere ich mich im Stillen, während ich zugleich nicke. Sie angelt eine lange Nadel herbei, die ich mir lieber nicht so genau ansehe. Kühles Metall setzt an meiner Brust an, dann knallt es wie Pistolenschüsse. Dreimal. «Gut, das reicht», sagt sie.
Mir reicht’s auch, aber gründlich, denke ich, während sie mich mit einem straffen Brustverband einwickelt wie ein Baby. Mein Hals ist zugeschnürt, als ich nach ein paar Sekunden zur entscheidenden Frage ansetze: «Sie haben doch schon viel gesehen, was glauben Sie?» Ihre gletscherblauen Augen fixieren mich einfühlsam, schließlich sagt sie: «Die Chancen stehen 50:50. Es könnte sein, dass Sie sich noch auf einiges einstellen müssen.»
Die Liege unter mir beginnt zu schwanken, mir ist, als würde sie mich gleich abwerfen wie ein alter Gaul seinen Reiter. Übermorgen werde ich sterben, davon bin ich in diesem Moment überzeugt. In Zeitlupe erhebe ich mich, die Hoffnung, mit einer guten Nachricht zu Ingrid und Fritz eilen zu können, ist zusammengeschrumpft auf Staubkorngröße. Lichtjahre entfernt höre ich, wie die Ärztin über das weitere Vorgehen spricht. Die Analyse dauere drei, vier Tage, erklärt sie.
«Ich habe schon so lange auf den Biopsietermin gewartet», entgegne ich verzweifelt. «Viel länger halte ich es nicht mehr aus. Kann der Pathologe nicht schneller arbeiten?»
«Rufen Sie am Mittwoch hier auf der Station an. Dann sehen wir, ob der Befund da ist. Zwei Tage, das wäre jedoch sehr schnell. Es könnte auch bis Freitag dauern», sagt sie. Wie ein angeschossenes Tier schleiche ich mich hinaus.
Renate deutet auf ihren Brustverband, er ist weiß und sitzt straff unter ihrem schwarzen Spitzenhemd. «Es sieht nicht gut aus», wirft sie uns hin und verzieht das Gesicht. «50:50 meint die Ärztin.» Mit dem Rücken meiner ein Meter achtzig postiere ich mich vor dem Zwillingsmagazin im Zeitschriftenregal. Sie soll auf keinen Fall das Titelbild sehen. Meine Schwester erzählt uns, was die Expertin im Einzelnen gesagt hat. Und was nicht. Routiniert kommt mir der ganze Ablauf vor, was manchmal bestimmt nichts Schlechtes ist. Aber nicht jetzt. Renate bemerkt: «Die bringen hier Babys auf die Welt, genauso wie sie dir sagen, dass du bald sterben wirst. Die Ärztin war nett, aber zurückhaltend – keine Emotionen, keine Regungen auf ängstliches Nachfragen.» Es ist ernster, als ich dachte. Ich versuche meine Beklemmung wegzustemmen, aber sie ist mächtig und erdrückend.
Renate und ich hatten immer Ideen für gemeinsame Projekte. Ein Schuhgeschäft oder wie früher nochmal eine Kneipe eröffnen, ein Buch schreiben. Für das Buchvorhaben hatten wir uns schon ein Thema ausgedacht: Wenn ein Zwilling stirbt, wie lebt der andere alleine weiter? Was macht er? Wie fühlt er sich? Zu hart, fanden wir beide damals und ließen den Gedanken fallen. Am Wochenende sagte meine Schwester, das Buch müsse ich jetzt alleine schreiben. Auf diese Bemerkung war ich nicht vorbereitet, dieser Stich traf. Renate und ich sind fast gemeinsam auf die Welt gekommen – es könnte jetzt sein, dass wir nicht zusammen gehen werden. Unvorstellbar. Bislang habe ich immer angenommen, dass wir beide neunzig werden, dass wir die Kneipe mit siebzig und das Buch mit achtzig machen. Und hoffentlich in der gleichen Sekunde sterben. Warum? Ich weiß es nicht, ich bin einfach selbstverständlich davon ausgegangen.
Nur nicht weiter nachdenken. Im Eiltempo stolpern wir zum Ausgang, ich muss hier raus, weg von der Krankheit, weg vom Kranksein, weg von den Weißkitteln. Eine kranke Welt. Draußen scheint die Sonne, ich habe einen riesigen Knoten im Magen. Wir setzen uns auf die Parkbank, versuchen zu verstehen und sortieren, was Renate gerade zu hören bekam. Wir sind geschockt, damit haben wir trotz allem nicht gerechnet. Den Gedanken, dass es zu 50 Prozent kein Krebs und dies eine hohe Chance ist, habe ich, aber er gilt genauso für die schlechten 50 Prozent. Fritz geht die ganze Angelegenheit pragmatisch an, sagt, dass wir im Augenblick nicht mehr wüssten als vorher, es sei nichts entschieden. Beruhigen will er uns, aber faktisch hat er recht. Wir bewegen uns wie drei Greise, so lähmend ist das, was wir gerade erlebt haben. Es ist erst ein Uhr mittags, aber uns fehlt das Ziel für den Tag. Wohin gehen? Wohin fahren? Was tun? Das alte Leben ist weit weg. Wir sind voller Angst und versuchen, irgendeinen Plan aufzustellen. Aber meine Gedanken reisen schon wieder in die Vergangenheit. Am Wochenende hatte mich Renate gefragt: «Willst du mal fühlen?» Ich hatte Angst, das zu tun, ich hatte Angst vor dem, was unter der Haut als Beule tastbar ist.
«Wenn das Krebs ist», stellte ich fest, «dann habe ich das auch.» Das knotige Gewebe in der Brust kenne ich von mir, habe es aber niemals als Gefahr eingestuft, denn es war immer so. «Was glaubst du selbst?», fragte ich weiter.
«Irgendwie denke ich nicht, dass es etwas Bösartiges ist», meinte Renate. «Vielleicht behandlungsbedürftig, ja, vielleicht muss das operiert werden, aber damit hat es sich dann auch.»
Auf unsere Intuition hatten wir immer viel gegeben. Aber diesmal scheint sie versagt zu haben, stelle ich auf der Parkbank vor der Klinik fest.
«Ich fahre euch jetzt nach Hause», sagt Fritz. «Vielleicht wollt ihr beide erst mal alleine reden.»
In der Wohnung meiner Schwester geht die Analyse weiter: Was heißt das nun? Ich habe das Gefühl, dass wir uns stellen müssen. Den Ärzten, dem Krankenhaus, dem Brustverband. All das ist viel zu real, um es zu ignorieren. Dafür braucht es Mut, ihren Mut, meinen Mut, unseren Mut. Wir recherchieren im Internet, welche Arten von Krebszellen es gibt, finden heraus, dass Pathologen die Zellproben der Biopsie aufwendig präparieren und analysieren und wir deshalb auf das Ergebnis mindestens drei Tage warten müssen. Die Unterscheidung von Gut und Böse kann dauern. Ich fasse für mich – und für Renate – einen Entschluss: Wir werden nur noch über die schlechten 50 Prozent nachdenken. Und zwar nicht, weil wir gnadenlose Pessimisten sind. Die guten 50 Prozent, denke ich, die werden wir locker hinnehmen. In diesem Fall werden wir einfach die Sektkorken knallen lassen. In den nächsten Stunden lenke ich also den Blick meiner Schwester auf den schlimmsten Fall. Renate verrät mir: «Ich bin froh, dass du nicht sagst, es wird schon alles gut sein.» Wir versuchen die Angst zu sezieren.
Loreley
Renate und ich entdecken die Langsamkeit, die Stunden kleben auf der Stelle. In der Kunst des Müßiggangs sind wir beide reichlich ungeübt. «Carpe diem