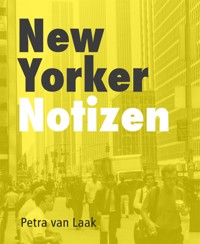4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Würden Sie einen Telefonjob im Drücker-Milieu annehmen, um Ihre vier Kinder durchzubringen? Fänden Sie es lustig, im Garten zu zelten, um den Kleinen Urlaub vorzugaukeln? Was wäre wichtiger: Ihr Cello oder Winterjacken für die Kinder? Eben noch Managergattin mit Villa am See - und im nächsten Moment bricht für Petra van Laak die Existenz zusammen Eben noch wohlhabende Managergattin, muss Petra van Laak nach Firmeninsolvenz und Trennung von ihrem Mann mit vier kleinen Kindern in eine Sozialwohnung ziehen. Wie soll sie den nächsten Einkauf bezahlen, woher Kinderschuhe bekommen? Entschlossen und verzweifelt versucht sie, ihr eigenes Leben mit den Kindern auf die Beine zu stellen. Abenteuerliche Jobangebote, hürdenreiche Wohnungssuche und absurde Begegnungen in Behörden zeigen, wie dünn der Faden ist, an dem das Mittelschichtsleben hängt Mit Schlagfertigkeit und einem großen Sinn für Komik meistert Petra van Laak abenteuerliche Jobangebote, die hürdenreiche Wohnungssuche und absurde Begegnungen in Behörden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Petra van Laak
1 Frau 4 Kinder 0 Euro (fast)
Wie ich es trotzdem geschafft habe
Knaur e-books
Über dieses Buch
Eben noch wohlhabende Unternehmersgattin, muss Petra van Laak nach der Trennung mit vier kleinen Kindern in eine Sozialwohnung ziehen. Wie soll sie den nächsten Einkauf bezahlen, woher Kinderschuhe bekommen? Entschlossen und verzweifelt versucht sie, ihr eigenes Leben mit den Kindern auf die Beine zu stellen. Abenteuerliche Jobangebote, hürdenreiche Wohnungssuche und absurde Begegnungen in Behörden zeigen, wie dünn der Faden ist, an dem das Mittelschichts-Leben hängt.
Inhaltsübersicht
Für meine Kinder
Der Anfang vom Abgrund
Dieselbe Einstellung noch mal. Halten Sie die Kleine etwas höher. Wecken Sie sie noch mal auf.«
Das Fotoshooting im Wohnzimmer dauerte schon über eine Stunde, die vier Kinder waren erschöpft. Ich stupste den Großen in die Seite, jetzt nicht schlappmachen!
Es ging um hundertfünfzig Euro. Das würde reichen, um für den sechsköpfigen Haushalt einzukaufen, einen symbolischen Teil der Stromrechnung zu bezahlen, vielleicht blieb sogar etwas übrig, damit der Telefonanschluss wieder freigeschaltet würde.
Der Fotograf und die Redakteurin von der Zeitschrift nervten, begriffen nicht, dass weder Mutter noch Kinder es darauf angelegt hatten, auf das Cover einer großen, auflagenstarken Frauenzeitschrift zu kommen. Mir ging es nur ums Geld. Das allerdings war für Außenstehende nicht erkennbar. Hinter den Fenstern unseres Jugendstilhauses gähnten finanzielle und menschliche Abgründe.
Mein Mann André hatte Geschäftsinsolvenz anmelden müssen und zog es nun vor, irgendwelche Geschäfte im virtuellen Raum zu machen. Die Maklerquallen waberten bereits um die Villa am See und fotografierten frech Fassade und Grundstück, obwohl das Haus noch nicht zum Verkauf, geschweige denn im Register der Zwangsversteigerungen stand (eine undichte Stelle bei der Bank). Aufgebrachte Gläubiger terrorisierten uns am Telefon, jemand legte uns gar ein blutiges Beil vor die Haustür. Ich fühlte mich von meinem Mann unendlich alleingelassen. Ich konnte machen, was ich wollte – ich schien ihn nicht mehr erreichen zu können.
Es dauerte nicht lange, und André und ich waren getrennte Leute. Die Kinder waren zu dem Zeitpunkt zwischen drei und neun Jahre alt, ich stürzte ins Bodenlose.
Ich hatte nun alleine vier kleine Kinder durchzubringen. Ohne feste Stelle, ohne Rücklagen. Das älteste Kind aus meiner vorherigen Beziehung bekam regelmäßig Kindesunterhalt von seinem Vater. Die Unterhaltszahlungen von André für unsere drei gemeinsamen Kinder blieben jedoch vorerst aus – André hatte genug mit seinen Schulden zu tun.
In einer solchen Situation hat man drei Möglichkeiten. Erstens: wegrennen. Zweitens: verrückt werden. Drittens: es durchstehen.
Für die Option Nummer drei muss man kämpfen können. Und sehr einfallsreich sein. Das bezahlte Fotoshooting der Zeitschrift war nur der Anfang. Das Honorar von hundertfünfzig Euro habe ich übrigens nie bekommen, trotz der vielen Bitt- und Betteltelefonate mit der Redaktion. Anfangs hatte ich mich für den Verkauf meines Privatlebens an die Illustrierte geschämt. Jetzt, wo das kümmerliche, für mich jedoch unentbehrliche Honorar unbeachtet aller freundlichen und unfreundlicheren Nachfragen einfach ausblieb, fing ich an, mich fremdzuschämen – dazu sollte ich noch oft Gelegenheit bekommen.
Mama, warum sind die Bilder alle weg?
Wir brauchen die nicht mehr.
Kriegen wir neue?
Irgendwann, ja.
Ich mag das nicht. Überall sind leere Vierecke an den Wänden.
Wunschkandidatin
Wenn man verzweifelt versucht, das Leben, die Finanzen, eine Arbeit in den Griff zu kriegen, ist man leichte Beute für skrupellose Menschen. Mit feinen Antennen spüren sie die Hilflosigkeit beim anderen und suchen auf ausgesprochen freundliche Weise die Nähe zu denen, die unter erheblichem Druck stehen.
Ich bekam einen Anruf von einem Herrn, der mich mit »Guten Abend, Frau van Laak, wie schön, dass ich Sie gleich am Telefon habe« begrüßte. Wie schön, dass er mich überhaupt erreichte, denn drei Wochen später waren auch eingehende Anrufe über unseren Telefonanschluss nicht mehr möglich.
Der Mann stellte sich als Abteilungsleiter eines großen Versicherungsunternehmens vor. Die Stimme klang zugewandt und vernünftig, in wenigen Sätzen hatte er mir erklärt, dass sein Unternehmen mich im Rahmen der Personalentwicklungsoffensive gezielt anspreche. In ihren Augen sei ich eine geeignete Kandidatin, komplexe, erklärungsbedürftige Versicherungsprodukte an bestehende Kunden, vor allem junge Familien, zu verkaufen. Die Provisionen seien erfolgsabhängig und würden sehr hoch ausfallen. Ob wir uns einmal kennenlernen wollten?
»Woher haben Sie denn meinen Namen und meine Nummer?«
»Frau van Laak, das darf ich Ihnen noch nicht sagen, es handelt sich um eine Empfehlung.«
»Wer hat mich denn empfohlen?«
»Frau van Laak, bitte haben Sie Verständnis, die Person wollte nicht genannt werden, war sich aber sicher, dass Sie genau in unser Anforderungsprofil passen und unserem guten Angebot gegenüber aufgeschlossen seien.«
Wer wusste von unseren Verwicklungen? Wir versuchten alles, um die brüchige Wahnsinnswelt, in der wir uns zappelnd bewegten, vor allen anderen zu verheimlichen.
Das war kein blinder Aktionismus, der meinen aktuellen Alltag prägte, sondern pure Überlebensstrategie. Wäre ich zuvor im Denken und Handeln selbständiger gewesen, hätte ich die monetäre und persönliche Pleite erstens eher kommen sehen und daher bessere Vorkehrungen treffen können und zweitens mit größerer Entschiedenheit das Schlimmste von den Kindern und mir abgewendet. Hätte, hätte, hätte – den Konjunktiv gewöhnte ich mir schnell ab.
Mit kühlem Kopf und flatterndem Herzen leitete ich sofort das Nötigste in die Wege: Wechsel der Krankenkasse, Anträge auf Ermäßigung beim Kindergarten und der Schule. Bitten um Aufschub bei der Begleichung von Telefon-, Gas-, Wasser-, Stromrechnungen. Kündigen sämtlicher Abonnements, sogar Abmeldung der Papier- und Wertstofftonne. Musikschule, Sportverein, Kinderballett, Malkurs – alles musste abgestellt werden. Die wöchentliche Lieferkiste mit Bio-Gemüse und Frischmilch? Weg damit. Einkaufen bei Kaisers? Die nächsten fünf Jahre sollte ich keinen Fuß mehr in diesen Supermarkt setzen. Aldi war angesagt, und dort konnte ich auch nur das Nötigste einkaufen. Die nächsten Friseurtermine? Konnte ich knicken. (Ich wurde dann halt Haar-Modell für die Azubis, um kein Geld fürs Haareschneiden mehr ausgeben zu müssen. Allerdings fielen mir nach einigen Monaten vor lauter Stress die Haare in Büscheln aus, so dass ich als Übungsobjekt nicht mehr in Frage kam. Die neue Friseurin, zu der ich später ging, fragte mich bei meinem ersten Besuch teilnahmsvoll, ob ich die Chemo gut vertragen hätte.)
Wie kam der Herr am Telefon nun gerade auf mich? Hatte da jemand, der von meiner misslichen Lage etwas mitbekommen hatte, dem Unternehmen einen Tipp gegeben? Das wäre ja nett, aber warum gab dieser Jemand seinen Namen nicht preis?
Während ich noch zwischen Misstrauen und Freude über die Empfehlung schwankte, sortierte ich schnell die in Frage kommenden Personen im Kopf. Aus dem Kontext der Schule? Nein, dort waren alle peinlich berührt vom Lauf der Dinge. Gemeinde? Niemand wusste es, vielleicht ahnte die Gemeindereferentin etwas; die hatte zwar einen guten Draht zum lieben Gott, ganz bestimmt jedoch nicht zur Versicherungswirtschaft. Eine Freundin? Hätte sie mir gesagt. Wollte einfach jemand, dass ich endlich den Sprung zurück ins Berufsleben schaffte?
Als junge Studienabsolventin war ich nach nur zwei Jahren Vollzeit-Berufsleben bereits Mutter geworden. Mein Ansatz zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie war damals sehr pragmatisch: Baby in die Krippe und weiterarbeiten. Schon in weniger als zwei Jahren war das zweite Kind da. Ich fand eine patente Tagesmutter, die beide Kinder betreute. Dann kündigte sich das dritte Kind an, es wurde langsam eng. Ich reduzierte auf eine Zweidrittelstelle, hatte jedoch nicht mit einem Säugling gerechnet, der viel schrie und ständig krank war.
Mit drei kleinen Kindern und sporadischem Arbeiten auf Stundenbasis vollzog sich ein schleichender Wandel von der gut ausgebildeten, praxisorientierten Geisteswissenschaftlerin hin zu einer jungen Mutter, die von ihrer Umgebung, ihrem Mann und von sich selbst (!) immer mehr auf Kinder, Küche, Kirche reduziert wurde. Meine Mutter, die selbst immer für ihre berufliche Eigenständigkeit in ihrer Ehe gekämpft hatte, bezeichnete all dies treffend als »Frauenfalle«. Als das vierte Kind auf die Welt kam, war ich komplett weggeschlossen, und im Rückblick weiß ich: Ich fühlte mich unendlich einsam. Wenn ich herauskam, dann als Begleitung des Ehemannes. Meine Fähigkeiten lagen völlig brach – mal von meinem von den Frauen mütterlicherseits an mich weitergegebenen Talent, Kinder zu erziehen, abgesehen.
Wenn ich mich auf Ausstellungseröffnungen, Einweihungen oder Botschafter-Dinners in Diskussionen einbringen wollte, hörte mir niemand richtig zu. Stumm beobachtete ich das Aufplustern und Angeben der Männer rings um mich herum, und machte ich einmal eine scharfe treffende Bemerkung, schien sie niemand wahrzunehmen. Mir war eine bestimmte Rolle zugedacht, und nach einigen erfolglosen Anläufen, andere Facetten meiner Person zu leben, wagte ich es schließlich nicht mehr, über den sorgfältig um mich herum gebauten – zweifelsohne hübschen und soliden – Zaun zu klettern.
Und nun dieser Anruf, der mir, nur mir galt. Weil ich die Wunschkandidatin des Unternehmens sei. Kein Wunder, dass ich mich von dem Anrufer, der mich angeblich gezielt meiner Fähigkeiten wegen ausgesucht hatte, geschmeichelt fühlte. Meine Sehnsucht, mich endlich ungebremst entfalten zu können, war riesig – die perfekte Antriebsfeder in einer fast ausweglosen, chaotischen Situation kurz vor der Zwangsräumung der Villa. Andere wären an meiner Stelle vielleicht einfach nur zusammengebrochen.
»Frau van Laak, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kommen in unser Berliner Büro, und wir besprechen alles Weitere. Dann kann ich Ihnen auch den Namen der Person sagen, die Sie uns wärmstens empfohlen hat.«
Das klang sehr vernünftig, fand ich. Die Aussicht auf einen gutbezahlten Job war wunderbar. Nun musste ich nur noch genauer wissen, um was für ein Versicherungsunternehmen es sich handelte. Der Anrufer reagierte etwas ausweichend, nannte dann schließlich nach meinem mehrmaligen Nachfragen den Namen des Mutterkonzerns – es handelte sich um eine traditionsreiche, große, deutsche Lebensversicherung. Gut, ich war beruhigt. Die kannte ich, Reklame aus der Kindheit blitzte in meinem Gedächtnis auf, ich freute mich auf den Termin.
Zwei Tage später stand ich an einem Vormittag – die Kinder wusste ich gut in Kindergarten und Schule versorgt – vor einem achtstöckigen Bürogebäude in der Kurfürstenstraße. Draußen fanden sich keine Schilder, ich ging erst einmal hinein in das kleine Foyer. Grauer glänzender Marmor, seltsam anonym, ein überdimensionierter Handlauf aus poliertem Metall. Auf dem Firmenwegweiser aus Plexiglas gab es viele Lücken, ganz oben stand der Name des Versicherungsunternehmens und daneben drei große Buchstaben. Über dem letzten Buchstaben schwebte eine glänzende goldene Kugel. Ein Zettel flatterte an der Wand neben dem Aufzug: »Bewerber bitte im 7. OG melden«. Der Lift schoss mit mir hinauf und entließ mich in einen dunklen, kleinen Vorraum. Zwei Meter weiter befand sich eine Glastür, rechts davon eine Klingel. Durch die Scheiben sah ich einen großen Flur, durch den ständig schwarze und graue junge Anzugmänner huschten. Die Anzüge wirkten vollkommen identisch auf mich, handelte es sich um Arbeitsuniformen? Der graue Nadelfilz dämpfte das energische Klack-Klack der schwarzen Schuhe, die geschickt mehrere kleine Vitrinen auf hüfthohen Sockeln umschifften. Die Vitrinen waren wie Kundenstopper an allen möglichen Stellen im Flur aufgestellt. Nirgends sah ich eine Frau.
Ich klingelte. Keiner der Anzugmänner schaute auf, stattdessen bog aus einer offenen Bürotür links ein weiterer Anzugmensch hervor. Er war etwa Mitte fünfzig und machte sich schnell seinen Sakko-Knopf zu, bevor er mir die Tür öffnete. Er strahlte mich an, die Jacke spannte heftig über seinem Bauch.
»Frau van Laak, wie schön, dass Sie zu uns gefunden haben! Schuster mein Name, kommen Sie, kommen Sie, wir gehen gleich hier hinein. Herr Franken kommt auch gleich. Kaffee? Weiß oder schwarz?«
Ich folgte dem kleinen rundlichen Mann die wenigen Meter in das Büro. 08/15-Einrichtung, Kalender an der Wand, keine Grünpflanzen, spartanisch und praktisch eingerichtet. In der Ecke stand ein verschließbarer Aktenschrank. Auf der grauen Schreibtischfläche stand ein goldfarbenes Modellauto, ein Mercedes Cabriolet, so viel konnte ich erkennen.
Ich nahm Platz und bekam einen lauwarmen Kaffee in einem braunen Plastikbecher, der sofort einknickte, als ich ihn in die Hand nahm. Vorsichtig stellte ich ihn wieder ab. Herr Schuster saß mir gegenüber und wirkte fahrig auf mich, seine kleinen Augen purzelten hinter den ungeputzten Brillengläsern herum, er wollte mit dem Gespräch offenbar nicht anfangen, bevor nicht auch Herr Franken zugegen war. Ich bemerkte an Herrn Schusters Anzug ein kleines Abzeichen, das ich aber nicht genauer identifizieren konnte.
Herr Franken stieß kurz darauf zu uns, offensichtlich gehörte er zur höheren Leitungsebene, denn Herr Schuster sprang zackig auf, justierte seinen Anzugknopf und schaute dann in meine Richtung. »Darf ich vorstellen, Frau van Laak, Herr Franken.« Herr Franken war ein hoch aufgeschossener Typ, graue Haare, Einheitsanzug, auch er mit einem Abzeichen, dieses sah allerdings etwas anders aus als das von Herrn Schuster. Herr Franken begegnete mir mit kühler Zurückhaltung. Auf mich machte er einen sehr professionellen Eindruck. Er ließ mich nicht aus den Augen, während Herr Schuster, unsicher, das Gespräch mit mir führte. Ich hatte zwischenzeitlich die Empfindung, als sei die Szene eher eine Bewerbungssituation für Herrn Schuster als für mich. Er stand unter einem ungeheuren Druck. Er fing sogleich an, mir Fragen zu stellen. Was ich bisher gearbeitet habe, ob ich Englisch könne, ob ich mich für gute Produkte interessieren würde (was für eine Frage!), ob mir der Kontakt zu Menschen wichtig sei usw. Ich fing an, mich zu langweilen, und stellte nun selbst Fragen an ihn, dabei schaute ich auch Herrn Franken an.
»Um was für ein Unternehmen handelt es sich eigentlich? Was bedeuten die drei Buchstaben?«
Herr Schuster vergewisserte sich mit einem Seitenblick bei seinem Vorgesetzten. »Das ist eine Abkürzung. Wir sind ein Vertriebsunternehmen und auf besondere Versicherungen spezialisiert. Wir arbeiten nur mit ausgesuchten, fähigen Leuten zusammen. Deshalb haben wir Sie eingeladen.«
»Um welche Arbeit geht es denn genau?«
Jetzt war Schuster richtig in seinem Element. Er erklärte in blumigen Worten die Tätigkeit des Verkaufens von Versicherungen, beschrieb die Freude in den leuchtenden Augen von Hausbesitzern, wenn sie ein Rundum-sorglos-Paket abgeschlossen haben, erzählte von den einmaligen Produkten und von den großen Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten.
»Kommen Sie, ich zeige Ihnen mal was.« Er sprang auf – kurzer Blick auf Herrn Franken, der nur kurz nickte – und zog mich am Ellbogen in den großen Flur. Genau so zogen mich meine Söhne immer in Richtung eines Vorgartens in der Nachbarschaft, in dem eine kleine Eisenbahn herumzuckelte. Herr Schuster und ich machten halt an der ersten Vitrinensäule. Auf schwarzem Samt lag dort eine silberne Angeber-Uhr. »Haben wir natürlich auch in der Damenausführung.« Nächste Vitrine. Wieder eine protzige Uhr, dieses Mal in Gold. »Raten Sie mal, was die wert ist.« Ich war wie gelähmt von so viel Hässlichkeit, die sich an einer einzigen Uhr verdichten kann, dass ich vorsichtshalber stumm blieb. Schuster mit glucksender Stimme: »Zweitausendvierhundert. Euro, nicht Lire, haha!« Nächste Vitrine. Schwarzer Samt, unterschiedliche Abzeichen zum Anstecken. Jetzt konnte ich auf einigen das winzige Logo erkennen. Auch ein Jaguar-Anstecker war dabei. Und silberne, goldene, mit verschiedenen Streifen, von eins bis sechs durchnumeriert. Herr Schuster senkte feierlich seine Stimme. »Frau van Laak, hier sehen Sie, was Sie bei uns alles erreichen können. Hier, beim ersten Grad, sind Sie Repräsentant, anderthalb Prozent Provision. Nach zehn erfolgreichen Fällen kommen Sie weiter. Das setzt sich so fort bis hin zum Direktionsrepräsentanten.« Er flüsterte jetzt nur noch. »Herr Franken, Sie wissen schon. Jahresgehalt um die fünfhunderttausend.« Dann winkte er mich weiter und lachte fröhlich. »Schauen Sie mal, hier. Raten Sie mal, was der wert ist.« Auf – richtig: schwarzem – Samt ein Modellauto. Mercedes Cabriolet. In Silber. »Ist ein Sondermodell. Zweihundertzehn Euro. Toll, was? Aber es geht noch höher. Sehen Sie nachher in meinem Büro.« Ich wollte ihm eine Freude machen und fragte mit großen Augen: »Herr Schuster, aber doch wohl nicht der goldene …?« Herr Schuster freute sich doller, als ich befürchtet hatte. Er zog mich wieder in das Büro zurück, kurzer Blick auf den steif dasitzenden Herrn Franken, dann holte er ein Vertragspapier hervor, ich sollte mich setzen und meine Unterschrift unter den Beginn einer erfolgreichen Zusammenarbeit setzen. Ich musste ein wenig lachen, er sei ja wirklich sehr begeistert, aber ich müsse den Vertrag erst zu Hause in Ruhe durchlesen. Jetzt meldete sich Franken zu Wort, tonlose Stimme, keine Mimik.
»Frau van Laak, wir haben den Vertrag für Sie vorbereitet, weil wir Sie für äußerst fähig halten. Sie verstehen, dass wir dieses Vertragswerk nicht aus dem Haus geben.«
»Nein, ich verstehe nicht.«
Frankens Augenbraue wanderte leicht nach oben. Überlegte er jetzt, ob es ein Fehler gewesen war, mich einzuladen? Stöberte er in seinem Gedächtnis nach einer Gesprächsführungsmethode, um mich in den Griff zu bekommen? Mein innerer Widerstand wuchs, der Versteinerungsgrad seiner Mimik auch.
»Frau van Laak, wir geben Ihnen jetzt ein wenig Zeit, alles zu überdenken. Wir kommen in zehn Minuten wieder.« Herr Franken stand auf und machte Herrn Schuster ein Zeichen mitzukommen.
»Moment, Herr Franken. Ich möchte bitte wissen, wer Ihnen meinen Namen und meine Telefonnummer gegeben hat.«
Franken hielt inne, jetzt mit einem verärgerten Gesichtsausdruck. »Ja, Herr Schuster, haben Sie das denn nicht geklärt?« Herr Schuster wand sich verlegen. Franken verließ das Zimmer, ohne mich noch ein weiteres Mal anzugucken, der Anzugrücken verschwand durch den Türrahmen, ich hörte noch ein gemurmeltes »Hat mich gefreut.«
Ich schaute Herrn Schuster fragend an.
»Äh, Frau van Laak, es ist nun einmal so. Ich kann Ihnen das wirklich erst sagen, wenn Sie unterschrieben haben. Das ist leider so.«
Ich verstand nicht.
»Ja, ähm, das ist eben eine besondere Empfehlung. Jetzt setzen wir uns erst einmal hin, und wir gehen den Vertrag in Ruhe gemeinsam durch. Sie werden sehen, was wir hier für ein netter Verein sind. Kaffee? Schwarz? Weiß?«
Plötzlich wollte ich nur schnell weg, nahm meine Tasche, verzichtete aufs Händeschütteln und verließ schnurstracks die Nadelfilz-Büroetage. Herr Schuster machte sich keine Mühe, mich zurückzuhalten. Seine Schultern hingen herunter, das Jackett schlug eine Beule oberhalb des Bauches, der Anstecker verschwand in einer Anzugfalte.
Draußen schnappte ich nach Luft und drehte mich noch einmal um. Die drei Lettern prangten auf dem Schild, die Glastür warf die goldene Kugel noch einmal verspiegelt durch die Scheibe zurück. Und dann fiel mir ein, dass ich das Signet aus einem anderen Zusammenhang kannte. Um die Bronchitis-Anfälle meines jüngsten Sohnes zu lindern, war ich häufig an der Nordsee in einer Ferienwohnung gewesen. Gegenüber von dem alten Haus, in dem sich die Wohnung befand, erstreckte sich ein langer Flachbau. Dort konnten die Kinder und ich vom Küchenfenster aus beobachten, wie dort ständig graue junge Anzugmenschen ein und aus gingen. Sie kamen in schwarzen Autos, klein, mittel, groß, hielten lange Versammlungen ab, wirkten stets gehetzt und müde, nahmen nichts um sich herum wahr. Am Eingang ein großes Schild mit den besagten drei Buchstaben und der goldenen Kugel. Ich hatte es nach zwei Wochen Beobachtung schließlich für eine Art Sekte gehalten.
»Mama, die Männer in dem Haus da unten sind alle komisch. Die laufen wie das Blechmännchen von Jonas, das man hinten mit dem Schlüssel aufziehen kann. – Was heißen die Buchstaben eigentlich?«, wollte Frieda wissen.
»Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall verstehe ich nicht, wie man in so einen Laden freiwillig reingehen kann.«
Damals wusste ich noch nicht, dass mich genau drei Jahre später der Zusammenbruch meiner friedlichen Mittelstandsexistenz freiwillig-unfreiwillig in ebendiesen Laden hineintreiben würde. Meinem Instinkt ist es zu verdanken, dass ich innerhalb einer Stunde wieder herausfand.
»Mama, hast du jetzt eine gute Arbeit gekriegt?«, fragte mich Jonas, der Älteste, nach der Schule.
»Nein, mit den Leuten dort stimmte was nicht. Da bin ich wieder gegangen.«
»Und was machen wir jetzt?! Du musst doch Geld verdienen.«
»Ich versuche es weiter, Jonas, beim nächsten Mal klappt es bestimmt.«
Wenn mir eines wichtig war, dann das: Die Kinder sollten sich nicht sorgen. Soweit und solange es ging, wollte ich sie vor den Konsequenzen unserer Krise schützen. Damit meine ich nicht den Verzicht auf Annehmlichkeiten – das hatte ich den Kindern schnell erklärt. Wenn plötzlich wenig Geld vorhanden ist, bedeutet das, dass man sich nicht so viel leisten kann wie vorher. Aber man sieht zu, dass man es sich trotzdem schön macht.
Nein, das war nicht unser Problem. Ich wollte Jonas (neun), Frieda (sieben), Till (fünf) und Millie (drei) die verstörenden Erlebnisse ersparen, die ich mit Banken, Gläubigern, Ämtern, Rechtsanwälten, halbseidenen Arbeitgebern und mit meinem Ehemann André hatte. Jeder unbeschwert erlebte Tag im Kinderleben zählt. Meinen Kummer, meine Ängste, meine Verzweiflung – das versuchte ich vor ihnen sorgfältig zu verbergen. Ich machte gute Miene zum bösen Spiel. Jedoch zu lange.
Mama, wir verdienen jetzt Geld dazu, dann können wir öfter Eis kaufen.
Okay, Millie. Wie wollt ihr das anstellen?
Frau Nemmes hat gesagt, ich habe eine schöne Stimme. Jonas kann Gitarre spielen. Wir gehen am Samstag in die Fußgängerzone und stellen meinen roten Sonnenhut auf den Boden. Jonas sagt, wenn es nicht so doll klingt, ist es egal, weil ich noch so klein und niedlich bin.
Kirchentag feeds family
Manchmal sind es die ganz kleinen Dinge, die weiterhelfen.
Die Gemeindereferentin Schwester Felicitas kannte mich als gutsituierte Ehefrau und Mutter, die sich in der Pfarrei für die Kommunionkinder engagierte. Als die Firmeninsolvenzen über uns hereinbrachen, zog ich mich für einige Monate aus dem Gemeindeleben zurück. Zu viele Dinge, die geregelt werden mussten. Dann kam die Räumungsklage. Die Villa sollte zwangsversteigert werden. Es folgte die Aufforderung der zuständigen »Fachstelle für Wohnungslose und Wohnraumsicherung«, mich bei ihnen zu melden, damit mir mit den Kindern eine Bleibe zugewiesen werden könne. Ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf stand.
Schwester Felicitas, Mitte fünfzig, eine gestandene Ordensfrau in Zivil, nahm mich eines Tages nach dem Gottesdienst beiseite und fragte mich im Pfarrsekretariat, was mit mir los sei. Das Gespräch dauerte etwas länger, sie nickte ernst und verzog weiter keine Miene. Ich erzählte vom abgestellten Gas, von der bevorstehenden Zwangsversteigerung, von den letzten Cents, die wir zusammenkratzten, von meinem Gefühl, vor einem Abgrund zu stehen. Schwester Felicitas blieb sehr ruhig, wir schauten beide für eine Weile schweigend aus dem Fenster, draußen im Pfarrgarten spielten die Kinder Fangen, Frieda juchzte auf der Schaukel, und Millie pflückte die reifen Brombeeren von den Sträuchern, eine Art Ersatzhandlung der Jüngsten für das Vernaschen von Süßigkeiten, die nun ebenfalls nicht mehr auf unserem Einkaufszettel zu finden waren. Ich heulte was das Zeug hielt, Schwester Felicitas tätschelte meine Hand.
Als Gemeindeschwester sieht man sicherlich viel Leid, ich war nun eins von etlichen Schäfchen, das es zwar zu trösten galt, aber das seinen Weg schon machen würde. So dachte ich.
Zwei Tage später bekam ich an einem sonnigen Morgen einen Anruf. »Frau van La-haak«, raunte die Stimme ins Telefon, »ich hab hier was für Sie. Bringen Sie eine unauffällige, große Tasche mit, vielleicht eine Sporttasche, und kommen Sie schnell ins Gemeindezentrum.« Die verschwörerische Stimme von Schwester Felicitas machte aus mir ein fügsames Lämmchen. In der Tür des Gemeindezentrums stand sie da, die Hände in die Hüften gestemmt, und winkte mich mit ihren großen Händen hinein. Mir fiel auf, dass ihre kurzgeschnittenen, silbergrauen Haare perfekt zu ihrem türkisfarbenen Rock passten. Die weiße Bluse war mit einem grünlichen Faden durchwirkt – von ihrem Outfit konnte sich manche Kirchenchor-Sängerin eine dicke Scheibe abschneiden. (Schwester Felicitas war damals eine der ersten Ordensschwestern gewesen, die im Alltag den Habit abgelegt hatten, als dieser nur noch für gottesdienstliche Anlässe zwingend vorgeschrieben war.)
»Schnell, schnell, gleich ist Senioren-Kaffeekranz, bis dahin müssen wir fertig sein.« Sie ging eilig voran zur großen Küche, riss die zwei riesigen Kühlschränke auf und schaute mich an, ihre kräftigen Augenbrauen hochgezogen zu zwei silbernen Triumphbogen. Die Schränke waren bis oben hin voll mit Lebensmitteln. Käse, Wurst, Brote, Gemüse, Obst, sogar einige Packungen Schokoküsse waren dabei. »Alles vom Kirchentag übrig geblieben. Unsere Gästegruppe aus Bayern ist vor zwei Stunden abgereist. Das Ganze soll eigentlich laut Beschluss des Vorstands auf unsere Kitas und Schulküchen verteilt werden – aber noch weiß ja keiner davon, dass so viel übrig ist«, erklärte sie listig. »Na, was ist, rin in die Tasche damit! Da können Sie doch ne Weile von futtern!« Ich war perplex. Dies war die erste wirklich lebenspraktische Lösung, die ich in meiner absurden Zwangslage angeboten bekam.
Gemeinsam stopften wir die Lebensmittel in die Tasche, die sich schnell als viel zu klein erwies. Schwester Felicitas warf immer wieder einen nervösen Blick Richtung Eingangstür, einmal schlurfte eine ältere Frau vorbei, und Schwester Felicitas verfiel mir gegenüber in einen geschäftigen Ton: »Dann bringen Sie das hier zur Kita Waldkinder, dieses Obst hier geht an das Seniorenwohnheim und … ist sie weg?!«
Der erste Kühlschrank war bereits leer geräumt. Jetzt musste eine zweite Tasche her. Schwester Felicitas riss alle Schränke auf, wühlte sich durch Müllbeutel und Plastiktüten, knallte mit dem Fuß die eine Schranktür zu, um simultan bereits die nächste aufzureißen und halb darin zu verschwinden.
»Hm. Warten Sie mal. Ich hab da eine Idee-he. Sie bleiben hier und passen auf.« Sie verschwand in einem der dunklen Gänge des Gemeindezentrums, dabei machte sie kein Licht. Von meinem Horchposten aus konnte ich sehen, dass sie mehrere Schlüssel zu einer kleinen Tür ausprobierte, bis diese mit einem kleinen Quietscher aufsprang. Schwester Felicitas wühlte wieder, roter Stoff fiel heraus und legte sich auf ihre Pumps. Etwas Watteweißes segelte aus dem Kämmerchen heraus und verhakte sich in ihrer Uhr. Ungeduldig schüttelte sie es ab. Jetzt kam noch ein großer, goldener Stab mit gebogener Spitze zum Vorschein, sie hantierte hektisch damit herum und lehnte ihn schließlich gegen die benachbarte Türzarge. Natürlich fiel er mit einem hellen Klappern sogleich um, ein Stück goldene Farbe sprang ab und hüpfte in den Stoffberg hinein, der zu ihren Füßen lag. Missmutig horchte sie auf, kroch dann fast in den Wandschrank hinein, grunzte zufrieden und zog mit einer ruckartigen Bewegung ein großes, braunes Textilstück heraus. Sie stopfte schnell all die anderen Gegenstände wieder in den Wandschrank und schleuderte das Stoffstück mit einer sportlich-übermütigen Armbewegung in meine Richtung. »Will ich aber wiederhaben«, rief sie mir leise zu. Ich fing das Ungetüm auf, es war der große Jutesack von der letzten Nikolausfeier.
Nachbarn, die gut auf ihre Umgebung aufpassen, gibt es überall. Besonders eifrig sind diejenigen, die gegenüber vom Gemeindezentrum wohnen. Wir wären weit weniger auffällig gewesen, wenn Schwester Felicitas sich nicht ständig umgeschaut hätte. Wenn sie laut und deutlich mit mir gesprochen hätte, statt mir aus dem Mundwinkel undeutliche Befehle zuzuzischen. Wenn wir mit Sack und Tasche aufrecht gegangen wären, statt gebückt damit über die Straße zu ihrem Auto zu huschen. Für die Hausbewohner gegenüber waren wir eine leichte Beute. Frau Mendes, Pfarrgemeinderatsmitglied, kam aus ihrem Garten geschossen – das Tempo war beachtlich, trotz der dicken Gartenclogs, die bestimmt zwei Nummern zu groß waren und aus denen ihre Fersen immer wieder herausschlappten. Sie fragte uns mit ihrem charmantesten katholischen Lächeln, ob wir einen guten Tag hätten und die Sonne ebenso genießen würden wie sie. O ja, vielen Dank, alles schön. Jetzt müssen wir aber weiter. – Was haben Sie denn da Schweres zu transportieren? Kann ich helfen? – O nein, danke, wir kommen schon klar. – Sie fahren sicher jetzt zur Waldschule, die Reste vom Kirchentag verteilen? – Schwester Felicitas holte tief Luft, richtete sich auf, fixierte die engagierte Dame mit einem ernsten Blick und sagte entschieden: »Diese Gruppe aus Bayern hat nichts, aber auch gar nichts übrig gelassen, außer jeder Menge Müll und verschimmeltem Brot. Und wir müssen den Mist jetzt entsorgen. Wo ich doch so schlecht was wegschmeißen kann. Hier, wollen Sie mal riechen?« Und sie hielt den Nikolaussack Richtung Gartenzaun. Frau Mendes holperte einen Schritt zurück, traf einen Maulwurfshügel, geriet ein wenig ins Trudeln, fing sich wieder und wünschte uns noch viel Erfolg bei der Arbeit.
Schwester Felicitas brachte die Fracht und mich in ihrem Auto nach Hause. »Dumme Pute«, murmelte sie beim Losfahren. Wüsste man es nicht, dann käme man nicht wirklich auf den Gedanken, neben einer Ordensoberin zu sitzen.
Wir saßen eine Weile schweigend nebeneinander. Unter meinen Füßen war ein kleines Loch im Bodenblech, ich konnte von meinem Beifahrersitz direkt hinunter auf die Straße sehen, wo der Asphalt wie ein langes, graues Gummiband unter mir durchzischte. Schwester Felicitas schaute unverwandt auf den Straßenverkehr.
»Ist vom letzten Winter, als ich mit den Sternsingern unterwegs war. Da hab ich das Weihrauchgefäß auf den Boden gestellt, dachte mir, das mach ich nicht extra aus für die kurze Fahrt. Und dann ist es umgekippt, und die Weihrauchkörner haben sich durch die Matte und den Karosserieboden gefressen. Eine solche Wirkung habe ich dem Weihrauch gar nicht zugetraut.«
Hatte ich selbst ein etwas komisches Gefühl dabei, mit Taschen voller geklaut-geschenkter Lebensmittel nach Hause zu kommen, so war dies meinen Kindern herzlich egal. Für sie zählte nur das Ergebnis: mal wieder richtig viel und lecker futtern zu können, und so legte auch ich das Unbehagen ab, dieses Gefühl der Scham, meine Lieben und mich von Almosen ernähren zu müssen.
Ich stellte Tasche und Jutesack auf den Küchenboden und holte die Kinder herbei. Sie sollten mir helfen, die Sachen in den Kühlschrank zu räumen und den Rest in den Schränken zu verstauen. Ungläubig guckten sie auf die riesigen Mengen an Lebensmitteln. Ich hätte mir denken können, dass die zuckerentwöhnte Rasselbande nur bis zu den Schokoküssen kam – ich räumte alleine weiter ein, während sich die Kinder mit großem Geschrei über eine Packung hermachten. (Die beiden anderen Packungen versteckte ich wohlweislich und rückte sie später in fein dosierten Mengen heraus.) Die Jungen wussten vor allem die Brühwürstchen zu schätzen, die es die nächsten Tage zusammen mit leckerem Kartoffelsalat gab. Die Mädchen freuten sich besonders über Milchreis und Apfelmus. Ich behielt für mich selbst eine Tüte Kartoffelchips zurück; gemeinsam mit einem Glas Rotwein war dies am selben Abend für mich ein herrliches Verwöhnen.