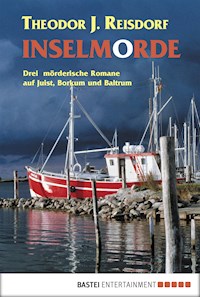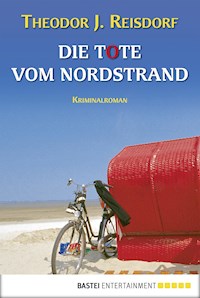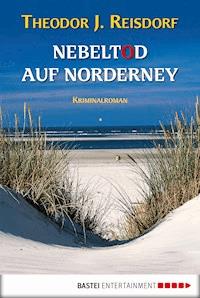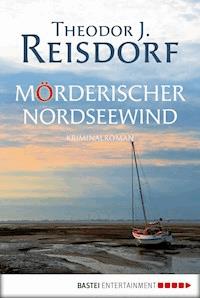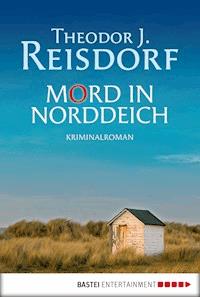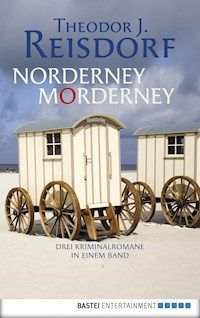5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Sommer, Sonne, Strand und Leichen - wer kann das besser unter einen Hut bringen als Theodor J. Reisdorf, der Meister des Friesenkrimis? Hier legt er seinen Lesern eine Sammlung von dreizehn kleinen Mord(s)geschichten vor, die wie seine Romane den eigentümlichen Charme seiner Heimat atmen. Genau die richtige Urlaubslektüre also für all diejenigen, die von norddeutschen Kriminalfällen nicht genug bekommen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 673
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
THEODOR J. REISDORF
13 KLEINEFRIESENMORDE
ROMAN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
© 2003 by Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
Titelbild: Bahr/Premium
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0084-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Inhalt
1. Hundeliebe
2. Mann über Bord
3. Der Knüppelmord
4. Der Sportschütze
5. »Wir wollten ihn nicht totmachen«
6. Troubadour und der Dünenmord
7. Das Vermächtnis des Käptn van Loo
8. Der Wildgansmord
9. Tödlicher Vatertag
10. Stationen eines Mörders
11. Rolling home, rolling home across the sea …
12. Das verflixte siebente Jahr
13. Zweimal lebenslänglich
Hundeliebe
In ihren Jungmädchenjahren legte Anja den Weg vom Luichthof über den einsamen Wurzeldeich nach Dosum fast täglichzurück. Der Frühling überraschte sie mit Wetterlaunen. Bei strahlender Sonne, wenn der Sommer die gelben Löwenzahnblüten in das satte Grün stickteund der Sommerwind das Gras kämmte, kam ihr die Strecke kürzer vor als im Herbst, wenn sie gegen den Sturm ankämpfen musste, der von der Insel alskalter Nordwest blies. Im Winter stapfte sie in eisiger Kälte durch den meist klebrigen Schnee und trat ihn mit Gummistiefeln zu Matsch. DerLuichthof war einer der größten Höfe im Benninga-Land, das sich auf der Ostfriesland-Karte mit einem halben Zirkelschlag um die Burg, derenTürmchen die Wahrzeichen der kleinen Stadt sind, schlagen lässt.
Nach der mittleren Reife absolvierte Anja eine Ausbildung als Apothekenhelferin und schloss sie mit dem Examen einer pharmazeutisch-technischenAssistentin ab. Anja lehnte enge Bindungen an Männer konsequent ab. Allerdings war sie wegen ihrer Großzügigkeit in der Liebe bei Tanzveranstaltungen vonden jungen Männern dicht umlagert.
Die Frauen von Dosum stießen sich an Anjas schnippischer und arroganter Art. Sie pfefferte ihren Stolz listig mit modischen Extras, und wenn es nur einbuntes Tuch war, das sie auffällig in ihr halblanges blondes Haar eingeflochten trug.
Am Tresen der Burg-Apotheke schaute sie im weißen Kittel von oben herab, und ihre Schritte an die Regale, ihre Griffe nach Tuben undPackungen führte sie aus, als hätten die Kunden ihr die wirksame Heilkraft der Medikamente zu verdanken.
Als ihre Eltern kurz hintereinander starben, war Anja reich und einsam. Die jungen Männer, die früher bei ihr den Beischlaf gesucht hatten, waren insolide Ehebetten geschlüpft.
Anja entschloss sich, den Jagdschein zu erwerben, denn die Wiesen des Luichthofes reichten bis an den kleinen Leuchtturm, der den Fischern half, den Wegzwischen Küste und Insel zu finden, wenn sie vom Krabbenfang den Hafen Occersiel anpeilten.
Zu dieser Zeit fand Hero Gefallen an der Jagd. Er führte eine Teegroßhandlung mit Erfolg in hohe Gewinne und suchte die Flucht vor seiner Mutter und dendrei unverheirateten Schwestern, die im benachbarten Nordstadt Mode aus Paris, Mailand und New York papageienhaft auf der Marktstraße vorführten und dieBlicke der hastenden und bummelnden Menschen als Bewunderung auslegten. Dabei waren sie bemüht, im Vorbeischreiten ihre Spiegelbilder in den Glasscheibender Geschäfte zu erhaschen.
Die Frauen um Hero hatten ihren Einfluss auf ihn nicht ohne Erfolg ausgeübt. Er trug den Mantel modisch kurz mit übertriebenem Karo. Anstelle derortsüblichen Prinz-Heinrich-Mütze saß eine schreiend gestreifte Schirmmütze keck auf der angegrauten Halbglatze.
Hinter den Tischen des Waldlokals lauschten Anja und Hero, anfangs getrennt, den Worten des Försters, wenn er sachkundig, gewürzt mit gelegentlichen Kraftausdrücken, die Jagdgesetze interpretierte.
Als der Kreisjägermeister in dem kleinen Saal, in dem noch der Schmuck einer goldenen Hochzeit hing, mit Flinten hantierte, die Läufe großtuerischabknickte und das Thema Waffenkunde breit abhandelte, saßen Anja und Hero bereits vereint hinter einem Bier und Corvit und drückten sich hin und wiederunter der Tischplatte die Hände und ließen ihre Augen abwandern von Bockbüchsen und Schrotflinten und vereinten blinzelnd ihre Blicke. Zu den späterenSchießübungen an der Rehwiese fuhren sie gemeinsam in Heros Sportwagen und reichten sich liebevoll die Gewehre. Sie jubelten sich zu, wenn es ihnen gelang,die fliegenden Tonscheiben in der Luft zu zertrümmern.
Im abgestellten Auto, auf dem Waldweg unter dem Dach blattreicher Buchen, zeigte Anja Hero die von den Rückschlägen der Büchse bunt verfärbten Hautflecken oberhalb der vollen Brust.
»Wir werden heiraten und bauen!«, sagte Hero entschlossen, als das Dienstmädchen den frischen Blumenstrauß auf den Frühstückstischstellte.
Die Schwestern reichten sich den großen ovalen Handspiegel, ein antikes Stück aus Bremen, und mit den gekrümmten kleinen Fingern setzten sie zierlich dieSchlussstriche unter die Nacht, um in langen Seidenkimonos Altsilbermesser an Hörnchen zu legen. Heros Nachricht war keine Sensation, eher eine bereits vonden Damen genehmigte Aktion. Anja war ja vermögend.
Die Liebenden planten ihr Nest. Sie ließen bauen. Die Fantasie des Paares trieb dem Architekten Schweißperlen auf die Stirn, da Vernunftam Bau völlig auf Eis lag und extra gewünschte Bogen und Nischen seine Planungen durcheinander brachten.
Die Liebe hatte das Haus entworfen. Das Glück zog ein. Die einfachen Nachbarn wurden allzu oft Zeugen, wenn das bereits ältere Paar morgens auf der nachhistorischem Muster ausgepflasterten Einfahrt Händchen haltend, sich drückend Abschied voneinander nahm, als zöge Hero mit einer Expedition in das ewigeEis. Dabei konnte er ohne großen Verkehrsfluss seine 120 Jahre alte Firma gemütlich im Sportwagen in fünf Minuten erreichen.
Die einfach gekleideten Frauen suchten den Blick aus den Fenstern, wenn Anja und Hero übereinstimmend in Grün eine Tanne versetzten, im burschikosen Buntden neuen Straßenbesen führten oder im Pariser Look zum Spaziergang starteten.
Als der hinkende Rentner mit der Liste der Arbeiterwohlfahrt erschien, die Schiffsglocke der »Fortuna« zog, die vor 100 Jahren vor dem Cooperriff 20Passagiere in die Wellen geworfen und sie dem nassen Tod übergeben hatte, blieb die Schnitztür ungeöffnet.
Ebenso sangen Kinder mit leuchtenden, bunten Laternen am Martinstag vor den Marmorstufen aus Carrara vergeblich.
Die erwartete Veränderung von Anja blieb aus. Sie wurde nicht schwanger. An Anjas Geburtstag fuhren dicke Autos vor. Modegelangte zur Schau. In einem mit blauen Bändchen geschmückten Korb, liebevoll gehalten von Heros Mutter, blickte ein vom Hundefriseur gestutzter Pudel mit nervösen Kopfbewegungen aus schwarzen Perlaugen auf Anja und Hero.
»Ist der süß!« Überschwänglich, zu laut, drang ihre Stimme den Kindern entgegen, die ihre Diskoroller auslaufen ließen, um die in langen Kleidern erschienenen Damen zu bewundern. Auch sie fanden das kleine, verängstigte Hundegesicht niedlich. In die Villa zog junges Leben.
Es war in der Adventszeit, als Hero froh gelaunt vom Teehaus kam. Anja ließ Tarzan frei. Er bekam sein Küsschen.
»Unser Nachbar, der Polizist, war heute hier. Er verlangt, dass wir einen Zaun ziehen. Tarzan soll seine Wiese nicht betreten, wegen der Kinder.«
Hero sagte empört: »Typisch Bulle!«
»Hero, bald ist Weihnachten. Tarzan wünscht sich ein warmes Mäntelchen«, sagte Anja, wobei sie ihre Zigarette mit gespreizten Fingern von sich hielt. Auf ihrem Kopf saß die Seidenturbanhaube aus Düsseldorf, und mit eckigen Kopfbewegungen brachte Anja den kleinen Edelstein zum Leuchten. Sie schritt an die Eichenbar, um zur Abendbegrüßungsstunde die silbrige Corvitflasche hervorzuholen. Hero langte, wie an jedem Abend, nach den Kristallgläschen im Sideboard.
Die großen Fenster ihres Vorzimmers ließen den Blick offen. Während die Nachbarin gegenüber den Henkelmann ihres Mannes spülte, sah sie, wie Tarzan auf den Tisch hüpfte und Anja ihn mit Fleischklößchen fütterte.
Es wurde keine weiße Weihnacht. Die schweren Kirchenglocken läuteten das Fest ein. Aus den ovalen Backsteinfenstern von St. Ansgari drang im Zweiklang die Aufforderung zur Besinnung. Der Küstenort suchte den Frieden.
Als sich die Kirchenbesucher heimfanden, erstrahlten die Tannenbäume im Kerzenlicht. Die Kinder machten sich über Feuerwehrautos, Piratenschiffe und Eisenbahnen her. Sonja, die Tochter des Klempners, wurde das erste Mal mit »Mutti« von der schräg gehaltenen Puppe angeredet.
Tarzan, in seinem Zimmer eingesperrt, ließ vor Aufregung seine Tatzen schabend über die Holzfläche der Tür gleiten.
»Sei doch nicht so ungeduldig, Liebling!«, rief Anja, während sie den Gabentisch vorbereitete.
Anja zupfte aus einem Karton ein Hundemäntelchen mit eingewebtem »T«, während das Licht der elektrischen Kerzen die Zweige des Baumes bläulich färbte.
Geschenke für Hero versah sie mit Tannengrün. Die Bücher »Menüs, die Hunde lieben« und das von dem berühmten Fernsehprofessor verfasste Buch »Wie lernt mein Liebling mehr«, eine Intelligenzkunde für Hunde, schob sie an den Rand des Tisches.
Über die Pflasterauffahrt holperte der Sportwagen. Hero hatte das Geschenk für Anja in Eichhausen abgeholt. Anja stand in der Tür. »Hero, beeil dich! Tarzan ist so aufgeregt!«, forderte sie ihn auf und verschwand.
Hero schob den Karton seitlich und ließ die Autotür offen. Liebevoll griffen Anjas Hände über Weihnachtspapier und Tannengrün.
»Du kannst kommen!«, rief sie. In ihrer Stimme lag der hohe Klang der Freude.
Hero überflog mit strahlenden Augen den Gabentisch.
»Ist das herrlich, Anja!«, sagte er glücklich. »Die Kniebundhose und den Pullover habe ich mir immer schon gewünscht!«
Er drückte Anja an sich und bemerkte die restlichen Geschenke.
»Die Bücher! Dass du daran gedacht hast, das ist himmlisch!«, rief er frohlockend.
»So schön ist Weihnachten, wenn man sich lieb hat!«, sagte Anja.
»Tarzan, bitte noch etwas Geduld, zuerst wird Mami beschert!«, rief Hero in Richtung Korridor, aus dem das Jaulen zu ihnen drang.
»Anja, nicht hinsehen! Augen zu! Ab in das Kaminzimmer!«, befahl Hero.
Tarzans Aufregung brach Anja fast das Herz. Dann endlich vernahm sie die erlösende Stimme: »Anja, der Weihnachtsmann war da!«
Sie eilte drauflos. Ein brauner Karton, verschnürt, mit großen Löchern wie perforiert, stand auf dem Tisch. Aus dem Paket drang ängstliches Gezirpe.
Anja entknotete mit hastenden Händen die Kordel. Als sie den Deckel abhob, stieß sie freudig aus: »Oh, wie entzückend!«, und ihre Hände fassten zu und legten sich um den zittrigen Leib des schneeweißen Pudels, der ängstlich seine Ohren hochgerichtet hielt.
Anjas Finger fühlten den Herzschlag des verängstigten Tieres, als sie die kleine Hundeschnauze mehrmals an ihren Mund drückte. »Was bist du nur für ein niedliches Kerlchen!«, rief sie außer sich und bemerkte erst jetzt, dass der Pudel mit einem weiteren Geschenk das Paket verlassen hatte. Um dem schmalen Hals trug er ein massives Armband, das von einem Goldbarren zusammengehalten wurde, über den in Eile ein Sekundenzeiger glitt.
Anja war entzückt. »Hero, mein Liebling!«, jubelte sie und zog den Kopf ihres Mannes nach unten, um den Dreieckskuss mit kalter Hundeschnauze zu ermöglichen.
»Das ist Napoleon!«, sagte Hero stolz, und Anja seufzte glücklich: »Tarzan und Napoleon!«
Hero holte Tarzan, der so lange auf Weihnachten warten musste. Das Scharren drang ihm entgegen. Als er die Tür öffnete, schoss Tarzan an ihm vorbei. Er umsprang Anjas Beine, dann setzte er sich bettelnd auf die Hinterpfoten, und mit hochgestellten Ohren jaulte er Napoleon an, der unruhig andeutete, dass er auf den Boden wollte. Tarzan saß aufrecht. Napoleon umhüpfte ihn mit wedelndem Schwanz. Dann hob er die weiße rechte Pfote und tupfte, wie ein Boxer im Ring, mit seiner Tatze an das schwarze Pudelhaar.
Hero und Anja schauten fasziniert zu. Ihre Arme suchten die Umklammerung, und als die beiden Hunde sich rauften, ohne sich zu beißen, und ihre Körper über den Perserteppich wälzten, suchte das Ehepaar, überwältigt vom Glück, die Sitzgelegenheit auf der Nappacouch. Der teure Goldschmuck aus dem renommierten Hamburger Juwelierhaus kollerte Napoleon vom Hals. Anja hob ihn auf.
»Hero, du machst mich so glücklich!«, hauchte sie ihm ins Ohr, und ihre Hand glitt zärtlich über den Rest des angegrauten Haares.
Hero holte die flache Schachtel, die eingeschlagen in buntem Glocken- und Tannenpapier unter Tischdecken versteckt lag. Anja öffnete sie für Tarzan.
»Nein, sind die süß!«, rief sie überschwänglich und hob die aus Zeder mit Naturfell hergestellten Hundeschuhe aus der Packung.
»Die muss Tarzan morgen tragen, wenn wir unseren Weihnachtsspaziergang machen«, sagte sie. Während sie die Hundeschuhe küsste, fragte sie: »Hero, was möchtest du zur frohen Stunde trinken?«
»Einen Black and White«, sagte Hero überglücklich.
Die Nachbarn hatten den neuen Akteur bereits bewundert. Als Anja ihren Hero in die Teefirma schickte, bekam er nicht nur von ihr den Kuss, sondern sie hob Napoleon und Tarzan in Fensterhöhe des Sportwagens und Hero suchte die Hundeschnauzen, bevor er vom Pflaster lenkte.
Im Teehaus, an seinem Schreibtisch, legte Hero kindlich Naives ab und beherrschte mit geschultem Blick und klugem Verstand das Handelshaus. Er war als sozialer Arbeitgeber bekannt. Seine Gratifikationen für lang gehegte Firmentreue fielen nie mickrig aus. Oft schoben die jungen Mütter voller Stolz die Kinderwagen in Richtung Teefirma, um vor dem Chef temperamentvolle Babys, die sich dann stimmgewaltig selbst vorstellten, aus den Kissen zu heben. Dabei kam es vor, dass Hero Tarzan und Napoleon hasste, für die Anja sonntags den Lieblingspudding kochte.
Hero, der mit Anja und den Pudeln zurückgezogen lebte, bemerkte, dass die Nachbarn ihm aus dem Wege gingen. Sie schluckten das Gekläffe ohne Hinweis an das Ordnungsamt.
Seine Kumpel des Jachtclubs stellten die Besuche ein. Er hatte seine »Rosa Frisiae« unter Preis verkauft, weil Anja die Seescheute.
Ihre Unfruchtbarkeit setzte ihm plötzlich Zweifel. Der Frauenarzt betonte ihm gegenüber die hervorragende Gesundheit von Anja. Auch seine Mutter und die Schwestern ließen sich immer seltener von Tarzan und Napoleon anbellen.
Während in Hero die Zweifel aufstiegen, war es Anja, die die Abneigung der Nachbarschaft regelrecht herausforderte, wenn sie Tarzan und Napoleon in Hundemäntelchen und mit Hundeschuhen im geflochtenen Holzkorb über das Waldstück trug und die Kinder verjagte, wenn sie neugierig den Blick in Knopfaugen suchten.
Auch das Abschiedszeremoniell morgens auf der Einfahrt begann Hero zu verabscheuen, weil Anja übertrieb. Der Polizist grüßte nicht mehr, und die Kinder mieden sein Grundstück. Hero brachte es nicht fertig, mit Anja das Gespräch zu suchen. Er spielte weiter mit.
Es war an einem Freitag. Der Gärtner hatte den Park für den sprießenden Frühling zurechtgestutzt. Anja saß in Wartestellung im Vorzimmer.
»Schön ruhig, meine Lieblinge. Papi kommt gleich«, sagte sie zu Tarzan und Napoleon. Der Zeiger der alten friesischen Meerwievken-Uhr zeigte an, dass Hero den Sportwagen sogleich auf die Pflastersteine rollen lassen musste.
Der Zeiger zog weiter. In Anja stieg die Unruhe. Sie erzählte Tarzan und Napoleon eine Geschichte aus dem Buch, das Hero so viel Freude bereitethatte. Unerbittlich drehte der Zeiger die Runden. In Anja stieg die Unruhe.
Endlich fuhr der Wagen auf das Pflaster. Hero befand sich in bester Stimmung. Er sprach von seinem Schulfreund Eberhard, der Professor in Berlin war und ihn aufgesucht hatte, weil er eine Arbeit über Ostfriesland vorbereitete und sich nach der Firmengeschichte erkundigt hatte.
Hero übersah an diesem Abend zum ersten Mal Tarzan und Napoleon und berichtete Anja von den Söhnen des Schulfreundes, als wären es seine eigenen.
In Anjas Gesicht zogen Schatten. »Aber Hero, du kannst uns doch nicht einfach hier sitzen lassen und mit einem Schulfreund Bier trinken, wenn Tarzan und Napoleon sich Sorgen machen! Das finde ich unerhört!«, sagte sie schnippisch und ließ Hero ohne den Begrüßungstrunk zurück.
Tarzan und Napoleon folgten ihr. Hero ließ sie ziehen. Er setzte sich geschafft in den Antiksessel.
»So ist sie mir noch nie gekommen!«, dachte er und verwarf den Gedanken, seine Mutter als Schlichterin zu sich zu bitten.
Hero nahm Buchen- und Birkenscheite, legte sie auf den Eisenrost und entflammte mit einem Anthrazitwürfel die Glut. Vor dem Kamin hockend, ließ er seine Gedanken kommen und gehen. Lange war es her, dass er mit Anja vor dem Feuer gesessen hatte. Tarzan und Napoleon jaulten, wenn die Flammen um die klobigen Scheite tanzten.
Er öffnete die Eichenbar und schob angewidert die Whisky-Flasche beiseite, die zum Zeichen von Güte und Qualität das Etikett mit den beiden Pudelntrug. Er langte zur silbrigen Corvitflasche und goss das Kristallgläschen randvoll. Hero schluckte mit Blick auf lodernde Flammen die Enttäuschung von seiner Seele. Er vergaß seinen Wunsch, den Abend mit seinem Kumpel Eberhard zu verbringen, den er mit Rücksicht auf Anja, unverzeihlich nach all den Jahren, nicht zu sich eingeladen hatte.
Hero schickte an diesem Abend, gelöst vom Alkohol, viele Gedanken in die Wölbung des Kamins und ließ sie mit dem Rauch durch den Schornstein in die Nacht ziehen.
Als die Scheite abgebrannt waren, erlosch auch in ihm das Feuer. Ihn trieb es in das Ehebett, wo alleine ein neuer Start genommen werden konnte. Aber die Tür zum gemeinsamen Schlafzimmer war verschlossen. Auf seinem Bett kuschelten sich Tarzan und Napoleon in Daunen. Sein Klopfen an die mit Schnitzereien verzierte weiße Tür blieb unbeantwortet.
Hero, Chef der historischen Teefirma, suchte Schlaf und Vergessen auf der Couch mit Nappa-Bezug, auf der er mit Anja Weihnachten den kleinen Napoleon bewundert hatte.
Am Morgen fuhr Hero ohne Hundeküsschen und Händchenhalten im Sportwagen seiner Firma entgegen.
Gegen 10 Uhr erschien Anja im grünlichen Alcantara-Kostüm. In ihr halblanges Haar hatte sie ein buntes Tuch geflochten. Tarzan und Napoleon umschlichensie kläffend. Von oben herab fiel ihr Blick über die Einfachhäuser.
Am Abend befanden sich zur verspäteten Ankunft von Hero weder Anja, Tarzan noch Napoleon auf den Marmorstufen. Hero hatte sich um eine Stunde verspätet, da er mit dem Teeimporteur aus Bremen um den Preis gepokert hatte. Zum Schluss hatten seine Nerven und sein Sachverstand die Firma um eine erkleckliche Summe bereichert. Hero drängte darauf, Anja den geschäftlichen Erfolg kundzutun. Er vermisste irritiert die gewohnte Begrüßung. Enttäuschung machte sich in ihm breit. Er durchlief die vielen Winkel, dann wies das Jaulen der Hunde ihm den Weg.
Anja befand sich mit Tarzan und Napoleon im Schlafzimmer.
Hero klopfte an die Tür. Vergeblich. Sie war und blieb verschlossen.
»Anja!«, rief er und dachte über diese harmlose Allüre seiner Frau nicht weiter nach. »Anja, sei vernünftig! Mach die Tür auf!«
Aus dem Schlafzimmer hörte er ihre Stimme. Sie klang hell, fast vibrierend. »Hero, du hast uns enttäuscht!«
»Öffne, Anja!«, befahl er in dem Ton, den seine Angestellten kannten. Er kam sich blöde vor und vernahm das Kläffen und Scharren der Hunde.
Hero spürte, wie tief aus seinem Inneren eine ungekannte Wut hochstieg. Seine Demütigung produzierte blitzschnell Hass, als er gegen die Tür trommelte und brüllte: »Lass die Scheißköter raus! Ich kann sie nicht mehr ausstehen! Eberhard hat Söhne, Söhne!«
Hero war außer sich. Schweiß tropfte von seinem Gesicht. Unaufhörlich hämmerten seine Fäuste auf das Holz. Er hatte das Segeln aufgegeben, auf Freunde verzichtet. Und jetzt dieses.
Die Tür sprang auf. Tarzan und Napoleon stürzten ihm entgegen. In wilder Wut trat Hero Tarzan in die Flanke und haute dem hochspringenden Napoleon mit der Faust auf die kleine Hundeschnauze. Dann sah er im Nebel der Wut Anja, die vor ihm stand.
Heros Blick glitt über das Jagdkostüm. Anjas Gesicht war die Konzentration einer Riesenenttäuschung. In ihrer Hand lag die Jagdflinte.
Hero sah den Feuerblitz, dann sank er getroffen zu Boden. Seine Augen nahmen Ungläubigkeit und Überraschung mit auf die letzte Reise.
Der Polizist im Nachbarhaus horchte auf.
»Das war ein Schuss!«, rief er und stürzte los.
Tarzan und Napoleon umbellten ihn, als er Anja die Jagdflinte aus den kalten Händen nahm.
Mann über Bord
Die Schonerbrigg »Santana« wurde 1886/87 in Elsfleth von dem Schiffsbaumeister Johann Oldersen erbaut. Sie war 34,58 m lang, 7,69 m breit, 3,92 m tiefund mit 266 BRT vermessen. Heimathafen war Brake.
Mit ihrer siebenköpfigen Besatzung segelte die Santana 1888 von Hamburg nach Archangelsk und 1889 von Brake nach Nieuw Nickerie, Surinam (Südamerika).
Bei der Rückreise Ende Januar geriet die Schonerbrigg in einen schweren Sturm. Der Matrose Johnny Barkhoff aus dem ostfriesischen Berum wurde von einer Welle erfasst, über Bord gespült und ertrank. Bei diesem Unwetter verlor die Santana zudem ihre Deckslast. Dabei wurden die Rettungsboote schwer beschädigt.
Der Kapitän der Santana war Folkmar Betten, geboren 1843, aus Neuharlingersiel. Er und seine Mannschaft erreichten, ohne weitere Schäden davonzutragen, den Hafen von »Grangemouth«. Nach beendeter Reparatur segelte die Santana nach Riga. Im Herbst desselben Jahres von Hamburg nach »Laguna de Términos«, am Golf von Mexiko gelegen.Von dort unternahm sie einen Törn nach Barbados, segelte anschließend weiter nach Tahiti und »Progresso«. 1890 holte die Schonerbrigg aus »Laguna de Términos« Mahagoni-Holz mit dem Zielhafen Hamburg. Von dort legte sie ab und segelte erneut nach »Términos«.
In den weiteren Jahren sind außer den bereits genannten Reisen folgende Häfen aufzulisten, die die Santana ansegelte. Die Namen rangieren in der chronologischen Reihenfolge: Maceió, Rio de Janeiro, Paranaguá (Brasilien), Magdalena (Kolumbien), Rio Grande, Jan José del Norte, Pelotas, Pernambuco, Rosario, Buenos Aires und Trinidad.
1896 verließ die Schonerbrigg Santana im Januar den Hafen von Rio de Janeiro und nahm Kurs auf Pernambuco. Während der Reise bei schönem Wetter und ruhiger See, der Wind blies flau aus nordwestlicher Richtung, segelte die Santana am 29. Januar mit Backbordhalsen hart am Wind.
Die Stimmung an Bord bezeichnete Kapitän Folkmar Betten im Logbuch mit ausgezeichnet. Sie hatten in Rio de Janeiro frischen Proviant aufgenommen und machten gute Fahrt. Die Männer waren ausgeruht. Der Koch hatte Rührei mit Speck zubereitet, frisches Brot geröstet, nahrhafte Tomaten in Scheiben geschnitten, eine bis dato in der Heimat unbekannte Gemüsefrucht, den indischen »Assam-Tee« aufgebrüht und die Männer in der Mannschaftsmesse bedient, die am fest verschraubten Holztisch das Frühstück einnahmen.
Orangen und Bananen türmten sich in einem Bastkorb. Die Männer frotzelten und witzelten über ihre Erlebnisse in der fremden Metropole.
Jan Toenjes, der 34-jährige Koch aus Nessmersiel, blickte überrascht auf die unbenutzte Teetasse.
»He, Jungs, was ist mit Pitt? Pennt er noch?«, fragte er.
Die Gespräche erstarben.
»Seine Koje war leer«, antwortete der Matrose Menke Diekster und erhob sich. »Der muss immer noch einen Mordshunger haben, nach seinen Streifzügen durch Rio. Ich schaue mal nach.«
Er verließ die Messe, um nach Pitt Luttmann Ausschau zu halten. Minuten später kam er aufgeregt zurück. »Er ist weg! Nirgendwo zu finden«, sagte er.
Die Männer beendeten das Frühstück. »Ich halte den Tee warm. Er wird doch nicht . . . «, bemerkte der Koch besorgt.
»Halt deine Klappe! Du hättest uns mit deinem Fraß fast alle auf den Pott verdammt«, sagte ein Matrose spaßig.
Er und der Kapitän hatten sich nach dem Ablegen in Rio de Janeiro in Folge der Hitze unwohl gefühlt, über Appetitlosigkeit und Verstopfung geklagt. Doch das hatte sich behoben.
Der Kapitän und auch er fühlten sich wieder gesund und wohl.
Der Abort befand sich hinten auf dem Schiff. Kapitän Folkmar Betten hatte der Mannschaft den strengen Befehl erteilt, ihre Bedürfnisse nur dort zu verrichten, und es verboten, ihre Notdurft vom Bug aus zu verrichten.
Die Mannschaft schwärmte aus, durchsuchte das Schiff nach Pitt Luttmann. Die Männer betraten selbst die Ladeluken und riefen nach ihm. Ergebnislos. Sie fanden vor der Back seinen abgelegten Leibriemen und schlossen daraus folgerichtig, dass sich der Matrose Pitt gegen die Anordnung des Kapitäns in der Bugspitze entleert hatte und dabei über Bord gegangen war.
Kapitän Betten griff unverzüglich ein. Er gab die entsprechenden Segelkommandos. Der Steuermann nahm Kurs. Die Santana folgte dem Ruder, beschrieb einen Bogen und segelte in entgegengesetzter Richtung durch die spiegelklare See, ohne den Verunglückten zu entdecken. Sie vernahmen keine Hilferufe. Zur Bestätigung ihrer schrecklichen Vermutungen trieb auf den leichten Wellen aufgeweichtes, gekräuseltes Zeitungspapier. Ihr Fazit: Pitt Luttmann hatte seinen Tod selbst zu verantworten. Es gab an Bord keine Zeugen, denen er auf dem Weg zum Bug begegnet war.
Kapitän Folkmar Betten machte eine diesbezügliche Eintragung in das Logbuch. In Begleitung des Steuermannes räumte er die Habseligkeiten des jungen, tüchtigen Seemannes in den Seesack, ohne seine Intimsphäre mit Schnüffeleien zu verletzen. Ein trauriger Vorfall. Um die Hinterbliebenen kümmerte sich die Reederei.
Bei der Ankunft in Pernambuco suchte der Kapitän mit seinem Steuermann das Konsulat auf, gab den Vorfall zu Protokoll und bat um eine dienstliche Stellungnahme mit entsprechenden Besuchen an Bord der Santana. Die Seefahrtsbehörde verzichtete auf eine Befragung seiner Mannschaft, da es keine Zeugen gab und das treibende Papier an der Unglücksstelle den Vorfall in jeder Weise logisch erscheinen ließ.
Auch das zuständige Seeamt in Brake erhob keine Vorwürfe gegen den Kapitän, der seit mehr als zwanzig Jahren seine Schiffe und Mannschaften mit Können, Weit-, Um- und Vorsicht, oft auch mit Fortune, erfolgreich geführt hatte und dem nie eine Mitschuld am Tode eines Fahrensmannes zur Last gelegt werden konnte.
Zu bemerken ist an dieser Stelle, dass sich der Koch Jan Toenjes am frühen Morgen, und das an einem Sonntag, der auch an Bord der Schiffe geheiligt wurde, bei den Vorbereitungen des Frühstücks an einen leisen Ruf erinnerte. Er hatte geglaubt, dass er vom Steuermann kam.
Die Santana setzte ihre Reisen unter der bewährten Führung von Kapitän Folkmar Betten nach Südamerika und in die Karibik fort. Für die Statistik fiel der Tod des Matrosen Pitt Luttmann nicht sonderlich ins Gewicht, für seine Eltern, seine Geschwister und seine Geliebte hinterließ er eine Menge Leid, erst recht, als der Seesack vom Postboten angeliefert wurde.
1902 ging Kapitän Betten nach einem erfolgreichen und abenteuerlichen Seemannsleben von Bord der Santana. Im selben Jahr verstarb seine liebe Frau Antje. Er verkaufte das Kapitänshaus in Neuharlingersiel, zog zu seiner Tochter Minna nach Norderney und half mit dem Verkaufserlös ihr und dem Schwiegersohn beim Ausbau des Logierhauses »Patria«, am Damenpfad gelegen, in dem die preußischen Minister oft verweilten.
Die hohen Herren aus Berlin fanden Gefallen an seinen Berichten aus seiner Fahrenszeit. Das Haus »Patria« gehörte schon bald zur ersten Adresse im aufstrebenden Nordseebad Norderney.
Folkmar Betten nahm sich der Erziehung seines Enkels an und geriet durch einen Zufall, falls es ihn gab, er hielt erfahrungsgemäß mehr von Gottes weiser Fügung, mit seinem nach ihm benannten fünfjährigen Enkel in ein denkwürdiges Ereignis, das ihn an seine Fahrensjahre erinnern sollte.
Mit dem Enkel an der Hand spazierte er im Spätsommer über die Badestraße der Insel Norderney. Er blieb vor der Auslage des Trödlers Heye Fisser stehen,studierte die angebotenen Antiquitäten, die neben viel Tand und Kram, Uniformstücken und kaiserlichen Ehren- und Tapferkeitsorden, Marineraritäten undSchiffsmodellen auch Taschenuhren in vielen Preislagen feilbot. Der Enkel zerrte an seinem Arm, als eine Musikkapelle in Galauniformenmit Pickelhauben der kaiserlichen Marine mit dem »Marsch der langen Kerle« exakt formiert in Richtung Kurhaus marschierte, gefolgt von begeisterten Herrenin Gehröcken und Damen in engen Miedern und langen, ausgestellten, den Boden berührenden Röcken.
Der sechzigjährige, bärtige Kapitän stierte unentwegt auf eine goldene Taschenuhr. Er beruhigte seinen Enkel Folkmar und versprach ihm, gleich mit ihm zum Kurkonzert zu gehen. Er betrat den Laden, hielt den Enkel an der Hand, der belustigt auf das Klingeln der Metallröhren reagierte.
»Kapitän, was verschafft mir die Ehre?«, fragte der schnauzbärtige, agile Heye Fisser.
»Eine Taschenuhr in der Auslage«, antwortete Betten.
Heye Fisser schob die Halteklammern hoch, öffnete die Schaufenstertür und blickte den Alten fragend an.
Betten zeigte auf das besagte Stück. Fisser nahm die Uhr aus der Dekoration und reichte sie dem Kapitän.
»Opi, die ist schön«, sagte Folkmar.
»Dem stimme ich zu«, antwortete der Alte und betrachtete nachdenklich die Taschenuhr.
»Echt Gold«, sagte Fisser. Den Dreh- und Aufziehknopf zierte eine stilisierte Ranke. Vorder- und Rückseite rundeten angedeutete Girlandenkränze ab. Die beiden Deckel trugen feinlinige, parallel verlaufende Rillen, ähnlich einer Wandvertäfelung, die in der Mitte ein fingerbreites Schachbrettmuster umfassten, das auf der Vorderseite in einem glatten Spatenblatt die Gravur »P.L.« trug. Kapitän Betten betätigte den mit dem Knopf versehenen Mechanismus. Die Klappe sprang auf. Er blickte auf das Zifferblatt und nickte. Zwischen den Zahlen 7 und 6 befand sich ein Sekundenzeiger.
»Handarbeit«, bemerkte Fisser.
»Der Preis?«, fragte Betten.
»Ein Sammlerstück, Odermatt, Helvetia, ich überlasse sie Ihnen für sechzig Mark«, antwortete der Trödler. »Eine einmalige Gelegenheit«, fügte er hinzu.
»Da stimme ich Ihnen zu. Ich kaufe sie. Können Sie mir noch verraten, wie Sie in den Besitz der kleinen Kostbarkeit gekommen sind?«, fragte der Kapitän, während Enkel Folkmar an seinem aus englischem Tuch gefertigten Gehrock zerrte.
»Ich habe sie von einen Seemann mittleren Alters. Er gehörte zur Brigg ?Jenny?, die auf dem Wege von Sunderland mit Steinkohle beladen nach Hamburg in der Nähe des Tonnengatts mit zerrissenen Segeln auflief, sich nach abflauenden Winden aber selbst frei machen konnte. Das Schiff wurde auf Reede repariert. Der Seemann war klamm und verkaufte mir die Uhr. Unsere verwöhnten betuchten Gäste suchen oft nach exquisiten Raritäten, die sie bei ihren Konversationen zur Teestunde mit einer ausgefallenen Geschichte verbinden können«, trug Fisser vor, legte die Taschenuhr in einen mit gelber Watte versehenen Schmuckkarton und reichte sie dem Kapitän.
»Folkmar, du darfst sie für Opa tragen«, sagte Betten und reichte dem Enkel die Kostbarkeit.
Betten bezahlte.
»Und die Geschichte zur Uhr?«, fragte er interessiert und lächelte abfällig.
»Sie hat in der Tasche des Seemannes, ohne Schaden zu nehmen, einen Aufenthalt in der brodelnden See überstanden und ihm die Stunde angezeigt, die er schwimmend in der Nähe des Wracks seines Schiffes verbracht hatte, bevor er in ein Rettungsboot gestiegen war«, trug Fisser stolz vor.
»Hervorragend, dann soll sie auch mir Glück bringen«, sagte Kapitän Betten, verließ mit dem Enkel den Laden, begab sich zum Kurplatz und flanierte mit ihm durch die gepflegte Anlage, in der hoch angesehene Herrschaften unter den Klängen der kaiserlichen Marinekapelle Kurzweil fanden.
Kapitän Folkmar Betten erfreute sich einer ausgezeichneten Gesundheit. Er bewohnte im Haus der Tochter ein kleines gemütliches Zimmer mit Blick auf eine leicht ansteigende, mit Gras bewachsene Düne.
Er frühstückte während der Saison mit den zumeist dem Preußischen und Hannoveraner Adel zugehörigen Pensionsgästen und nahm auch hin und wieder, wenn ihm danach zumute war, mit ihnen die übrigen Mahlzeiten ein.
Seine Tochter und sein Schwiegersohn verwöhnten ihn in jeder Weise und freuten sich besonders über seine Zufrieden- und Bescheidenheit im Umgang mit ihnen und den Hausgästen. Sie achteten darauf, dass er in dem großen Haus, das zuweilen einem Bienenkorb glich, nicht zu kurz kam.
Es wimmelte nur so von Diplomaten und Legationsräten, und im Büro sorgten ankommende Telegramme und Depeschen für eine stete Hektik, die selbst manchmal bis in die späte Nacht hineinreichte.
Zu einer weiteren Ablenkung trug auch Enkel Folkmar bei. Er war ein aufgeschlossener und intelligenter Junge, der ihm sehr zugetan war.
Nach dem Abendessen hatte sich Kapitän Betten auf sein Zimmer zurückgezogen und ließ sich vom Dienstmädchen einen Krug Bier auf das Zimmer bringen. Er stopfte den Porzellankopf seiner Pfeife, zündete den Tabak an, nahm die bei Fisser erworbene Taschenuhr aus dem wattierten Kästchen, hielt sie nachdenklich in der Hand, drehte und wendete sie im Licht der Stehlampe. Mit der schweren Kette gehörte sie zur Ausgeh- und Feiertagskleidung des gebildeten Angehörigen der oberen Bürgerschicht. Er hatte sie impulsiv gekauft, weil sie ihm ins Auge gefallen war. Ein Seemann hatte sich von ihr getrennt. Vielleicht hatte es ihm an Geld gefehlt für Dinge, die ihm wichtiger erschienen als die zum Statussymbol zählende Taschenuhr.
Er entnahm dem Schrank den Karton mit den vielen Bildern und Andenken seiner weiten Reisen, paffte die Pfeife, zog an der Schnur, bestellte bei demDienstmädchen einen weiteren Krug Bier, durchstöberte die Fotos, eine Beschäftigung, die er sehr liebte und ihn in vergessene ferne Häfen zurückzurufenschien.
Dabei stieß er auf ein Foto der »Santana«, vor der er sich mit seiner Mannschaft im Hafen von Rio de Janeiro hatte ablichten lassen.
Er studierte die jungen Gesichter seiner Fahrensleute und erschrak, als er den Matrosen Pitt Luttmann erkannte. Er erinnerte sich an den Vorfall auf der Reise von Rio de Janeiro nach Pernambuco. Der Junge war über Bord gegangen, als er gegen seine Vorschrift vom Bug aus seine Notdurft ausgeführt hatte.
Pitt kam aus Pilsum, ein hübscher, lustiger Bengel, auf den die Mädchen flogen, fuhr es Betten durch den Kopf.
Er trank Bier, hob die lange Pfeife an, schabte den Porzellankopf frei, stellte sie ab, griff nach einer kühlen Pfeife und stopfte sie.
Es hatte keine Zeugen an Bord gegeben. Doch wenn, dachte er und fühlte einen kalten Schauer, der ihm den Rücken runterlief.
Er blickte auf die Taschenuhr. »P.L.« Natürlich, auch Pitt Luttmann hatte eine Taschenuhr besessen, daran konnte er sich noch erinnern. Doch sie hatte sich nicht bei seinen Habseligkeiten befunden, die er mit dem Steuermann nach seinem tragischen Ende in den Seesack gepackt hatte.
»P.L.« für Pitt Luttmann, mein Gott, ein Zufall, den mathematisch zu bestimmen an Unmöglichkeit grenzte. Er besaß genügend edle Taschenuhren, mit Widmungen seiner Rederei, eine vom brasilianischen Konsul in Rio, um nur einige zu nennen. Er war auch von keiner Sammlerleidenschaft diesbezüglich motiviert gewesen, dennoch hatte ihn sonderbarer Weise irgendetwas zum Schaufenster geführt und zum Kauf bewogen.
Kapitän Betten war weder ein Frömmler noch Kirchgänger, doch er glaubte an ein Leben nach dem Tode und an eine schicksalhafte Fügung der menschlichen Existenz.
Wenn dem so war und die Seele des jungen Seemannes aus dem Jenseits nach Gerechtigkeit schrie, dann wolle er nicht fern stehen, dachte Folkmar Betten allen Ernstes und nahm sich vor, an die Eltern des Jungen zu schreiben, sich bei der Reederei zu erkundigen, wo seine Fahrensleute geblieben waren, denn, wenn das stimmte, was ihm durch den Kopf ging, dann war einer auf dem Foto vor der Santana in Rio ein Dieb, möglicherweise sogar ein Verbrecher. Auch auf Norderney war die Zeit nicht stehen geblieben. Bereits seit 1872 verkehrte der Schraubendampfer »Stadt Norden« täglich und regelmäßig zwischen der Insel und Norddeich. Er beförderte Passagiere und die Post, während der gesamte Frachtverkehr den Segelschiffen überlassen blieb.
An einem schönen Sommertag nutzte Folkmar Betten die günstige Fährgelegenheit für den Besuch seines Vetters Hillrich Buck, der sich am NorderUlrichs-Gymnasium als Kunsterzieher einen Namen gemacht hatte. Er war, wie auch der Kapitän, Witwer und Pensionär und lebte in Norden in derWesternstraße. Sie hatten sich seit Jahren aus den Augen verloren und wussten sich viel zu erzählen. Die alten Herren schwelgten in Erinnerungen, genossenden Tag, krönten ihn mit einem Café-Besuch in der Nähe von St. Ludgeri.
Der Anlass seines Besuches bei Hillrich Buck galt in erster Linie der Taschenuhr, die Folkmar Betten eine Stange Geld gekostet hatte. Er hegte keine Zweifel an dem Wert seiner Errungenschaft, bereute nicht den schnellen Kauf. Schlaflos machten ihn hingegen seine Gedanken, die nachts seine Träume in gespenstischer Weise zu beeinflussen schienen, seitdem sich das wertvolle Sammelobjekt in seinem Besitz befand.
Kapitän Folkmar Betten sah sich an Bord eines sinkenden Schiffes, dem haushohe Wellen entgegenstürzten. Aus dem brodelnden Meer erhob sich eine Hand, die ihm die Taschenuhr entgegenhielt. Er nahm sie entgegen, wurde von Bord geschleudert und landete in einem Rettungsboot, dessen Ruder ein junger Mann bediente, der unentwegt gegen den Sturm anschrie.
Solche Träume variierten nur um Nuancen. Schweißgebadet fuhr er danach aus dem Schlaf.
Betten bat seinen Vetter Hillrich, eine naturgetreue zeichnerische Darstellung der Taschenuhr aus mehreren Perspektiven anzufertigen, was dem Künstler wenig Mühe bereitete und ihm hervorragend gelang. Auch erklärte sich Hillrich auf Wunsch des Vetters bereit, die Taschenuhr vorerst an sich zu nehmen und aufzubewahren, weil Folkmar davon ausging, dass er damit den Albträumen entfliehen könnte.
Der Kapitän stieg nach einem angenehmen, abwechslungsreichen Tag am frühen Abend vor dem »Weinhaus« in den Eilwagen, den schnelle Pferde zum Anleger der Fähre nach Norddeich zur Mole beförderten.
Noch am Abend verfasste Kapitän Betten einen ausführlichen Brief, legte die Zeichnungen hinzu, adressierte ihn an die Witwe Katharina Luttmann, Neuser Weg 14, Arle, die Mutter des verunglückten Pitt Luttmann, von dem er wusste, dass sein Vater nicht mehr lebte.
Er bat »fürsorglichst und äußerst ergeben« um ihre Nachricht und Stellungnahme.
Bereits an den folgenden Tagen registrierte der Kapitän überrascht das Ausbleiben der quälenden Albträume. Das Sodbrennen stellte sich ein. Er fühlte sich von einer Pflicht erleichtert, die ihm niemand aufgebürdet hatte.
Angeregt durch die Unruhe, die der Erwerb der Taschenuhr bewirkt hatte, begann der Kapitän mit dem Ordnen der vielen Fotos, klebte sie in ein Album, versah sie mit hinweisenden Texten. Dabei fand er zurück in Jahre, die ihm lebenswerter erschienen, denen er nachtrauerte angesichts der modernen Errungenschaften, mit denen er sich schwer tat. Moderne Dampfschiffe verdrängten die Segelschiffe. Niemand hatte mehr Zeit. Die Zeiger der Uhr schienen sich schneller zu drehen als früher.
Mitte Juni, an einem verregneten Freitagnachmittag, erreichte Kapitän Folkmar Betten ein Brief der Witwe Katharina Luttmann aus Arle. Er nahm ihn aus der Hand des Postboten entgegen, reichte ihm 10 Groschen mit dem Hinweis auf das scheußliche Wetter. Er bestellte einen Tee mit Sahne und Rohrzucker und zog sich auf sein Zimmer zurück. Weder Tochter Minna noch der Schwiegersohn Ulfert – das nahm nicht Wunder, sie waren voll ausgelastet – wussten um seine Bemühungen, der Herkunft der teuren Schweizer Uhr auf die Spur zu kommen.
Der Kapitän setzte sich an seinen Schreibtisch und blickte durch das Fenster in den mit dunklen Wolken bezogenen Himmel. Es regnete. Er vernahm das Schreien der Möwen, die im Wind hingen.
Das Dienstmädchen brachte ihm den Tee, mit Stövchen, Sahne- und Zuckerbecher.
»Danke«, sagte er, schob auch ihr einen Groschen in die Hand. Das Mädchen im langen Rock mit weißer Schürze machte einen Knicks und verließ das Zimmer. Der Kapitän war für seine Großmut bekannt. Er bediente sich mit Tee, fügte Zucker und Sahne hinzu, griff zur Pfeife, stopfte Tabak in den Porzellankopf, zündete den Tabak an und rauchte, trank Tee, öffnete das Kuvert und las die in ungeübter Schrift verfassten Zeilen.
Arle, den 12. Juno 1902.
Sehr geehrter Herr Kapitän Betten!
Ich tat mich schwer beim Tode meines geliebten Mannes Afke, der bei einem Unglück auf dem Walfängerschiff »Goode Wind« um sein Leben kam. Doch vielschlimmer traf mich die Nachricht vom Tode meines Sohnes Pitt, der in einer fast peinlichen Situation an Bord Ihrer »Santana« in das Meer stürzte undertrank. Pitt widersetzte sich als Kind bereits bei ihm auferlegten Maßregeln. Er war ein Dickkopf mit liebenswerten Eigenschaften.
Ich teile mein Leid mit meiner Tochter Gretchen, die mit einem Bauern verheiratet ist. Meine Enkel lenken mich ab. Marie, die Geliebte meinesSohnes, hat lange um Pitt getrauert und später den Kolonialwarenladenbesitzer in unserem bescheidenen Ort geheiratet. Mir geht es gut. Ich lebe in demeinfachen Haus mit Garten gegenüber von der Kirche, ohne Schulden, im christlichen Glauben. Die Bezüge der Seegenossenschaft halten existenzielle Sorgenvon mir fern. Mein unvergesslicher Sohn Pitt besaß diese Uhr. Daran gibt es nichts zu zweifeln. Mein Vater, Pitts Großvater, gemeint ist Hidde Meemke,Kapitän auf der Schonerbrigg »Votan«, strandete 1863 auf Öland in Schweden. Er hinterließ Pitt die Uhr, auf die Pitt sehr stolz war. Hinzu kommt, dass sieja wertvoll ist. Sehr geehrter Herr Kapitän, Ihr Brief rüttelte mich auf. Ich ging davon aus, dass Pitt die Uhr bei sich trug, als er von Bord ins Wasserstürzte und ertrank. In diesem Zusammenhang erinnerte ich mich an einen Viertel-Briefbogen, den ich in seinem Seemannspass fand. Es handelt sich um eineArt »Schuldschein«, dem ich entnehme, dass Pitt einem nur mit den Abkürzungen genannten »J.T.« fünfzig Mark ausgeliehen hat. Ich hielt es nicht vonnöten,ihn aufzubewahren. Mein Vater, mein Mann und auch mein Sohn Pitt ertranken und fanden den Seemannstod. Ich bedanke mich für Ihre Zeilenund verbleibe ehrerbietigst
Ihre
Katharina Luttmann
Der Brief ging ihm zu Herzen. Seine Hände zitterten, während er ihn bedächtig faltete und in das Kuvert steckte.
Betten füllte Tee nach, gab Zucker und Sahne hinzu, nahm einen kräftigen Schluck zu sich, schabte mit dem Besteck die Asche aus dem Pfeifenkopf undhängte die Pfeife zu den anderen an den Haken des Haltebrettes, das seitlich die Wand zierte. Er erhob sich, trat ans Fenster und blickte auf denDünenkamm. Der Wind strich über den Strandhafer. Regen fiel vom grau verwaschenen Himmel. Er vernahm die Schläge der Pendeluhr.
Der Kapitän erinnerte sich an den friedlichen Morgen an Bord der Santana auf der Reise von Rio de Janeiro nach Pernambuco. Pitt Luttmann wurdevermisst. Sein Leibriemen wurde auf der Back gefunden. Um dem Matrosen beizustehen, ihn aus höchster Seenot zu retten, hatte er dem Steuermann befohlen, dasSchiff zu wenden und in entgegengesetzter Richtung zu segeln. Sie kamen zu spät, Pitt war bereits ertrunken. Nur das zerknüllte Zeitungspapier, das er fürdie Reinigung nach seiner Notdurft benutzt hatte, trieb auf sanften Wellen und markierte die ungefähre Unglücksstelle.
Ein scheußlicher Tod mit dem Blick auf das davonsegelnde Schiff, das ihm zur Heimat geworden war. Nur der Koch hatte den letzten verzweifelten Hilferufdes Unglücksraben vernommen. Er glaubte die Stimme des Steuermannes gehört zu haben.
Der Kapitän lachte verächtlich. Er dachte an den harten, befehlenden Ton in der Stimme seines Steuermannes, verließ das Fenster undholte aus dem Schrank den Karton. Er fand das Foto, das seine Mannschaft in Rio de Janeiro vor der Santana zeigte. Er steckte es in einen Umschlag, fügteden Brief der Witwe Luttmann hinzu, blies das Teelicht aus, zog im Korridor den langen Wettermantel über, setzte seine Prinz-Heinrich-Mütze auf, griff zumSchirm und verließ das Haus.
Habe ich versagt?, fragte er sich vorwurfsvoll. Mit ernstem Gesicht schritt er durch den Regen, den Blick gerichtet zur Badestraße, und betrat den Laden des Krämers Heye Fisser, der sich über den aufgeregten Kunden wunderte.
Fisser nahm den Schirm entgegen, stellte ihn in den Ständer und blickte in das von Zorn gerötete Gesicht des Seefahrers.
»Die Taschenuhr?«, fragte er, sich anbiedernd.
»Die auch!«, antwortete der Kapitän schnippisch.
Er entnahm dem festen Umschlag, der Regenspuren zeigte, das Foto und hielt es mit zitternder Hand Fisser entgegen.
»Schauen Sie genau hin! Meine Mannschaft vor meinem Schiff!«, forderte er den Krämer auf.
Fisser nahm das Foto in die Hand.
»Wegen der Uhr?«, fragte er beunruhigt, in der Befürchtung, Diebesgut an den Kapitän verkauft zu haben. Er trat hinter den Verkaufstresen, entnahm der Schublade eine Lupe, hielt sie über das Foto und betrachtete die Männer, die Troyer und Seemannshosen trugen. Ihm stockte der Atem. Er vergewisserte sich mit einem zweiten Blick durch die Lupe.
»Der Dritte von rechts mit dem glatt rasierten Gesicht und der stämmigen Figur«, sagte Fisser irritiert.
Kapitän Betten nickte.
»Von ihm kauften Sie die Taschenuhr?«, fragte er ernst.
»Ja, ich vertraute ihm, bitte bereiten Sie mir keine Scherereien«, antwortete der Händler und reichte dem Kapitän das Foto.
»Ihm vertrauten viele, auch ich. Keine Sorge, die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf«, antwortete der Kapitän und schob das Foto in den Umschlag.
»Von Bord der Jenny?«, fügte er hinzu.
»Ja«, sagte Fisser kleinlaut.
»Keine Sorge!« Der Kapitän nahm den Schirm aus dem Ständer, verließ das Geschäft, ging in Richtung Knyphauser Straße und suchte das kaiserliche Polizeirevier auf.
Der 45-jährige Polizeirat Malte Mannen empfing den abgemusterten Kapitän mit Hochachtung, bat ihn Platz zu nehmen und wies auf die Holzbank im nüchternen Dienstzimmer. Der Beamte trug eine schwarze Schleife im weißen, gestärkten Hemdenkragen, eine Weste und eine dunkle Tuchjacke mit ausgelegtem Kragen. Er hatte ein forsches Gesicht und trug sein dunkelblondes Haar, in dem Silberfäden schimmerten, nach hinten gekämmt.
»Kapitän, was führt Sie zu mir?«, fragte er und blickte den alten Mann skeptisch an.
Folkmar Betten berichtete. Er holte weit aus, schilderte den Besuch bei Heye Fisser, ließ nicht aus, dass er, abergläubisch, die Taschenuhr bei seinem Vetter in Norden hinterlegt hatte, unter Erwähnung seiner gesundheitlichen Störungen. Er weihte den Polizeirat ein in die Ereignisse an Bord der Santana und reichte ihm das Foto.
»Für Ihre Akten«, sagte er. »Hier ist der Brief der Mutter des Opfers«, fügte er hinzu und händigte dem Kommissar den Brief aus.
Malte Mannen las die Zeilen der leidenden Witwe und schaute auf.
»J. T.?«, fragte er.
»Jan Toenjes, der Koch. Er hatte angeblich am frühen Morgen einen Ruf gehört. Diese Aussage gehörte zu seinem Plan und sorgte erfolgreich für unsere Ablenkung«, trug der Kapitän vor.
Der Polizeirat Malte Mannen entnahm dem Schreibtisch einen Aktenbogen, tauchte die Feder in das Tintenfass und notierte die Aussagen des glaubwürdigen und angesehenen Seemannes.
»Das fassen wir zuerst einmal zu einer Anklageschrift zusammen«, sagte der Polizeirat anschließend.
Jan Toenjes, der als Koch zuletzt auf der Brigg »Jenny« fuhr, zu Hause in Nessmersiel, dem der Mord an dem Matrosen Pitt Luttmann und Raub zur Last gelegt wurde, befand sich zurzeit auf See, wie sich herausstellte. Er wurde im Herbst desselben Jahres nach der Rückkehr aus Malmö in Bremen festgenommen.
Im Jahre 1903 wurde er wegen des heimtückischen Mordes an dem Matrosen und Bordkameraden, wegen Raubes und Betruges zu lebenslänglicher Gefängnisstrafeverurteilt.
Der Knüppelmord
Jakoba Boomfalk hatte in Berumerfehn als Tochter des Gärtners Kuno und seiner Frau Amanda im Jahre 1935 das Licht der Welt erblickt. Ihr Bruder Alrichkam 1937 auf die Welt.
Ihr Elternhaus lag am Verlaadsweg mit der Schleusenmauer des Fehnkanals. Während ihrer Kindheit luden hier junge kräftige Männer, später waren esKriegsgefangene gewesen, in großen Weidenkörben Torfscheite von den Kähnen, die sie mit langen Staken durch das träge Moorwasser bugsierten.
Auch sie hatte oft geholfen, als sie sechs geworden war, und die Scheite aufgelesen, die aus den Körben gefallen waren.
Ihr Papa befand sich damals als Marinemaat auf einem U-Boot, das von Brest im fernen Frankreich auslief und glücklicherweise Radarortung und Wasserbombenabwürfe überstanden hatte.
Zu der Zeit hatte Mama das große Gartengelände, in dem noch vor Jahren Blumen und Ziersträucher geblüht hatten, Gemüse und Kartoffeln angepflanzt.
Sie hatte viel geweint, wenn sich nach langem Warten die Feldpostbriefe mit gewaltigen Verspätungen einfanden und der Papa wortkarg von erfolgreichen Einsätzen berichtete und er Mama Mut zusprach und die Briefe mit »Sieg Heil« unterschrieben hatte.
Abgesehen von den ständigen Ängsten angesichts der schweren Bombenangriffe der Alliierten auf die Stadt Emden blieb der Landkreis Norden vom direkten Kriegsgeschehen verschont.
Jakoba und ihr Bruder Alrich mussten nicht hungern. Sie besuchten die Volksschule, auf der sich die Sirene befand, die Alarm gab, wenn feindliche Bomberverbände, die sie bei klarem Wetter am Himmel sehen konnten, den Küstenstreifen von Wilhelmshaven bis Emden überflogen.
In der kleinen Dorfkirche betete Mama mit den vielen Nachbarinnen. Sie weinten, wenn sie aus dem Munde des alten Pastors die Namen der Soldaten erfuhren, die für »Volk und Vaterland« draußen an schwer aussprechbaren Frontabschnitten als Bürger des kleinen Feriendorfes ihr Leben gelassen hatten.
Die Anzahl der Witwen und Waisen stieg bedrohlich an. Lang ist die in Stein geschlagene Liste mit den Namen der Gefallenen der beiden Weltkriege, derer zu gedenken das Mahnmal an der Hauptstraße den Gast auffordert.
Doch da gab es auch Erinnerungen an fröhliche Ereignisse, an die sich Jakoba gern erinnerte. Dazu zählte die Herstellung von Karamellbonbons in der Pfanne auf dem Herd, wenn Mama Zucker und Milch abzweigen konnte; das Schnibbeln der Bohnen, die für die Vorratshaltung in Steinbottiche eingelegt wurden. Und erst recht die Spielchen mit den Nachbarskindern im Wald. Sie hatten Bunker gebaut, Verstecke gesucht, sie mit Reisig bedeckt und ausgelassen Onkel Doktor gespielt, harmlos in geflickter Wäsche.
Am Martinsabend zogen sie mit ausgehöhlten Rüben zu den Bauern, bekamen für ihre nicht mehr in die Zeit passenden Liedchen vom »Guten Mann« Wurstzipfel und Schmalzbrote.
Vater Kuno Boomfalk überlebte den Krieg, die Zeiten besserten und normalisierten sich. Jakoba besuchte nach dem Abschluss der Volksschule die Handelsschule in Norden. Zur Konfirmation bekam sie von den Eltern ein Fahrrad geschenkt, das sie unabhängig von der schlechten Busverbindung machte.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Handelsschule begann Jakoba am Kreiskrankenhaus in Norden eine Ausbildung zur Krankenschwester, machte ein gutes Examen und ging voll im erlernten Beruf auf.
Papa und Mama führten die Gärtnerei mit viel Elan zu steigenden Umsätzen mit entsprechenden körperlichen Anstrengungen.
Bruder Alrich zeigte keine Neigungen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen, er besuchte in Oldenburg die Ingenieursschule mit Erfolg und, das sei bereits hier erwähnt, schied nach nur einem Jahr als Bauingenieur bei der Firma Gebrüder Neumann, Norden, aus und folgte seiner Freundin Pamela Anderson, einer Germanistikstudentin, nach Perth in Australien.
Um Jakoba Boomfalk buhlten einige Söhne der reichen Bauern, von denen die hübsche Krankenschwester nichts wissen wollte.
An einem Samstagabend Mitte Mai 1957 entschloss sich Jakoba Boomfalk zu einem Spaziergang in den Berumerfehner Wald, um ein wenig Abstand von ihrem Dienst, erst recht von der bedrückenden Stimmung im Elternhaus zu nehmen.
Eigentlich gab es einen Grund zum Feiern. Ihr Bruder Alrich hatte aus Perth, Australien, angerufen. Er war Vater geworden. Er und seine Frau wollten den Jungen auf den Namen des Großvaters taufen lassen. Doch die Freude hielt sich in Grenzen.
Jakobas Vater, der leidenschaftliche Kettenraucher, bereitete ihnen Sorgen. Er litt häufig unter Atemnot, hustete viel und spuckte unentwegt, lehnte den Besuch eines Arztes jedoch strikt ab. Bereits im Januar hatte er die Leitung seiner Gärtnerei seinem knapp 40-jährigen Meister Uwe Riemers anvertraut und spielte mit dem Gedanken, den Betrieb an ihn zu verkaufen. Immerhin beschäftigte Papa neben dem Meister noch fünf Gesellen und einen Lehrling.
Papa sprach von dem Erwerb einer geräumigen Eigentumswohnung in Norddeich, weil die frische, pollenfreie Seeluft ihm gut bekam.
Jakoba Boomfalk schritt tief in Gedanken über den Waldweg am Moorkanal entlang. Die Luft war nach einem sonnigen Tag mild. Die Bäume trugen keimendes Laub. Der aufgebriste Abendwind fuhr durch Baumkronen. Dabei näherte sie sich einer Ruhebank, auf der ein junger Mann saß. Er trug Jeans, ein buntes Oberhemd und eine rehbraune Wildlederjacke. Sein Haar war blond und lockig. Er hatte das rechte Bein angezogen, die Jeans bis zum Knie hochgeschoben, die Socke ausgezogen und sie in den Schuh gesteckt, der vor ihm auf den Boden stand.
Der junge Mann hatte ein gut geschnittenes schmales, sonnengebräuntes Gesicht und blickte Jakoba mit einem verlegenen Lächeln an.
»Sind Sie von hier, Fräulein?«, fragte er im rheinischen Tonfall.
»Ja«, antwortete sie distanziert, errötete leicht, als sich ihre Blicke kreuzten.
Auch sie trug ihre Jeans an diesem Abend und über ihrer weißen Bluse ein kragenloses Trachtenjäckchen.
»Gibt es hier Zecken?«, fragte der junge Mann und zeigte auf eine gerötete Hautstelle oberhalb des Fußgelenks. »Vielleicht war es nur eine Mücke«, fügte er hinzu. Er fuhr mit dem Zeigefinger der rechten Hand über die leichte Schwellung.
»Unsere Zecken sind im Gegensatz zu ihren Geschwistern im süddeutschen Raum ungefährlich«, antwortete Jakoba, neigte sich vor und betrachtete die harmlos aussehende Verletzung.
»Wissen Sie, mein Nachbar Hännes, ich komme aus Korschenbroich, bei Mönchengladbach, mein Name ist Josef Pilchrat, ist während einer Kegeltour in Bad Neuenahr von einer Zecke gebissen worden. Er liegt nach drei Monaten immer noch im Koma«, sprudelte der Mann temperamentvoll drauflos.
Jakoba hatte gute Augen. Sie bemerkte die kleinen, fast parallel verlaufenden Bissstellen und die winzigen dunklen Punkte der giftigen Stacheln.
»Mit einer Lupe und einer Nadel könnte ich Ihnen helfen. Doch man kann nie wissen. Sie benötigen vorsorglich Penizillin«, sagte Jakoba fachmännisch.
Der junge Mann blickte sie erstaunt an.
»Fräulein, Sie sind schöner als ich mir meinen Schutzengel vorgestellt habe«, sagte er.
Jakoba winkte ab, nahm die Socke aus dem Schuh und schüttelte sie. Auf dem ausgetretenen, festen Boden vor der Bank lag die erbsengroße Zecke. Sie hatte die Farbe einer Wacholderbeere.
Jakoba drückte sie mit dem Finger platt. Blut befleckte den Boden.
»Sie gehören zu den Gästen des Kompanie-Hauses? Ich sah den Reisebus«, fragte sie.
»Ja, zu den erfolgreichen Kandidaten der Meisterprüfung der Handwerkskammer von Mönchengladbach. Zur Belohnung unserer Büffeleien unternehmen wir eine Busreise durch Ostfriesland«, antwortete Josef Pilchrat, zog die Socke hoch, setzte seinen Fuß in den Schuh und richtete sich wieder her. Er fühlte sich hingezogen zu der hilfsbereiten jungen Frau.
»Spätdienst hat heute die Frisia-Apotheke in Großheide. Begleiten Sie mich nach Hause. Ich fahre Sie hin. Es ist nicht weit«, sagte Jakoba Boomfalk und errötete leicht, als Josef Pilchrat sie dankbar anschaute.
»Wenn Sie so nett sein wollen, wäre ich Ihnen sehr verpflichtet«, antwortete er.
Josef Pilchrat eröffnete in Korschenbroich mitten in der Neubausiedlung »Am Tömp« eine Schlachterei mit einem Versandhandel. Sein Spitzenprodukt, »Niederrheinischer Schinken«, erwies sich als ein Verkaufserfolg.
Der Zeckenbiss im Waldgelände seitlich des trüben Moorkanals in Berumerfehn hatte das gesunde Blut des frisch gebackenen Metzgermeisters dank der medizinischen Vorsorge seines »Engels« nicht vergiftet, dennoch schicksalhafte Folgen nach sich gezogen. Josef Pilchrat und Jakoba Boomfalk fanden zueinander.
Im selben Jahr, kurz vor Weihnachten, verstarb Kuno Boomfalk an Lungenkrebs. An seiner Beisetzung nahm auch Josef Pilchrat teil.
Alrich Boomfalk, der es als Bauingenieur in Perth zu Wohlstand gebracht hatte, nahm im Anschluss an die Beerdigung und der Erledigung der amtlichen undjuristischen Formalitäten, was niemand im kleinen Feriendorf für möglich gehalten hätte, seine trauernde Mama, die, das sei vermerkt, sehr an ihrem Sohnhing und sich in die Nähe ihres Enkelkindes wünschte, mit nach Australien.
Die Boomfalks verkauften die Gärtnerei samt Wohnhaus, Treibhäusern und fruchtbarem Hinterland an den Gärtnermeister Uwe Riemers.
Jakoba Boomfalk reichte beim Kreiskrankenhaus ihre Kündigung ein, beteiligte sich mit einem Teil ihres Erbes an der Schlachterei in Korschenbroich und heiratete ihren Josef im März 1958.
Jakoba Pilchrat, geborene Boomfalk, die ehemalige Krankenschwester, verlebte an der Seite des tüchtigen Unternehmers glückliche Jahre,wurde ihrem Mann zu einer verlässlichen Stütze des expandierenden Betriebes, den sie bereits nach Rheydt verlagert hatten und auf dem Industriegelände unterder Firmierung »JOPI-Fleischwarenfabrik GmbH & Co. K.G.« in neu errichteten Hallen mit modernen Maschinen betrieben. Sie beschäftigten 1966, als ihrSohn Georg geboren wurde, bereits 28 Mitarbeiter.
Die Pilchrats waren dafür bekannt, großzügig zu verfahren, wenn es um das Wohl ihrer Mitarbeiter ging oder, was zu ihrem Alltag geworden war, sie um Spenden für soziale und kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen zur Kasse gebeten wurden. Ansonsten lebten die Pilchrats bescheiden und traten nur selten in der Öffentlichkeit in Erscheinung.
1969 erblickte Tochter Maike das Licht der Welt. Jakoba widmete sich der Erziehung der Kinder. Von Beruf war sie Mutter, wie sie sich zu äußern pflegte. Eine Angestellte unterstützte sie bei der Haushaltsführung. Sie redete ihrem Mann nicht in die Geschäfte. Im Gegenteil, sie sorgte für Ablenkungen von seinem stressigen Management, kaufte Konzert-, Kino- und Theaterkarten und schleifte ihren Josef einfach mit.
Dank eines langjährigen Vertrages mit einer führenden rheinischen Lebensmittelkette erweiterte Josef Pilchrat 1981 die Fabrikationsanlagen und stellte weitere Mitarbeiter ein. Sohn Georg und Tochter Maike wuchsen zu ihrer Freude gesund und pflegeleicht heran.
Zur Beerdigung der Mama, Amanda Boomfalk war hochbetagt in Perth verstorben, flogen sie nach Australien.
Die Jahre flossen dahin, der Wohlstand mehrte sich, ohne die Bescheidenheit der Pilchrats zu berühren.
1988, an seinem 55. Geburtstag, ehrte die Stadt Rheydt Josef Pilchrat mit der Verleihung der »Kulturmedaille« für seine großzügigen, seit Jahren geleisteten Subventionen an das Stadttheater.
Sohn Georg, danach auch Tochter Maike, bestanden das Abitur und gaben sich dem Studium hin. Georg entschied sich für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Köln, Maike studierte in Göttingen Tiermedizin.
Beide schafften die Examina mit guten Noten.
Josef Pilchrat und Jakoba näherten sich dem Rentenalter. Sie schauten stolz auf ihr Lebenswerk zurück. Ihre Kinder bescherten ihnen weiterhin viel Freude. Sohn Georg stieg zum Marketingleiter bei den niederländischen »Kaasje-Fabriken« in Edam auf und stand auf Abruf bereit, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Tochter Maike leitete das Veterinär-Amt der Stadt Velbert.
Jakoba, im großen Bungalow an der Parkstraße mit gepflegter Gartenanlage, litt unter Einsamkeit, wenn Josef – das hatte Tradition – jeden Tag in seine Firma ging und seine Stammkunden noch persönlich aufsuchte.
Jakoba sehnte sich mit fortschreitendem Alter zurück nach Ostfriesland.
1995, an ihrem sechzigsten Geburtstag, erfüllte Josef ihr ihren dringlichsten Wunsch. Er begleitete seine Jakoba nach Berumerfehn. Sie nahmen einZimmer im Kompanie-Haus, suchten bei schönem Wetter die Bank auf und erinnerten sich an den Zeckenbiss. Die elterliche Gärtnerei existierte nichtmehr. Auf dem Grundstück befand sich ein Mehrfamilienhaus.
Bei der Suche nach einem Domizil in Ostfriesland fanden sie zu einem reetgedeckten Haus im benachbarten Westermoordorf, das neu errichtet zum Verkauf stand.
Das im Stil einer Kate gebaute, rot geklinkerte Haus befand sich, von Fichten, Holunderbüschen und knochigen Birken umstanden, etwa 100 Meter von der Brückstraße entfernt.
Die Auffahrt war gepflastert. Sträucher und ein fester Drahtzaun trennten das Grundstück rundum von den landwirtschaftlich genutzten Weiden.
Wie der zuständige Makler bei einer Besichtigung zu berichten wusste, war der Bauherr, ein Frauenarzt aus Braunschweig, der Wert auf eine historische Architektur gelegt hatte, kurz nach der Fertigstellung an Herzversagen verstorben.
Die Witwe beabsichtigte, sich von dem Anwesen zu trennen. Der Preis, so der Makler, lag unter dem tatsächlichen Wert des Hauses. Da gab es keinFeilschen, da stimmte alles, wie Josef Pilchrat und seine Jakoba feststellten. Sie kauften das schmucke Haus, sparten nicht an der Inneneinrichtung undschufen sich in Westermoordorf ein gemütliches Refugium als Alterssitz, doch vorerst als Ferienstation für ihre Fahrradausflüge inJakobas alter Heimat, wann immer es ihre Zeit erlaubte.
Sohn Georg stieg 1997 in die Firma ein, entlastete den Vater, der im Jahre darauf an den Folgen eines Schlaganfalls verstarb.
Jakoba Pilchrat, die 62-jährige rüstige Witwe, hatte ein gepflegtes Äußeres, kleidete sich elegant und jugendlich, ohne dabei den Blick in den Spiegel zu vernachlässigen. Sie hasste Weinerlichkeit und Selbstmitleid, fand auch in der Trauer um ihren Josef abgesteckte Grenzen. Sie blickte in Dankbarkeit zurück und mit Zuversicht nach vorne und glaubte an eine gute Zukunft für ihre Enkelkinder.
Während der tristen Schmuddeltage besuchte Jakoba ihre Tochter Maike in Velbert, die an der Seite ihres zuverlässigen Schwiegersohnes, Frank leitete die Zentrale der Stadtsparkasse, ihre beiden Töchter in der bewährten Familientradition großzog.
Ihre Besuche entsprachen ihrer inneren Einstellung und dauerten nie länger als eine Woche. Da half auch kein Zureden, wenn Sohn Georg und seine hübschen Buben auf sie einzureden begannen. Die Schwiegertochter, eine Diplomkauffrau, verfuhr mit der Betreuung der Enkel nicht immer in ihrem Sinn. Zugegeben, sie war tüchtig, doch für Jakobas Dafürhalten spielte sie zu oft Tennis und befand sich zu wenig in der Küche, wenn die Buben von der Schule nach Hause kamen.
Jakoba fühlte sich im Haus in Westermoordorf nie einsam. Sie hatte den teuren Mercedes ihres Mannes behalten, fuhr zu den Konzerten nach Emden, besuchte in Berum die Sauna, feierte mit den Saunaschwestern Geburtstage und empfing alte Schulfreundinnen zum Tee, die wie sie die sechzig überschritten hatten.
Sie schaute oft Fernsehen, las sehr gerne und sprach oft mit Josef. Wenn sie an kalten Tagen vor dem Kamin saß, in die tanzenden Flammen schaute, glaubte sie ihren Josef in der Nähe zu spüren. Sie war fest davon überzeugt, dass seine unsterbliche Seele oft bei ihr weilte.
Bis auf Bertus Poppen, der ihren Garten liebevoll pflegte, verzichtete Jakoba auf helfende Angestellte.
Der gleichaltrige Rentner besaß ihr Mitgefühl. Sie hatten ihn in der Volksschule wegen seines Buckels nicht nur gehänselt, schikaniert, sondern auch von ihren Spielchen und Spielen ausgeschlossen.
Bertus, Sohn einer schlampigen und verwirrten Mutter, die als Kuhmagd beim Landwirt Abbinga im Scheunentrakt damals gewohnt hatte, war ohne Vater herangewachsen. Die Mutter war eine exzellente Melkerin und Käserin gewesen und verstorben. Ohne Schulabschluss hatte sich Bertus Poppen, der weder lesen noch schreiben gelernt hatte, als Knecht und Gelegenheitsarbeiter bis ins Rentenalter verdungen. Er lebte in der abgewohnten, sich im Gemeindeeigentum befindlichen Moorkate, im Volksmund »Schuppen« genannt, die sich hinter dem Berumerfehner Wald im Moorgelände befand.
Bertus Poppen war bisher niemandem zur Last gefallen. Er kam mit der knappen Rente klar, die auf sein Konto überwiesen wurde, um das sich die Gemeindeschwester kümmerte, die den alten Sonderling betreute und nach dem Rechten sah.
Bertus Poppen bot in keiner Weise einen Anlass, ihn in ein Heim zu stecken.
Wenn Bertus Poppen unrasiert mit ungepflegten Haaren in abgetragener Drillichhose, nach vorn gebeugt, mit der Shag-Pfeife zwischen den Zähnen, im verwaschenen Baumwollhemd, das sich über seinen Buckel spannte, den Rasen mähte oder in den Beeten das Unkraut jätete, steckte Jakoba Pilchrat einen Fünfzigmarkschein zwischen hergerichtete Käse-, Wurst-, und Mettschnitten, fügte einen Apfel, eine Birne, Banane oder Orange je nach Jahreszeit hinzu, legte zwei Flaschen Bier hinein und trug das gefüllte Strohkörbchen in die Garage zu dem kleinen Abstelltisch, unabhängig von der Arbeitszeit des verlässlichen Gärtners.
Bertus Poppen betrat nie das Haus von Jakoba Pilchrat. Selbst bei Wind und Wetter und im stürmischen Regen besprach sich Jakoba mit ihm vor dem Haus oder in der Garage. Er nannte Jakoba Pilchrat »Gnädige« und hatte, wie sie annahm, die Schmach vergessen, die sie ihm mit ihren Schulfreundinnen während seiner Kindheit angetan hatte.
In Anbetracht der ansteigenden Kriminalität empfahl Sohn Georg, der in dem gesunden mittelständischen Unternehmen zurzeit 250 Mitarbeiter beschäftigte, der Mama, sich einen Hund zuzulegen. Er hatte Beziehungen zu einem Hundezüchter im Westfälischen. »Hasso, ein Schäferhund, Rüde, mit Stammbaum, zugerichtet, an die Haustür geliefert«, lautete seine Offerte.
Jakoba hatte weder Angst im Haus noch mochte sie Hunde. Sie belächelte den fürsorglichen Vorschlag ihres Sohnes.
Ob ein abgerichteter Schäferhund an ihrer Seite zur Vermeidung der Ereignisse, die sich an einem dunklen Dezembertag, während Schneeflocken den Rasenbedeckten, der Himmel mit schwarzen Wolken die ostfriesische Küste bedeckte, beigetragen hätte, das ist im Nachhinein schwer zubeurteilen.
Jakoba Pilchrat saß an diesem späten Samstagabend vor dem Kamin. Sie hatte geduscht, trug über ihrer Wäsche den molligen Bademantel und blickte in die lodernden Flammen. Sie nippte am Weinglas, stellte es ab und griff zu ihrem Fotoalbum, es handelte sich um den Band III, den sie beschriftet und fertig gestellt hatte. Jakoba hatte die in Kartons und Teedosen herumfliegenden Fotografien gesammelt und geordnet. Sie liebte es, sich an die Jahre mit Josef zu erinnern.
Bertus Poppen blieb im Edeka-Markt keine Mark schuldig, wenn er sich mit Bier und Corvit eindeckte, die Einkaufstaschen links und rechts an den Lenker seines Fahrrades hängte und sich auf den beschwerlichen Rückweg machte.
Am Möhlenkamp endete der gefestigte Weg. Von dort schob er das Rad über den von Waldfahrzeugen zerfurchten und mit Pfützen übersäten Feldweg nach Hause.
Die Gemeinde hatte den alten Ölofen entfernt und die Räume mit einer Nachtspeicherheizung versehen und den »Schuppen« im Vorgriff auf spätere bauliche Maßnahmen an die Kanalisation des Möhlenkamps angeschlossen.
Dort hatte die Gemeinde einen Wohnblock für die Unterbringung der ihr zugewiesenen Asylanten und Russlanddeutschen errichten lassen.
Unterkunft in diesem Mehrfamilienhaus hatten auch zwei junge Männer gefunden, es handelte sich um Vettern, die gebürtig aus Berumerfehn und Westermoordorf stammten. Sie waren 32 und 34 Jahre alt.