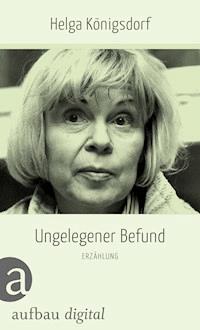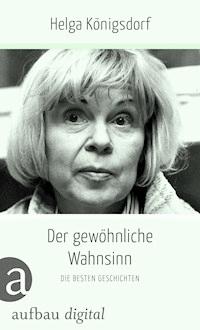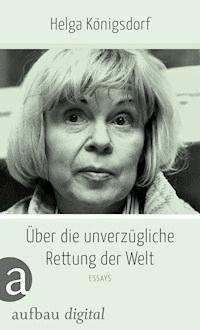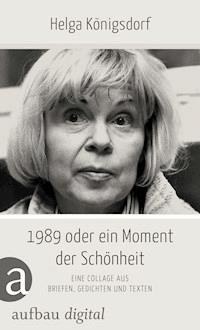
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"In diesem Jahr war es unmöglich, keine Gedichte zu schreiben, unmöglich, nicht zu lieben, unmöglich, keine Revolution zu machen. In diesem Jahr taumelten wir mit ungelenken Schritten in die Freiheit und fürchteten uns sehr. In diesem Jahr machten wir die Wirklichkeit zu unserem Kunstwerk und wurden schließlich doch in unsere Rolle verwiesen, wurden aus Helden wieder Toren. Irgendwann lief die Geschichte über uns hinweg."
Die Autorin, deren "in Ost und West erschienene Erzählungen", wie die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, "mit dazu beigetragen haben, das marode Land DDR erkennbar zu machen", ist dabei gewesen, aktiv und ungeheuer engagiert.
Ihr neuer Band fasst in diesem Jahr 1989 entstandene Gedichte, Texte, Reden und eine autobiographische Erzählung um die Ereignisse der Revolution in der DDR zusammen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
»In diesem Jahr war es unmöglich, keine Gedichte zu schreiben, unmöglich, nicht zu lieben, unmöglich, keine Revolution zu machen. In diesem Jahr taumelten wir mit ungelenken Schritten in die Freiheit und fürchteten uns sehr. In diesem Jahr machten wir die Wirklichkeit zu unserem Kunstwerk und wurden schließlich doch in unsere Rolle verwiesen, wurden aus Helden wieder Toren. Irgendwann lief die Geschichte über uns hinweg.«
Die Autorin, deren »in Ost und West erschienene Erzählungen«, wie die »Süddeutsche Zeitung« schreibt, »mit dazu beigetragen haben, das marode Land DDR erkennbar zu machen«, ist dabei gewesen, aktiv und ungeheuer engagiert. Ihr neuer Band fasst in diesem Jahr 1989 entstandene Gedichte, Texte, Reden und eine autobiographische Erzählung um die Ereignisse der Revolution in der DDR zusammen.
Helga Königsdorf
1989 oder Ein Moment Schönheit
Eine Collage aus Briefen, Gedichten, Texten
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Vorwort
Von der Schwierigkeit, »Ich« zu sagen
Standpunkt
Dichtung und Heimat
Das Prinzip Menschenwürde
Wiedergelesen
Resolution
Menschenwürde oder Der Schlaf der Vernunft
Ansprache
Berichterstattung über die Willenskundgebung
Zeit herziger Akklamationen ist vorbei
Anfang einer Poetikvorlesung
Der Partei eine Chance geben
Diskussionsbeitrag
Nachdenken über unseren Weg zu einem menschlichen Sozialismus
Der Parteitag ist nicht zu Ende
Solidarität
Bitteres Erwachen, Zwischenbilanz
In Sorge um meine Partei
Eindringlicher Ruf zur Gewaltfreiheit
Diskussionsangebot
Nachsatz (Gedanken nach der Wahl: Links – nun noch oder jetzt erst möglich)
Anmerkung
Über Helga Königsdorf
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Vorwort
Nach diesem Jahr werden Gedichte unmöglich sein. Nach diesem Jahr wird es keine Liebe und keine Revolution mehr geben. Wenn ich könnte, würde ich den Frühling verbieten.
In diesem Jahr gab es einen Moment, da waren wir alle sehr schön. Die nach uns kommen, werden die Ereignisse historisch betrachten. Sie werden ihn suchen, den roten Faden durch das Geäst der Zeit. Aber was sie finden, wird nicht das Eigentliche sein. Sie finden Akten oder modernere Dokumentationen. Sie werden entdecken, daß wir unsere Meinung änderten, aber sie werden nichts von dem Schmerz erfahren, dem Schmerz, an dem wir litten, als unsere Seele dem eiligen Verstand nicht mehr zu folgen vermochte. Nichts wird da geschrieben sein von unserer Einsamkeit, von unserer Angst. Von unserem Glück.
Diese Revolution war ein Kunstwerk. Sie begann sanft und ein wenig traurig. Später waren da auch die schrillen Töne. Jetzt erst, da alles vorüber ist, möchte ich schreien.
Das Spiel mit den Masken ist zu Ende. Ich taumele mit ungelenken Schritten in die Freiheit. Und es ist die Freiheit der anderen. Ich habe keine Verwendung mehr dafür.
Vielleicht sollten sie dies alles bedenken, später, wenn sie die Geschichte schreiben.
Von der Schwierigkeit, »Ich« zu sagen
Diskussionsbeitrag auf dem X. Schriftstellerkongreß der DDR
24. 11. 1987
Wir leben in einer maßlosen Zeit, so maßlos in ihrer Herausforderung, daß einem wohl der Atem stocken kann.
Die Gattung Mensch ist dabei, die Grundlagen ihrer Existenz zu erschüttern. Die Welt rückt zusammen, die Ressourcen werden knapp, die ökologischen Schäden mehr und mehr global und unumkehrbar. Angaben über das angehäufte Vernichtungspotential kann man zwar zur Kenntnis nehmen, aber es entzieht sich dem Vorstellungsvermögen. Die Waffen werden auf infame Weise »intelligenter«. Die Probleme, die entstehen, haben eine völlig neue Qualität, eine »teuflische«, wollte ich sagen. Aber das Wort paßt nicht. Es gibt überhaupt keine richtigen Worte dafür. Wichtiger scheint mir auch die Frage: Haben wir die passenden Antworten?
Die Lehren der Geschichte, die existierenden theoretischen Konzepte können lediglich Ausgangspunkte sein. So sehr war eigenes Denken, neues Denken nie gefragt, noch nie so lebensnotwendig für die Gattung. Ich glaube, man kann sich das Ausmaß der Bedrohung nur in Momentaufnahmen bewußtmachen – mir geht es jedenfalls so. Eine andauernde Schreckensvision hielte man nicht aus. Aber an der Frage, werden unsere Anstrengungen dieser Zeit gerecht oder sind unsere Entwürfe im Vergleich zu den Ungeheuerlichkeiten, die schon ganz nahe Zukunft sein können, nicht jämmerlich klein, an dieser Frage kann man sich nicht vorbeimogeln, an den Antworten werden wir gemessen werden. Wenn es dann noch Bemesser gibt.
Hier, wo es um Literatur geht, erhält diese Frage ihre eigene Brisanz. Von Literatur wird in unseren Ländern sehr viel erwartet, zu viel, könnte man sagen, aber das wäre bereits ein Zurückweichen. Ich glaube, die vornehmste Aufgabe von Literatur heute ist, zu ermutigen. Ich denke dabei nicht an den erschreckend weit verbreiteten irrationalen Optimismus, der aus Verdrängung entsteht, sondern vielmehr an eine neue Kassandra-Funktion von Literatur. Wobei ich das Wort »neu« betonen möchte. Nicht die Kassandra, die das Unheil weissagt und keinen Glauben findet, sondern eine Kassandra, die nichts beschönigt und die trotzdem ermutigt, sich gegen das Unheil zu wehren. Ich weiß um das schier Unmögliche dieses Anspruchs, der, hat man ihn erst formuliert, so belastend ist, daß Weiterschreiben fast unmöglich erscheint.
Aber, das mag seltsam klingen, vielleicht verhilft gerade die Tatsache zur Glaubwürdigkeit, daß man dem Leser nichts voraus hat. Man kann mit ihm zu einer Person verschmelzen. Man fühlt sich ausgeliefert, machtlos wie er, und braucht, genauso wie er, Trost. Man wird genauso beargwöhnt, Stabilität zu gefährden. Auch da, wo Stabilität nicht mehr angebracht ist. Man bleibt, wie er, Erziehungsobjekt, wird also nie ganz erwachsen. Informationen erhält man dosiert, eine Meinung frei Haus. Das ist auch irgendwie bequem. Es war bequem. Man hatte sich schon eingerichtet.
Bloß, in solchen Zeiten wie den unsrigen kommt unweigerlich der Punkt, wo man »Ich« sagen muß, und dann kann es geschehen, man stellt fest, gerade dies hat man nicht gelernt. Und es gebricht an Mut. Ja, es ist leichter, sich als Vertreter einer Institution, einer Organisation oder gar eines Landes zu fühlen, als einmal »Ich« zu sagen. Was ja nicht unbedingt im Widerspruch zueinander zu stehen braucht. Aber wir, die wir scheinbar die Dialektik mit der Muttermilch eingeflößt bekommen haben, vergessen das Dialektische nur allzugern. Ich halte es für einen dialektischen Vorgang, daß auch heute hier von diesen zweierlei »Ich« gesprochen wird. Welterfahrung ist nicht schmerzlos zu haben. Es ist verlockend, auf eine eigene Identität zu verzichten und in eine kollektive hineinzutauchen. Aber was ist eine kollektive Identität ohne eine Identität, die »Ich« einbringt!
Das Denken in seiner Elementarform ist noch immer kein kollektivierbarer Vorgang. Unsere Welt braucht »Ich« bei Strafe des Untergangs, und gerade das macht Leben heute, trotz der unbeschreiblichen Gefährdung, andererseits atemberaubend interessant.
Schreiben heißt für mich nicht: besser wissen, nicht: belehren. Wenn sich Aufklärerisches nicht vermeiden läßt, hat das außerliterarische Gründe. Schreiben heißt für mich, um ästhetische Formen ringen, die heutiges Weltbewußtsein mitteilbar machen. Das ist in höchster Weise nicht-trivial. Und nicht zuletzt heißt Schreiben für mich auch, gemeinsam mit dem Leser, »Ich« sagen. Und »Ich« sogleich wieder in Frage stellen. Es erneut, auf neue Weise also, mit kollektiver Identität konfrontieren und diese gegebenenfalls auch verändern. Das ist ein unbequemer Vorgang, und in diesem Sinn soll und muß meiner Meinung nach Literatur unbequem sein, muß unbequeme Literatur unter die Leute, auch in unbequemen Zeiten. Dann erst recht.
Karneval
Die Welt zieht eine Fratze
Was wert war ist verkommen
Tirili und Tanderadei
Der Traum von morgen ging vorbei
Das Paradies ward uns genommen
Am Mittwoch heißt es fasten
Die Hölle tanzt den Kehraus
Ungehört bleibt der Prophet
Tirili und Tanderadei
Wie lebt das Tollhaus sorgenfrei
Doch wenn der Rausch zu Ende geht
Am Mittwoch fällt’s in Asche
Weg mit dem Spuk der Masken
Gewogen wird die letzte Runde
Tirili und Tanderadei
Zeig dein Gesicht wie es auch sei
Noch gilt die Chance dieser Stunde
Am Mittwoch wär’s jedoch vertan
Standpunkt
Auf Wunsch der Redaktion des »Spektrums« – Zeitschrift der Akademie der Wissenschaften – verfaßt. Erhielt keine Druckgenehmigung.
Januar 1988
Wir erleben einen atemberaubenden »Qualitätssprung«. Die regionalen Probleme von gestern werden zu Gattungsfragen. Zu Überlebensfragen der Gattung Mensch. Die Ressourcen werden knapp. Die ökologischen Schäden zunehmend global und unumkehrbar. Die Waffen »intelligenter«. Das Tempo der Veränderungen ist schneller als je zuvor und weltweit.
Während ich diese Sätze niederschreibe, fühle ich eine innere Abwehr, so als gebrauchte ich zu große Worte. Es kostet Mühe, mich davon zu überzeugen, daß sie wirklich angemessen sind. Sie lassen mich klein und ausgeliefert zurück. Eigentlich brauchte man Ermutigung, um allein schon der Last der Tagesaufgaben gewachsen zu sein. Nur ist da das bohrende Gefühl der Diskrepanz. Als liefe die Zeit schneller und wir kämen nicht hinterher. Als würden unsere Entwürfe den Herausforderungen nicht gerecht. Flucht in einen ahistorischen Optimismus wäre allerdings tödlich. In der Vergangenheit ist durch Wissenschaft Machbares, zum Guten wie zum Bösen, im wesentlichen auch gemacht worden. Welche wirklich neue Qualität haben wir dem Mißbrauch entgegenzusetzen? Nur aus dem unentwegten Versuch, diese Frage zu beantworten, kann Ermutigung wachsen. Nur wenn dieser Versuch ernsthaft und überzeugend gewagt wird. Unter Einsatz des gesamten kreativen gesellschaftlichen Potentials.
Nur wenn kritisches Denken in voller Breite entwickelt ist, kann dieses Potential ausgeschöpft werden. Wissenschaft und Literatur sind – insofern ist ihr Zustand symptomatisch für Allgemeineres – Teile einer Kultur; wenn es gut steht, einer kritischen. Steht es gut? Entlarvend die Versuchung, ins gewohnte Schema zu verfallen: »Recht gut schon. Nur noch besser muß es werden.«
Stabilität auf Kosten von Effektivität ist langfristig eine Milchmädchenrechnung. Solche Stabilität kommt unweigerlich in die Klemme, weil ihr nicht das notwendige Entwicklungstempo innewohnt. Um den Anforderungen gewachsen zu sein, bedarf es starker Triebkräfte, also starker Widersprüche, die nicht durch Unterdrückung, sondern durch geeignete Austragungsmechanismen produktiv werden. Dazu gehört auch kritisches Denken.
Kritisches Denken? Allzu schnell verdächtigt. Selten genug öffentlich gemacht. Und wenn schon, erhält es hierzulande leicht etwas Amtliches. Ein spitzer Degen kann unter der Last von Verantwortungspyramiden unversehens zum plumpen Bumerang werden.
Wenn die Waffen nicht gar von Anfang an stumpf waren, wie es nicht selten im Umgang mit Literatur zu beobachten ist. Literatur enthüllt nicht nur das Weltgefühl des Autors, sondern in der Reaktion darauf auch etwas von der Wesensart des Lesers. Literatur ist subjektiv in diesem doppelten Sinn und nicht an die Normen von Wissenschaftlichkeit gebunden. Mit ihrer Sensibilität für Erscheinungen kann und sollte sie vorpreschen und unbequem sein. Wird sie aber als Vorhut allein gelassen, wird ihr gar alles mögliche angetragen, was ihre Sache nicht ist, gerät sie in eine zwielichtige Situation.
Wissenschaftler haben wegen ihrer besonderen Kompetenz eine besondere Verantwortung, die ihnen nicht abgenommen werden kann. Auch von Literatur nicht. Für Angst gibt es heute gute Gründe. Es ist keine Modeerscheinung, wenn sich die Fragestellungen umgekehrt haben und wenn nun nach Gründen für Nichtangst gefragt wird. Pessimismusvorwurf oder Jonglieren mit falschen Sicherheitswahrscheinlichkeiten ist als Antwort ungeeignet. Es muß der Mut entstehen, auch Ratlosigkeit zuzugeben. Denn es ist vielleicht der gefährlichste Mythos dieses wissenschaftlichen Jahrhunderts, wir könnten mit Hilfe der Wissenschaft jede Suppe auslöffeln, die wir uns einbrocken. Es ist deshalb so gefährlich, weil es die Dringlichkeit allseitigen gesellschaftlichen Handelns verdeckt.
Ohne die Wissenschaft säßen wir allerdings in einem Boot ohne Kompaß. Und auf dem Meer ist es schon ganz schön stürmisch. Wir werden die Ergebnisse der Wissenschaft dringend benötigen. Sie, bei aller Ambivalenz, zu verketzern wäre dumme Maschinenstürmerei. Im Gegenteil. Die Wissenschaftler brauchen Unterstützung. Auch die der Literatur. Steht doch die soziale Reputation der Wissenschaftler in Kontrast zu den hohen Erwartungen, die man an sie heranträgt. Müssen sich doch die jungen manchmal regelrecht verteidigen, wenn sie ihre Arbeit als Spaß empfinden. Sie dürfen fast jedes Argument anführen, um sich Freiräume zu schaffen, nur nicht ihre wissenschaftliche Arbeit. Was wiederum im Gegensatz dazu steht, daß der Weg zu höchsten wissenschaftlichen Leistungen eine Beanspruchung der Persönlichkeit mit sich bringt, die sich keiner Norm fügt.
Kritische Kultur heißt nicht Fronten aufbauen. Wem würden die denn nützen! Gemeinsam muß der Mut entstehen, den diese Zeit braucht. Ein Mut, der die begründete Angst nicht ausschließt, sondern aus ihr als Widerstand hervorgeht. Gemeinsam muß darüber nachgedacht und auch gestritten werden, was heutzutage Fortschritt bedeutet. Es geht offenbar nicht an, die wissenschaftlich-technische Revolution wie ein Naturereignis ablaufen zu lassen und sich nachträglich um die Folgen zu kümmern. Die wechselseitige Paßform von gesellschaftlichen Strukturen und Entwicklung der Produktivkräfte muß ständig neu durchdacht werden. Und natürlich entsteht sofort die Frage nach dem Ziel. Nach den Werten. Ein großes Feld für Wissenschaft und Literatur. Für jede auf eigene und doch gemeinsame Weise.
15. 1. 1989
Am 70. Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht fordern mehrere hundert Demonstranten in Leipzig das Recht auf freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Pressefreiheit, 80 werden verhaftet.
Mutter der rote Turm
Neigt sich
Fällt
Versinkt
Mutter hilf doch
Langsam schließen sich die Wasser
Als wäre nichts geschehen
Dichtung und Heimat
Auszüge aus einem Vortrag, gehalten in Marburg
22. 1. 1989
Es gibt Worte, die sind wie frisch gesottene, überzuckerte Krapfen. Nimmt man sie in den Mund, schmeckt man zuerst die Süße, und danach entstehen die Brandblasen auf der Zunge.
Ohne mir dessen bewußt zu werden, habe ich irgendwann »Heimat« aus meinem aktiven Wortschatz gestrichen. In der irrigen Annahme, mit der Ausmerzung eines Wortes sei auch alles, was sich darum rankt, erledigt.
Verbietet sich Heimat demnach? Ja, wie denn? Heimatlos? Oder nur als doppelte Negation ertragbar? Als nicht unbeheimatet?
Heimatlosigkeit als Schmerz. Ja sogar als Makel. Sie ist ja da, die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Geborgenheit. Woher kommt also meine Abwehr, mein Mißtrauen? Wieso die Angst vor der Vereinnahmung?
Heimat als Nichtgastsein. Heimat als Sichzugehörigfühlen. Heimat so verstanden, braucht keine Landschaft, kein Staatswesen, kein soziales Gebilde zu sein, kann aber von allem etwas an sich haben.
Mögliche Wurzeln verkümmerten, mögliche Quellen versiegten, ehe sie zum Fließen kamen. Gewinn? Nachträglich ist der Schreck vor der Gefahr endgültiger Einvernahme groß. Durch Geburt, irgendwo hineingeworfen, braucht dieser Ort nicht die Zugehörigkeit zu sein, die Entfaltung möglich macht. Heimat aufgeben kann wie eine lebenswichtige Operation sein.
Zugehörigkeiten drücken sich meistens in einer besonderen Sprache aus. Fast scheint es mir jetzt so, als hätten alle wichtigen Entscheidungen in meinem Leben etwas mit Sprache zu tun gehabt.
Immer, wenn ich über Zugehörigkeit spreche, wendet es sich alsbald und läuft auf Nichtzugehörigkeit hinaus. Und dann eine eigenartige Kühle. Eine Distanz.
Wo liegt die Wahrheit? Wenn ich Ihnen mehr Fragen als Antworten anbiete, ein Halbfabrikat sozusagen, so keinesfalls, weil ich faul war. Dieses Thema ist für mich eines von der Art, bei denen man nie zum Endgültigen vorstößt. Schon die Fragen traten mir aus schwer zu fassenden Gründen zu nahe. Diese Arbeit wurde zum Spiel gegen mich selbst. Am Ende, hier, bin ich, wie könnte es anders sein, Verlierer und Gewinner zugleich.
Ich war es auch damals, als Heimat aufgegeben werden mußte. Gewinner, weil ich es hinter mir ließ, dieses Tal, in dem der Horizont sehr nahe war. Weil ich zum erstenmal die Weite der Ebene erblickte. Verlierer, weil ich von nun an in der Gefahr lebte, in solcher Weite verlorenzugehen. Verlierer, weil ich äußere Identität einbüßte. Gewinner, weil innere Eigenständigkeit vonnöten wurde.
Die Lebensumgebung, die Interpretation von Geschichte, die Anforderungen der Arbeitswelt, die Familiensituation, Wertvorstellungen, Bezüge also, die vor nicht allzu langer Zeit über ein Menschenalter hin stabil blieben, wandeln sich immer schneller. Zugehörigkeit ist heute nichts Stabiles mehr. Sie muß immer wieder errungen werden. In den modernen Industriegesellschaften, in denen man mit relativer Leichtigkeit Ortswechsel vornimmt, oder diese jedenfalls psychologisch ins Kalkül zieht, der »Kietz« also etwas ist, das aufzugeben als jederzeit möglich erscheint, wird eine örtliche Verwurzelung schwieriger. Die meisten der Kinder sind, ehe sie erwachsen werden, mit ihren Eltern mehrmals umgezogen. Sie erleben Gegenden bereits als etwas Vorübergehendes. Auch ein Beruf, eine Ausbildung schafft keine dauernde Form von Zugehörigkeit. Es drohen Dequalifikation durch Einführung neuer Technologien und Verlust des Arbeitsplatzes. Selbst wenn sich eine Nische findet – ich bin noch niemandem begegnet, der sich in einer Nische auf die Dauer beheimatet gefühlt hätte.
Heimat ist demnach nichts Feststehendes. Heimat wird sich im Laufe des Lebens ändern. Und es ist eine Frage der Vitalität, ob Zugehörigkeit immer neu erschaffen werden kann. Im Alter oder in Zeiten von Krankheit und Schwäche ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit besonders groß. Gleichzeitig schwindet die Kraft, diese zu bewahren. Die äußeren Angebote sind häufig Ghettos.
Heimat ist für mich gefährlich wie eine Droge. Ich bin heimatsüchtig. Deshalb die Abstinenz. Oder doch wenigstens die Vortäuschung von Abstinenz durch Nichtbenennen.
Die Stufenleiter des Erfolgs – ausgeschöpft. Vieles, was ich einst in mir gespürt hatte – verdorrt. Meine Meinung nur scheinbar, nicht wirklich gefragt.
Meine Sehnsucht nach Zugehörigkeit hatte zur Selbstaufgabe geführt. Zur totalen Einvernahme.
Heimat setzt ein Subjekt voraus, das sich beheimatet fühlt. Objektiv gesehen, war alles beim alten. Wenigstens so ungefähr. Aber das Subjekt war verschwunden.
Auf den ersten Blick ist das Wort »deutsch« für mich ein rein sachliches. Gewiß, es ist nicht durch anderes ersetzbar. Aber damit steht es nicht allein. Lote ich tiefer, stoße ich auf Unbehagen. Es gleicht einem Körperteil, dessen man sich nicht entledigen kann, obwohl er nicht ganz so ist, wie er sein sollte, dessen man sich aber auch nicht entledigen möchte.
Ich war ein für die Endlösung vorgesehenes Objekt. Später, die Grenze fast vor der Haustür, schrieb ich brave Sätze über die »Einheit Deutschlands« in mein Schulheft, die mir die notwendigen guten Noten auf dem Zeugnis einbrachten. Der Schulchor sang den Rütlischwur. Bei den ersten Reisen in Nachbarländer war ich voller Scham. Zwar trug ich persönlich keine Schuld, aber ich trug an dem Wort »deutsch« im Ausweis.
Dann kam die Zeit, in der das Wort »deutsch« in Dokumenten und Briefköpfen durch »DDR« ersetzt wurde, was sich schlecht in Adjektivisches verwandeln ließ, so daß eine Inflation der Worte »wir« und »unser« einsetzte. »Unsere Menschen«. »Unsere Sportler«. »Unsere« Dichter? Vertraulichkeit und Herrschaftsanspruch. Die Wahrheit des Wirklichen ist nie einfach.
1. 3. 1989
Das P.E.N.-Zentrum der DDR setzt sich für die umgehende Freilassung von Václav Havel ein.
9. 3. 89
Liebe A.,
falls ich Dich telefonisch nicht erreiche, nur schnell zu Deiner Information: Ich war also bei der Abteilung Inneres. Bringe bitte B. schonend bei, daß sie vorläufig noch nicht bereit sind, ihn »an den Kapitalismus auszuliefern«. Sie wollen aber mit seiner Ärztin sprechen. Ihnen scheint bisher das rechte Schubfach zu fehlen. Vielleicht verlieren sie das Interesse an ihm, wenn sich herausstellt, daß er wirklich krank ist. Erst einmal wollen sie ihm eine Arbeit vermitteln.
10. 3. 89
Lieber Ch.!
Als Sie gestern gegangen waren, wurde mir ganz blümerant zumute. Vor allem wegen meiner Schwatzhaftigkeit. Ihre schöne Blume von neulich hängt nun mit einemmal ganz kläglich über den Vasenrand. Aber irgendwie bin ich auch sehr froh. Vielleicht, weil wir beide schüchtern sind.
Am Donnerstag sind wir Genossen des P.E.N.