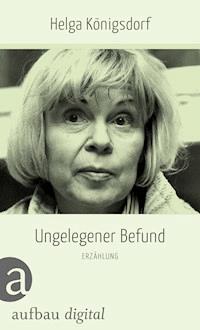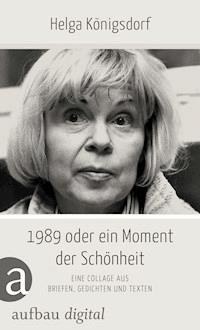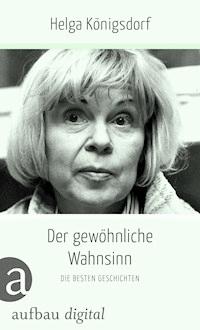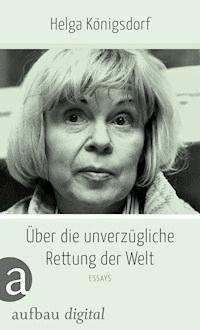9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Besonderes Kennzeichen: unauffällig", hätte für alle Zeiten im Steckbrief dieser Leute stehen können, wenn nicht aus heiterem Himmel Unvorhergesehenes geschehen wäre. Der geheimnisvolle Nachbar bringt Mamas Regime ins Wanken, der renommierte Professor riskiert den Aufstand, und die unbescholtene Hausfrau erwacht eines Morgens als Dichterin. Die gewohnte Ordnung ist aus den Fugen geraten, und hinter den Rissen offenbaren sich plötzlich die Lebenslügen. Wie dieser und jener in solchen heiklen Momenten seine Haut und seinen Seelenfrieden rettet, erzählt Helga Königsdorf in ihren grotesken und absurden Parabeln auf den menschlichen Hang zum Selbstbetrug. "Wer Ähnlichkeiten findet, muß Gründe haben", heißt die Warnung der Autorin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
»Besonderes Kennzeichen: unauffällig«, hätte für alle Zeiten im Steckbrief dieser Leute stehen können, wenn nicht aus heiterem Himmel Unvorhergesehenes geschehen wäre. Der geheimnisvolle Nachbar bringt Mamas Regime ins Wanken, der renommierte Professor riskiert den Aufstand, und die unbescholtene Hausfrau erwacht eines Morgens als Dichterin. Die gewohnte Ordnung ist aus den Fugen geraten, und hinter den Rissen offenbaren sich plötzlich die Lebenslügen. Wie dieser und jener in solchen heiklen Momenten seine Haut und seinen Seelenfrieden rettet, erzählt Helga Königsdorf in ihren grotesken und absurden Parabeln auf den menschlichen Hang zum Selbstbetrug. »Wer Ähnlichkeiten findet, muß Gründe haben«, heißt die Warnung der Autorin.
Helga Königsdorf
Der Lauf der Dinge
Geschichten
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Ehrenwort – ich will nie wieder dichten
Das Krokodil im Haussee
Die Wahrheit über Schorsch
Der unangemessene Aufstand des Zahlographen Karl-Egon Kuller
Pi
Wenn ich groß bin, werde ich Bergsteiger
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Eine kollektive Leistung
Meine zentnerschweren Träume
1 Das Haus
2 Der Holzladen
3 Der Operationssaal
4 Die Hippies
5 Die Konferenz
6 Der Wolf
7 Die Katze
Liriodendron tulipifera
Der todsichere Tip
Der Zweite
Autodidakten
Unverhoffter Besuch
Der kleine Prinz und das Mädchen mit den holzfarbenen Augen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Über Helga Königsdorf
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Wer Ähnlichkeiten findet, muß Gründe haben.
Ehrenwort – ich will nie wieder dichten
Hiermit gebe ich allen Anfragern, gleich, welche Motive, Vorstellungen oder Gerüchte sie bewegen, zur Kenntnis: Noch geht es mir gut. Allerdings bitte ich, den folgenden Bericht, in dem ich ehrlich und selbstkritisch darlegen werde, wie es zu jenen peinlichen Entgleisungen kam, vertraulich zu behandeln.
Der Zeitpunkt, an dem alles begann, ist ziemlich genau bekannt. Ich muß jedoch mit Bedauern eingestehen, daß ich über Ursache und Anlaß wenig zu sagen weiß.
An jenem trüben Aprilmorgen – ich bin sicher, es hat geregnet – stand es mit einemmal als unabänderliche Gewißheit im Raum: Ich war über Nacht zum Dichter geworden. Sonst hatte sich nichts verändert. Robert lag neben mir und demonstrierte seine Absicht, mit der Welt vorerst keine Verbindung aufzunehmen, indem er das Federbett über den Kopf zog und seine Füße gegen die Zimmerdecke richtete.
Meine Entdeckung erschien mir in keiner Weise erfreulich. Ich hatte bis dahin nicht die geringste Neigung zum Heldentum an mir beobachten können. Ich war eher ein ängstlicher Typ. Aber jeder Versuch, aufzubegehren, erwies sich als sinnlos. Wider Willen war ich auserwählt, hatte mich im Schlaf einer Schlange gleich gehäutet. Es kam mir vor, als hätte eine fremde Persönlichkeit von mir Besitz ergriffen, die mein klardenkendes Ich unaufhaltsam verdrängte. Am Frühstückstisch hatte sich das neue Wesen in mir bereits gemausert. Robert rührte in seinem Milchkaffee und sagte gedankenvoll: »Mach, was du willst.« Das war eine typische Robert-Antwort. Er wußte natürlich, ich würde sowieso machen, was ich wollte.
Unser Sohn, ein schönes Produkt einheitlicher Erziehung, saß dabei, hellhörig, flinkäugig wie ein kleines Nagetier, und träufelte Honig in die aufgewärmte Schrippe. »Mann«, mischte sich der Junge in unser Gespräch, wobei seine Stimme zwischen hohem Diskant und tiefen Knurrlauten schwankte. »Mann, warum machst’n das. Kannste nicht was Nützliches tun.«
Ich befand mich in einer mißlichen Lage. Immerhin war ich Leiterin eines sozialistischen Kollektivs, und man durfte von mir Vernunft erwarten, nicht solchen spätpubertären Unfug. Mein Lebenswandel war bis zu jenem Aprilmorgen auf der ganzen Linie vorbildhaft verlaufen.
Oberflächlich schien auch an diesem Tag alles wie immer zu sein. Ungemachte Betten. Schmutziges Geschirr. Roberts Gurgeln aus dem Badezimmer. Die Zeit, die davonrannte. Und zugleich war nichts wie sonst. Nach ungenügendem Nachtschlaf in stickiger Neubauluft als Dichter erwacht, konnte ich nicht einfach so tun, als sei nichts geschehen, es normal finden, meine Gefühle durch Gewohnheiten zu ersetzen. Eine gewisse Labilität meines Gemütszustandes war also nicht zu übersehen. Der Funke des Aufruhrs glimmte in meiner Seele.
Da ich weder tot noch ausländisch war, würde der Anfang schwer werden. Ich brauchte etwas, wogegen, und etwas, wofür ich dichtete, um gelesen und gedruckt zu werden. Später, im Zenit meiner Dichterlaufbahn, wurde ich oft nach meinem Anliegen befragt. Da es einen sehr schlechten Eindruck gemacht hätte, kein Anliegen zu haben, sagte ich immer viele kluge Worte. Zu Beginn meines Dichterlebens dachte ich jedoch darüber nicht nach. Hätte ich nämlich nachgedacht, wäre ich wahrscheinlich nie ein Dichter geworden. Ich hätte eine Eingabe gemacht, auf Versammlungen geredet, mich scheiden lassen, kurzum eine der Möglichkeiten genutzt, die dem normalen Menschen für ein Anliegen offenstehen. Je länger ich nachsinne, um so annehmbarer scheint mir die Hypothese, mein plötzliches zwanghaftes Dichten stehe im Zusammenhang mit einer langjährigen Denkabstinenz. Eines Tages öffnet das Unbewußte seine Schleusen, und die solange erfolgreich verdrängten Fragen brechen sich eine Bahn. Ich stand ziemlich ratlos neben mir.
Die Wahrheit, vor allem die eigene innere, ist ein kompliziertes Ding. Wir tragen sie wie Sedimentgestein in uns. Hinter jeder Schicht kommt eine neue, und ganz unten wird sie stets ein bißchen unangenehm. Deshalb ist es vielleicht gar nicht zweckmäßig, über sich selbst Auskunft zu geben. Auch sollten wir der Nachwelt eine Chance lassen, ihre Probleme in uns hineinzuinterpretieren.
Die Wochen, die jenem Aprilmorgen folgten, erscheinen mir in der Erinnerung als eine glückliche intensive Zeit. Die Verse strömten aus unerschöpflichem Springquell. Jeden, der hören wollte, und jeden, der nicht hören wollte, beglückte ich mit meinen Rezitationen. Bei Geselligkeiten saß ich in mich gekehrt. Der übliche Austausch über Abläufe und Fakten berührte mich nicht mehr. Ich wartete, bis jemand mich aufforderte, etwas Neues zum besten zu geben. Dann blühte ich auf, fühlte mich kraftvoll und herrlich. Der Kosmos lag auf meinen Schultern und wog schwer und leicht zugleich. Wenn ich beobachtete, wie sich die Gesichter meiner Zuhörer entspannten, wie sie sanfter wurden oder wie in sie ein neuer Zug nachdenklicher Entschlossenheit trat, verschwand meine innere Abwehr gegen meine Dichterexistenz endgültig.
Lediglich mein Sohn hörte mich nie an. »Ich halte mich da raus«, sagte der kluge Junge.
Die meisten meiner Bekannten fanden mich ein bißchen lächerlich. Zugleich meinten sie aber, auf Grund meiner beruflichen Leistungen könne man mir ein gewisses Maß an Narretei nachsehen. Hatten sie sich zu diesem Standpunkt durchgerungen, kam ihnen mein Treiben sogar recht vergnüglich vor. Da besaß jemand plötzlich den Mut, etwas von sich preiszugeben, gestand Sehnsüchte, Niederlagen und Ängste ein, über die man sonst nicht sprach. Wie durch eine geheimnisvolle Ansteckung war ich bald nicht mehr allein mit meinen Versen. Es brach um mich herum eine regelrechte Dichtepidemie aus.
Dies sollte sich alles ändern, sobald offenbar wurde, daß ich mit dem Dichten ernst machte.
Zu Papier brachte ich eine Ballade über einen Abteilungsleiter und ein Poem über meine große Sehnsucht nach Liebe. Gewisse Ähnlichkeiten ergaben sich wirklich nur, weil ich meinen eigenen Abteilungsleiter am besten kannte und weil ich mich damals in einem Zustand befand, in dem ich mich in schneller Folge in alle Männer meiner Umgebung verliebte.
Nach der Niederschrift meiner beiden Gedichte ging eine Veränderung mit mir vor. Eine merkwürdige Unruhe ergriff mich. Nachts erwachte ich schweißgebadet. Ich war seit zwanzig Jahren gewohnt, mir für alles, was ich schrieb, die Genehmigung meines Leiters einzuholen. Das ließ sich nun nicht einfach abtun. Als mir Robert schließlich eine Stelle im Arbeitsgesetzbuch zeigte, die mich geradezu verpflichtete, dem Abteilungsleiter ein Geständnis abzulegen, empfand ich eine große Erleichterung.
Der Abteilungsleiter erbleichte. Ich erlebte einen der seltenen Momente, in denen er gern nicht der Abteilungsleiter gewesen wäre. Er hatte keine hohe Meinung von Dichtern. Sie waren ihm zutiefst wesensfremd. Er sah in ihnen selbstgefällige, haltlose Menschen, die mit Sicherheit einem schlimmen Ende zusteuerten. Die Umgebung mußte nur darauf bedacht sein, nicht in den dabei entstehenden Strudel hineingezogen zu werden. Deshalb schrieb er umgehend einen Bericht an den Direktor. Da der Direktor nur ein sehr kleiner Direktor war, würde eine Weile vergehen, bis jemand erreicht war, der die Verantwortung tragen konnte.
Ich las in der Seele des Abteilungsleiters wie in einem aufgeschlagenen Buch, hätte ich doch selbst nicht anders empfunden, wäre es um einen meiner Mitarbeiter gegangen.
Die Redakteurin, der ich meine beiden Gedichte anbot, begeisterte sich vor allem für meine Liebeslyrik. Ich vermute, auch diese Frau trug geheime unerfüllte Wünsche mit sich herum. Sie legte mein Manuskript dem Chefredakteur mit dem Vermerk »Emanzipationslyrik« vor, woraufhin dieser angewidert die Nasenflügel blähte und, ohne zu lesen, »einverstanden« darunter schrieb. Später muß er es aber doch gelesen haben, denn die Redakteurin wurde in die Abteilung »Verkehrsunfälle« versetzt, was der schnellen Verbreitung meiner Gedichte nicht zum Nachteil gereichte.
Über das Aufsehen, welches mein lyrisches Schaffen erregte, kann ich nur sehr ungenau berichten. Mit Sicherheit gelangte mir nur die Spitze des Eisbergs zur Kenntnis.
An einem Spätsommersonntag saß ich mit Robert am Mittagstisch. Er schluckte eine größere Menge Simagel und stocherte lustlos in seinem Kotelett. Auch wenn ich Probleme hätte, so begann er, sähe er doch keinen zwingenden Grund, diese unter die Leute zu bringen. Dieses Thema variierte er mannigfaltig im Crescendo. Am Ende forte: Es wäre geradezu eine Zumutung, andere Menschen mit meinem ungeordneten Innenleben zu belästigen.
Dichter aller Zeiten hätten nichts anderes getan, verteidigte ich mich.
»Ja Dichter!« schrie Robert, »aber du! Du bist meine Frau!«
Wir saßen uns stumm gegenüber und wußten, daß wir das gleiche dachten, synchron, wie in den vielen Jahren, bis ich mit dem Dichten begonnen hatte. Die Dichter vergangener Epochen sind fast immer Männer gewesen. Ihre Frauen durften sich als Musen betätigen oder hatten ihnen den trivialen Alltag vom Leib zu halten. Lösten sie diese Aufgabe gut, fiel ein schwacher Abglanz des Ruhmes auf sie. Aber uns fehlt jegliche historische Einstellung zum Ehemann einer Dichterin, und ich litt sehr darunter, daß ich Robert diese Schmach nicht ersparen konnte.
Unser Sohn machte die wichtige Erfahrung, daß Sichraushalten nicht immer Draußenbleiben bedeutete. Ein Ausspruch seiner Deutschlehrerin, wahre Dichter seien das Gewissen ihrer Nation, beunruhigte ihn sehr. Soviel er auch grübelte, er konnte keinen Sinn in diesen Satz bringen und vermutete eine versteckte Drohung. Am schlimmsten erging es meinem Abteilungsleiter. Er saß in einer Zwickmühle. Protestierte er, bekannte er sich als getroffen. Schwieg er, konnte man ihm nachsagen, meine Dichterei genösse seine Duldung.
Es gab Leiter aller Ebenen, die mit ihm fühlten. Sie sahen in meinen Gedichten schlichten Verrat.
Der Direktor hingegen hatte kein Mitleid mit ihm. Er sagte, es wäre eine Sauerei, wenn sich die Leiterin eines sozialistischen Kollektivs die Fingerspitzen eines Mannes, der nicht ihr eigener sei, auf allerlei unanständigen Teilen ihres Körpers vorstellte. Das heißt, vorstellen könnte sie sich, was sie wollte, aber sagen dürfte sie es nicht. Ein fähiger Abteilungsleiter hätte das verhindern müssen. Obwohl mein Abteilungsleiter seine Unschuld beteuerte und meine Bestrafung verlangte, wurde seine längst fällige Beförderung zurückgestellt. Dadurch fühlte sich vor allem sein Stellvertreter in der Laufbahn behindert.
Der Stellvertreter hielt sich für einen kunstverständigen Mann. Er vermisse in meinen Gedichten jedes konstruktive Element. Mit Randproblemen würde ich von der täglichen Auseinandersetzung ablenken. Meine Dichtung sei weder sonderlich neu noch sonderlich ästhetisch, sagte er. Man könne alles bereits in der Klassik nachlesen, und zwar besser.
Überraschend kamen meine Geschwister aus Mecklenburg und Thüringen zu Besuch. Wir sahen uns selten. Bei Jugendweihen und Silberhochzeiten. Dann renovierten sie ihre Häuser und kauften neue Teppiche.
Mein großer Bruder, der Ingenieur, war ein selbstbewußter Mensch, der häufig den technischen Direktor vertrat. Die Bücher in seiner Schrankwand hatte er zur Konfirmation oder als Auszeichnungen erhalten. Manchmal nahm er sie in die Hand, las die Widmungen und sagte gerührt: Wie die Zeit vergeht.
Mein jüngerer Bruder, der Agronom, seufzte: Woher sollten Leute wie wir für so etwas Zeit nehmen. Er sagte »Leute wie wir« mit einem deutlichen Unterton des Stolzes.
Meine Brüder waren die emsigsten Menschen, die ich kannte, und ich hatte großen Respekt vor ihnen. Sie saßen steif in meinen Drehsesseln, die in unserer Familie üblichen, etwas zu kurzen Arme auf die Oberschenkel gestützt, und sprachen über die Zukunft ihrer Kinder. Ich gestehe, es dauerte eine Weile, bis ich begriff, was dies mit mir zu tun hatte, ja, daß diese Zukunft geradezu von mir abhängig gemacht wurde.
Sag doch selbst, seufzte meine Schwägerin, wer kann sich schon eine dichtende Tante in den Kaderakten leisten.
Es belastete mein Gewissen sehr, daß ich die Menschen, die mir nahestanden, derart in Schwierigkeiten brachte. Ich fühlte eine unbehagliche Unsicherheit. Es gab Leute, die mich plötzlich nicht mehr kannten. Stets mußte ich gewärtig sein, daß meinem freundlichen Entgegenkommen eisige Ablehnung zuteil wurde. Der Abteilungsleiter, sein Stellvertreter und der Direktor beobachteten mich aufmerksam. Sie machten aus ihrem Verdacht keinen Hehl, ich schöpfe mich für meine Arbeit nicht voll aus. Ich war gewiß, irgendwann würden sie mich bei einer Verfehlung ertappen. Aber im Inneren erfüllte mich eine unerschütterliche Festigkeit, wußte ich doch, ich hatte keine Wahl gehabt. In jenen Herbstwochen erwachte auch mein Interesse für Dichter vergangener Epochen, ich fand manch Tröstliches in ihren Schicksalen. Wenn ich ganz ehrlich bin, verspürte ich sogar ein eigenartiges Glücksgefühl. Ich glaube, es hat ein schwacher Abglanz des inneren Glorienscheins großer Märtyrer über mir gelegen.
Ein renommierter Verlag schloß einen Vertrag mit mir ab, nach dem ich einen Vorschuß erhielt und verpflichtet war, innerhalb eines Jahres einhundertachtundneunzig weitere Gedichte in druckreifer Form abzuliefern.
Dieser Vertrag vermittelte mir zugleich eine nicht unwesentliche Einsicht: Um als Dichter ein mittleres Existenzniveau – etwa das eines Leiters eines sozialistischen Kollektivs – zu erreichen, müßte ich täglich fünfeinhalb Gedichte dichten. Ich dachte an die Mühe, die mir meine beiden ersten Dichtungen bereitet hatten, ich dachte an das gespannte Verhältnis zu meinem Abteilungsleiter und an die Scheidungsklage, die Robert einreichen wollte. Nachts wälzte ich mich schlaflos auf meinem Lager.
In meiner Not sagte ich zu, für das Studio Gegenwartsfilme und für ein Fernsehspiel Drehbücher zu schreiben. Ein bekanntes Kulturjournal bestellte bei mir ein Poem über die freundliche Briefträgerin von nebenan.
Dann erschienen die ersten Rezensionen.
Ich war von meinen beiden Gedichten überzeugt. Für so gut aber hatte ich sie nicht gehalten. Eine Besprechung begann: Soeben sind die von Kennern mit großer Spannung erwarteten ersten beiden Gedichte eines neuen Lyrikbandes erschienen. Und sie endete: Damit setzt die Künstlerin Maßstäbe für die Dichtung unseres Landes.
Ich las die Zeitungen nur noch daraufhin, ob etwas über mich darin stand. Eine Illustrierte dokumentierte meinen künstlerischen Werdegang in Wort und Bild.
In zwei Monaten bestritt ich dreiundzwanzig Lesungen und Diskussionsabende. Ich sprach über meine Schreibantriebe in sieben Rundfunksendungen.
Diese Entwicklung blieb nicht ohne Auswirkung auf meine Umgebung. Robert wies jetzt bei passenden Gelegenheiten auf das schwere Los hin, Ehemann einer Dichterin gewesen zu sein. Sogar der Direktor brüstete sich mit gebührender Vorsicht, in seinen Reihen würden von jeher künstlerische Talente gefördert. Aber mein Sohn und der Abteilungsleiter gaben ihre Zurückhaltung nicht auf.
Mein Sohn befürchtete, sie müßten sich im Deutschunterricht mit mir beschäftigen, wodurch er es mit allen seinen Freunden verdorben hätte. Der Abteilungsleiter blieb bei seinen düsteren Prognosen und gab mir den heimtückischen Rat, zum Gegenstand meiner nächsten Ballade den Direktor zu erwählen.
Eines Abends lag ich auf der Couch, ein Kognakglas in der Hand. Ich sah mich auf dem Bildschirm mit dem Moderator an einem Kamin sitzen und locker und selbstsicher über meine Zukunftspläne plaudern. Ich hatte Mühe, mich sympathisch zu finden. Ich schaltete den Fernsehapparat ab und trank die Kognakflasche leer.
Am Morgen, als ich erwachte, wußte ich es sofort: Meine Dichterzeit war vorüber. Ich fühlte mich leer und ausgebrannt. Mir fiel überhaupt nichts mehr ein, worüber ich dichten sollte. Ich kam mir jetzt ungemein albern vor. Ein schlimmer Katzenjammer brach über mich herein.
Ich blieb der Arbeit fern, streifte ziellos durch unbekannte Straßen, bis der Abend kam und die Bogenlampen durch knallende Relais gezündet wurden. Aus den U-Bahn-Schächten stieg warme Luft. Es war Winter geworden. Fröstelnd kehrte ich in einer Kneipe ein und geriet in eine Runde zechender Männer. Sie bewirteten mich mit Bier und Korn. Mein Name schien ihnen vollkommen unbekannt. Das war sehr tröstlich. Nach dem vierten Doppelten beichtete ich, daß ich eine berühmte Dichterin sei, die plötzlich nicht mehr dichten konnte.
Dichten ist Scheiße, sagte ein hagerer Alter mit Raubvogelgesicht. Die richtigen Anmeldungen mußt du haben. Für einen Betonmischer zum Beispiel.
Wozu brauchst denn du einen Betonmischer, fragte ihn ein vierschrötiger Mann mittleren Alters, dem die Kuppe des rechten Zeigefingers fehlte und zu dem ich sofort Zutrauen faßte.
Brauch ich doch gar nicht. Aber kannste prima vertauschen, mit Wertausgleich, erwiderte der Alte.
Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie alles ablief. Der Vierschrötige war auf einmal in einem heftigen Zornausbruch aufgesprungen und überschüttete mich mit derben Schmähungen. Ein Glück für mich, daß ich eine Frau wäre, schrie er. Andernfalls würde er mich verprügeln.
Mein Heimweg verlor sich völlig aus meinem Gedächtnis. So viel aber ist sicher, ehe ich die Kneipe verließ, hatte ich dem Vierschrötigen versprochen, ein neues Leben zu beginnen und mir in seinem Betrieb Arbeit zu suchen.
Im nüchternen Zustand versetzte mich diese Idee durchaus nicht mehr in solche euphorische Begeisterung, doch fiel mir kein anderer Ausweg ein. Ich begab mich zum Direktor, um ihn über meinen Vorsatz zu informieren, solange meine Entschlußkraft ausreichte.
Da kam mir der Zufall zu Hilfe. Das Vorzimmer war unbesetzt. Der Direktor telefonierte in seinem Zimmer mit einem anderen Direktor. Ich entnahm einer Schachtel einen Kopfbogen, spannte ihn in die Maschine und schrieb einen Brief an meinen Abteilungsleiter. »… ist der Mitarbeiterin das Dichten strengstens zu untersagen. Damit kein Problemfall entsteht, empfehle ich, für angenehme Arbeitsbedingungen Sorge zu tragen.«
Ich schob den Brief in die Unterschriftenmappe des Direktors.
Das Krokodil im Haussee
Widersprüchlich ist der Mensch. Aus dem engvertrauten Kreis drängt es ihn hinaus. Alle Dummheiten seines Lebens lastet er Vater, Mutter, Frau oder Kindern an. Ist er endlich draußen und muß für sich selber geradestehen, wird es ihm wohl sauer, und er sehnt sich zurück. Es ist ihm eigentlich nie recht zu machen.
Wir waren eine intakte Familie. Und so sollte es immer bleiben.
Zum harten Kern gehörten Mama, Papa, mein Bruder Hermann-Michael, mein Sohn Tommi und ich. Peter nicht. Nicht mehr. Tante Carola auch nicht. Und alles, was danach kam, nach Tante Carola also, erst recht nicht. Wir waren sehr für Abgrenzung.
Jenseits der Familiengrenze gab es nur Erfolgsmeldungen und Optimismus. Papas Krankheit war höhere Gewalt. Einladungen gingen hinaus, wenn es etwas vorzuführen galt. Ein neuer Teppich. Oder das Motorboot. Aber soweit sind wir noch nicht. Diese Geschichte beginnt viel früher.
Unsere Wohnung lag in einer ruhigen Nebenstraße mit vierstöckigen Altbauten. Die ewigen schwarzen Flecke vom Kohleanfahren auf dem Gehweg und der bröckelnde graue Putz verliehen der Gegend etwas Schmutziges. Im Winter sammelten sich Papierreste zwischen den kahlen Sträuchern der Vorgärten. Trotzdem fühlten wir uns in der Straße zu Hause. Jene Straße war nicht von einer Dimension, welche die Seele vergewaltigt. Hier wußte noch einer vom anderen. Die Alteingesessenen grüßten sich. Und wir gehörten zu den Alteingesessenen.
Damals schätzten wir das alles nicht besonders. Wir fühlten uns von nachbarlichen Augen und Ohren bis in unsere geräumige Wohnung mit dem schwer durchschaubaren Grundriß und den hellhörigen Wänden verfolgt. Es gab Themen, über die nur geflüstert wurde. Über Geld beispielsweise. Laute Streits trug man sich nicht wegen ihres Gegenstandes nach, sondern wegen der Bloßstellung vor Frau Ingenieurökonom Neumeister oder Herrn stellvertretenden Abteilungsleiter Gerwald. Aber im großen und ganzen führten wir ein harmonisches Familienleben.
Das spielte sich vor allem im Eßzimmer ab. Die Stuckgirlanden an den hohen Zimmerdecken. Mamas Meißner in der Vitrine. Unsere angestammten Plätze. Der kleine Balkon. Ausblick in Hinterhöfe und Gärten mit schönen alten Bäumen. Alles war immer dagewesen. Gehörte zu uns. Von Anfang an. Würde immer dasein.
Jedes Zimmer hatte seinen Namen. Das Schlafzimmer meiner Eltern hieß einfach »das Schlafzimmer«. Kirschbaumfurnier. Tagesdecke und Übergardinen aus dem gleichen ziegelfarbenen Seidenstoff. Ein mannshoher Spiegel. Geöffnete Fensterflügel. Alles beruhigend kühl. Eine feuchte, etwas muffige Kühle. In einem solchen Raum war Sexualität nicht vorstellbar. Geschlechtliches brauchte mit den Eltern nicht in Verbindung gebracht zu werden.
Mit meinem Zimmer auch nicht. Nicht mehr, seit Peter wieder von uns fortgezogen war. Nach seiner Gastrolle, aus der Tommi hervorging. Mein Sohn Tommi, dem das Nebenzimmer zugesprochen wurde und der durch seine kleine brüllende Existenz »das Arbeitszimmer« allmählich in »das Kinderzimmer« umwandelte.
Schmale Räume mit Ausblick auf die Brandmauer. Trotzdem ein Wunder an Behaglichkeit. Es war Mamas Idee, die Wände mit Sackleinwand auszuschlagen. Sie markierte die Stelle für den Stahlstich, links neben meinem Schreibtisch. Und es hatte keinen Sinn, sich aufzulehnen, denn die Idee war gut und die Stelle genau die richtige.
Mama war stark. Nichts brachte sie in Verlegenheit. Sie gehörte zu den Menschen, die zu Großem berufen sind, wenn es die Situation erfordert, und die bis dahin an dem Platz im Leben, auf den es sie verschlagen hat, ihre Rolle spielen. Ein bißchen zu perfekt vielleicht. Unangreifbar. Gegen den Vorwurf der Selbstgerechtigkeit gefeit. Weil sie immer im Recht sind. Mit einer unheimlichen Energie, die selten ansteckend wirkt. Öfters niederdrückend. Lähmend.
Mama die Seele unserer Familie zu nennen, würde die Lage nicht vollkommen charakterisieren. Mama war das Hirn, die Galle, die rechte Hand und was sonst noch alles lebenswichtig ist. Mama unterstand auch die Außenpolitik. Sie besorgte die Handwerker. Sie hatte Beziehungen. War Not am Mann, reparierte sie Staubsauger und Abflußrohre selbst. Sie wußte, was einem jeden von uns guttat. Ihre Fürsorge und Liebe waren grenzenlos. Als ich mein Studium begann, las sie abends in meinen Büchern. Um mit mir im Gespräch zu bleiben, wie sie es nannte. Keiner von uns konnte sich vorstellen, ohne Mama diesem Leben gewachsen zu sein.
Hinter der Küche lag das Zimmer meines jüngeren Bruders, mit einem separaten Aufgang vom Hof. Immer, wenn ich mich an meinen Bruder in dieser Zeit zu erinnern versuche, klingen mir seine endlosen Fingerübungen, vermischt mit Küchengeräuschen, im Ohr. Mit etwas größerer Anstrengung bringe ich noch ein blasses, sommersprossiges Jungengesicht zustande. Alles andere bleibt undeutlich, verschwommen, hat keine Kontur hinterlassen. Auch nicht seine unmotivierten Wutausbrüche.
Ich sehe Mama am Küchentisch stehen, mit ihren kräftigen Händen den Kuchenteig kneten und durch die geöffnete Tür die Klavierübungen meines Bruders überwachen. Legato! Wiederholung! Takt! Cis! Ciiisss! Dabei drückte sie die Masse in eine Backform und belegte sie mit Apfelscheiben. Im Küchenschrank stand ein alter Messingwecker, auf dem die tägliche Übungszeit eingestellt war. Hin und wieder schob mein Bruder seinen Kopf durch den Türrahmen, in der Hoffnung, die Zeit könne bereits abgelaufen sein.
Hermann-Michael hat Talent. Und Talent verpflichtet. Sagte Mama. Man gibt ihm eine Chance, und eines Tages wird sein Name um die Welt gehen. Und auch ich habe dazu beitragen dürfen.
Bei Familienfeiern bildeten die kleinen Konzerte meines Bruders Höhepunkte. Mama bewegte sich wie ein Dompteur, der eine besonders gelungene Dressurleistung vorführt. Tante Carola fiel es sichtbar schwer, Beifall zu klatschen. Ihr dürft das nicht krummnehmen. Sagte Mama. Wie bitter muß es sein, wenn es die eigenen Kinder zu nichts gebracht haben.
Solange mein Bruder ein kleiner Junge war, begleitete ihn Mama zu jeder Unterrichtsstunde in die Musikschule. Einmal fand ein Vorspiel statt, und ich mußte Mama vertreten. Die Lehrerin, eine finstere, ehrgeizige Person, nahm meinen Bruder beiseite und flüsterte: Reiß dich zusammen, sonst kannst du was erleben. Dann schob sie ihn in den Saal, wo Lehrer und Eltern versammelt saßen. Mein Bruder kam als vorletzter an die Reihe und – verspielte sich. Die Lehrerin gab uns zum Abschied nicht die Hand.
Hermann-Michael war ein stilles, schüchternes Kind. Aber manchmal warf er sich zu Boden und trommelte mit den Fäusten auf die Erde. Einmal zertrümmerte er Mamas Lieblingsvase und trampelte darauf herum. Mama konsultierte verschiedene Spezialisten, die sich jedesmal als Dummköpfe erwiesen. Sie verlor jedoch nie den Mut. Unbeirrt glaubte sie an das Talent meines Bruders, putzte die Scherben vom Boden, setzte sich an das Klavier und sprach mit ihm das nächste Stück durch.
Als mein Bruder erwachsen wurde, bestand er darauf, die Tür zur Küche geschlossen zu halten. Er baute sogar einen Riegel ein. Obwohl Mama es verbergen wollte, spürten wir doch, wie sehr sie litt. Vom häufigen Weinen waren ihre Augenränder entzündet. Wir warfen Hermann-Michael Undankbarkeit und Grausamkeit vor. Mama war die erste, die ihm verzieh. Einem Künstler, sagte sie, müsse die Möglichkeit geboten werden, sich gänzlich zu versenken.
Später sahen auch wir anderen ein, daß es gut war. Nur so konnten wir Hermann-Michaels Ausscheiden aus der Musikhochschule vor Mama verheimlichen. Irgendwann nämlich begann mein Bruder, an einer neurotischen Verkrampfung der rechten Hand zu leiden. Er brauchte sich nur an ein Klavier zu setzen, und schon befiel eine eigenartige Taubheit seinen Arm. Keiner von uns brachte es über das Herz, Mama die Wahrheit zu sagen.
Öffnete man unsere Wohnungstür, schlug ein strenger Baldrianduft nach außen. Das kam von unserem Papa.
Die Familie bietet Zuflucht und Schutz. Allein bleibt der Mensch ohne Wärme und Sicherheit. Das sollte auch unser Papa begreifen.