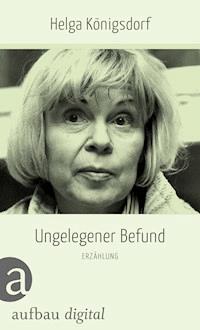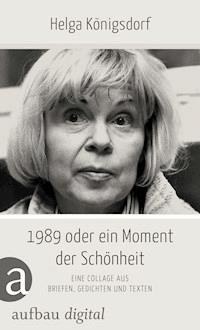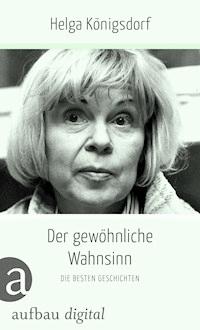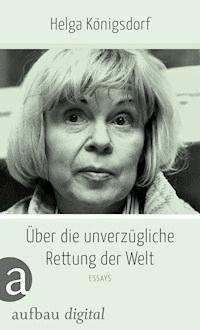9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem persönlichsten Buch erzählt Helga Königsdorf von sich und ihrem Leben. Ein Jahr vor Kriegsausbruch geboren, wächst sie als behütete Tochter in einem kleinen thüringischen Dorf auf. Die energische Mutter mit der Vorliebe fürs Gutbürgerliche spricht in der Wir-Form, wenn sie die Tochter meint: "Wir können nicht zeichnen" oder: "Wir mögen keine Zärtlichkeiten". Der Vater, ein erfindungsreicher Kleinunternehmer, später Landwirt, als Sohn einer jüdischen Mutter wehruntüchtig, als Bauer aber kriegswichtig, kommt in der DDR in die absurde Situation, sich als Großbauer selbst zu enteignen und fortan wissenschaftlich zu arbeiten. Die Familie zieht in die Stadt, das abenteuerliche Dorfleben ist damit für die Tochter vorbei. Keine Unternehmung kann ihr nun riskant genug sein, bis der Höhenflug durch einen Absturz beim Segelfliegen gestoppt wird. Aber es bleibt dabei: sie wählt immer den unüblichen, den unbequemen Weg, sucht immer die Herausforderung. So fällt die Entscheidung für ein Physikstudium, dann für die Karriere als Mathematikerin. Sie ist ehrgeizig und leidet unter dem schlechten Gewissen, wenn die Zeit für die Kinder zu knapp ist. Krisen in der Ehe kommen dazu und heftige Liebesaffären, die von der Partei gestoppt werden. Ein Sprung ins Wasser ist der Entschluß zu schreiben. Es sind freche, aufmüpfige Geschichten, für die sie ein dankbares Publikum findet, während sich die Zustände im Land, für deren Reformierung sie sich engagiert, immer weiter erstarren. Die Krankheit, die seit vielen Jahren unerkannt ihren Körper lähmt, hat einen Namen bekommen: Parkinson. Nun nimmt sie den Kampf um ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben auf. In der Zeit der Wende sind ihre Tage und Nächte ausgefüllt mit politischen Aktivitäten, die alle ihre Kräfte herausfordern. Dann wieder der Alltag: in einer neuen Ordnung, mit neuen Strukturen und mit der fortgeschrittenen Krankheit. Zum Widerstand dagegen gehört die plötzlich entdeckte Fähigkeit zum Malen. Die Wohnung hängt voller Bilder, unten ihnen sitzt sie mit dem schwerhörigen Herrn G. und spielt Schach, ehrgeizig und trotzig wie immer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
In ihrem persönlichsten Buch erzählt Helga Königsdorf von sich und ihrem Leben. Ein Jahr vor Kriegsausbruch geboren, wächst sie als behütete Tochter in einem kleinen thüringischen Dorf auf. Die energische Mutter mit der Vorliebe fürs Gutbürgerliche spricht in der Wir-Form, wenn sie die Tochter meint: »Wir können nicht zeichnen« oder: »Wir mögen keine Zärtlichkeiten«. Der Vater, ein erfindungsreicher Kleinunternehmer, später Landwirt, als Sohn einer jüdischen Mutter wehruntüchtig, als Bauer aber kriegswichtig, kommt in der DDR in die absurde Situation, sich als Großbauer selbst zu enteignen und fortan wissenschaftlich zu arbeiten. Die Familie zieht in die Stadt, das abenteuerliche Dorfleben ist damit für die Tochter vorbei. Keine Unternehmung kann ihr nun riskant genug sein, bis der Höhenflug durch einen Absturz beim Segelfliegen gestoppt wird. Aber es bleibt dabei: sie wählt immer den unüblichen, den unbequemen Weg, sucht immer die Herausforderung. So fällt die Entscheidung für ein Physikstudium, dann für die Karriere als Mathematikerin. Sie ist ehrgeizig und leidet unter dem schlechten Gewissen, wenn die Zeit für die Kinder zu knapp ist. Krisen in der Ehe kommen dazu und heftige Liebesaffären, die von der Partei gestoppt werden. Ein Sprung ins Wasser ist der Entschluß zu schreiben. Es sind freche, aufmüpfige Geschichten, für die sie ein dankbares Publikum findet, während sich die Zustände im Land, für deren Reformierung sie sich engagiert, immer weiter erstarren. Die Krankheit, die seit vielen Jahren unerkannt ihren Körper lähmt, hat einen Namen bekommen: Parkinson. Nun nimmt sie den Kampf um ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben auf. In der Zeit der Wende sind ihre Tage und Nächte ausgefüllt mit politischen Aktivitäten, die alle ihre Kräfte herausfordern. Dann wieder der Alltag: in einer neuen Ordnung, mit neuen Strukturen und mit der fortgeschrittenen Krankheit. Zum Widerstand dagegen gehört die plötzlich entdeckte Fähigkeit zum Malen. Die Wohnung hängt voller Bilder, unten ihnen sitzt sie mit dem schwerhörigen Herrn G. und spielt Schach, ehrgeizig und trotzig wie immer.
Helga Königsdorf
Landschaftin wechselndem Licht
Erinnerungen und Gedichte
Das ist ja gerade das Tolle am Leben: Was auch darüber gesagt oder geschrieben wird, es ist immer anders gewesen.
H. K.
Für Christel Dobenecker,ohne deren stille, kluge Hilfe dieses Buch nicht wäre.
Inhalt
Informationen zum Buch
Aus gutem Hause
Das eigentliche Leben
Die Tür zum Glück
Eine Frau von Format
Diagnose
Ein unterirdisches Dröhnen
Wende
Spiel mit Masken
zwischen lichtem land und ganz verloren gedichte aus zwei jahrzehnten
Über Helga Königsdorf
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Aus gutem Hause
»SCHACH!« SAGE ICH. Ich habe meine Streitmacht in Stellung gebracht. Die Bauern vorn. Dann die Herren Offiziere. Die linke Seite, der Damenflügel, spielt in meiner Strategie eine untergeordnete Rolle. Der Aufwand, den ich dort treibe, ist nur ein Täuschungsmanöver. Mein Angriff kommt von rechts. Dort habe ich für Turm und Läufer freie Bahn geschaffen. Die beiden Springer, die sich gegenseitig Deckung geben, bilden eine unbezwingbare Festung, die das Mittelfeld beherrscht. Nachdem ich gezogen habe, richte ich mich auf und blicke in das Gesicht des Mannes, der mir gegenübersitzt. Ich sehe die roten Äderchen in der Nasengegend und die Lachfalten in den Augenwinkeln. Ich liebe ihn. Und wie ich das denke, erfüllt mich eine ruhige Heiterkeit. Einen Moment bin ich ganz sicher, daß er mich liebt. Selbst wenn er es nie sagt. Plötzlich weiß ich, daß ich es nur glauben kann, weil er es nie sagt.
Ich provoziere: »Es sieht nicht gut aus. Für dich.« Und ich meine das Schachspiel. Er erwidert: »Auf den Zug habe ich gewartet.« Und schlägt meinen weißen Läufer.
Noch lebe ich mit allen Sinnen. Trotz der Leiden, die mir auferlegt sind. Trotz des körperlichen Verfalls, den ich nun schon fast ein halbes Menschenalter hinnehmen muß. Manchmal bin ich glücklich. Ich lache gern. Und manchmal bin ich mutlos und schwach. Ganz normales Leben, zu dem der Tod keine Alternative ist.
Meine Erinnerung ist ein Schatz, den ich in mir trage. Bilder, Gefühle. Das Geräusch der Dreschmaschine im Sommer. Der Geruch frischer Butter. Der erste Schrei meiner Kinder. Übermut. Aber auch Verlegenheiten und Ängste. Eine nicht mehr erklärbare Schwermut. Und die Kraft der Zärtlichkeit.
Meine Erinnerung ähnelt einer Landschaft in wechselndem Licht. Manches längst Vergangene strahlt hell und ist voller Konturen. Anderes ist der Dunkelheit anheimgefallen, ist nicht mehr aufrufbar, obwohl es einst für mich von einer gewissen Bedeutung gewesen sein muß. Manchmal streicht ein Luftzug über die Gegend. Dann kann es wohl sein, daß eine schon verloren geglaubte Erinnerung wieder auftaucht. Fast wie ein Schatten. Sobald ich sie aber halten will und genauer hinsehe, zieht sie sich zurück, wie ein Traum, der mich gerade noch gefangenhielt und der in einem Moment Unaufmerksamkeit während des Erwachens plötzlich verschwunden ist.
Es gibt auch Zwielichtiges. Zurechtgerücktes. Erinnerungen, denen ich selbst nicht traue. Ich bin überzeugt, daß die kleinen Lügen, oder besser: die kleinen Korrekturen der Wirklichkeit, und das Vergessen für mich ihren Sinn hatten. Mein Verstand hat sich verweigert, um die Seele zu schützen.
Jetzt ist alles anders. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Und gerade das gibt mir eine ungeahnte neue Freiheit. Ich darf mich getrost umsehen. Ich kann nichts mehr verderben.
Ich wollte immer ein schöner alter Mensch werden und stellte mir das ganz einfach vor. Ich brauchte bloß gut zu sein. Das Gute würde sich in meinem Gesicht widerspiegeln.
Das Schlimmste an dieser Krankheit ist, daß ihr Erscheinungsbild geistige Dumpfheit signalisiert. Und das betrifft alle Möglichkeiten sich mitzuteilen. Das Sprechen, die Mimik, die Körpersprache, die Schrift, selbst die Sprache der Augen. Sogar Menschen, die es besser wissen müßten, geben einem keine Chance. Alle meine Signale stehen im glatten Widerspruch zu meiner Behauptung, geistig frisch zu sein. Nur das Schachspiel mit Herrn G. hat etwas Objektives. Wir spielen beide mit Verbissenheit, denn jeder will gewinnen, um den Angriff auf seine Würde, dem jeder auf seine Weise ausgesetzt ist, abzuwehren.
Der Spiegel ist gnadenlos. Schaue ich hinein, sehe ich das Gesicht einer Fremden. Einer Frau, deren Blick schon ins Leere geht. Einer Frau, die bereits die letzte Einsamkeit einhüllt. Einen Moment hoffe ich, es wäre ein Alptraum. Aber ich träume nicht. Diesmal nicht.
Manchmal fürchte ich mich sehr. Aber ich habe noch etwas vor. Habe noch etwas zu erledigen. Noch bin ich mit dem Leben im Bunde und will nicht loslassen. Ich will mich umwenden und zurücksehen. Und was immer sich herausstellen mag, ich habe inzwischen eine gewisse unerschütterliche Vorliebe für mich selbst.
Alle sieben Jahre erneuert der Mensch seine Zellen. Ich habe nichts mehr gemein mit dem Kind, das ich einst war. Was ist geblieben?
Der Versuch zurückzublicken bereitet mir Schmerzen. Ich kenne den Grund nicht. Ich weiß nicht einmal, ob es ein heutiger Anlaß oder eine intensive frühere Erfahrung ist, an die ich mich nicht mehr erinnere, die aber in mir ist und das alte Schmerzmuster wieder aufruft. Ich spüre auch sofort die Lust zum Spotten. Die Fähigkeit, in der Tragödie das Komische zu sehen. Das war vielleicht das Wichtigste in meinem Leben. Es war das, was mich immer wieder gerettet hat.
Als ich fünf Jahre alt war, schrieb meine Mutter in ihr Tagebuch: »Helga ist ein freundliches Kind, das gerne lacht. Man bekommt mit ihr überall schnell Kontakt. Nur manchmal hat sie einen eigenen Willen.«
ALS ICH EIN Kind war, wohnten wir in einem Gutshaus. Die Leute vom Dorf nannten es das Schloß. Sie sagten, die Grundmauern wären 800 Jahre alt. Wenn man in den Keller hinunter mußte, war man vor Gespenstern nicht sicher. Immer wieder behauptete jemand, er habe den Reiter ohne Kopf gesehen. Eigentlich glaubte ich nicht an Gespenster. Wenn ich aber die steile Treppe hinabstieg und vor mir den Torbogen zum Kohlenkeller sah, wäre ich gern umgekehrt. Dieses Gefühl verstärkte sich, wenn rechts die Tür aus dicken Bohlen zu Mutters Vorratskeller kam und links die Tür mit dem schweren eisernen Riegel, hinter der eine schmale Treppe nach unten in den riesigen Kartoffelkeller führte. Alles lag im trüben Licht mit Staub bedeckter Glühbirnen, die in einfachen Fassungen an der Decke angebracht waren und den Raum nicht voll ausleuchteten. Da brauchte nur noch irgendwo eine Maus zu rascheln, schon stand ich starr und meine Nackenhaare sträubten sich vor Schrecken.
Das Haus stand auf einer Anhöhe. Aus den Fenstern auf der Nordseite sahen wir ins Tal der Saale, die hier am oberen Ende des Stausees immer noch eine stattliche Breite hatte. Sie wand ihr schwarzes Wasser kurvenreich durch Felsmassive aus graublauem Schiefer, vorbei an steilen Hängen, auf denen im Frühsommer Margeriten, Wiesenknopf, Pechnelken und Glockenblumen leuchteten, vorbei an düsteren Fichtenwäldern, aus denen im Winter weißer Nebel aufstieg.
An der Südseite des Hauses lag der Hof, wo, in angemessener Entfernung zum Haus, von einer hohen Mauer umgeben, ein großer Misthaufen dampfte. Sein Fundament war wohl mit der Zeit undicht geworden. Das erklärte die kleinen Quellen, die unterhalb des Tores aus der Erde sprudelten und die einen verdächtigen Jauchegeruch verbreiteten. Die Straße zum Tal säumten hohe Brennesselstauden, deren Blätter, fein gehackt, unter das Futter der Küken und der jungen Gänse gemischt wurden. Die Dächer aller Gebäude, die zum Hof gehörten, waren mit blauem Schiefer gedeckt. Der Hof wurde, vom Haus aus gesehen, rechts und gegenüber, durch zweistöckige Gebäude begrenzt. Die Mauern der Obergeschosse bestanden aus rot-schwarzem Fachwerk. Unten sah man rechts die Türen zum Milchhaus, zum Waschhaus und zu den Garagen für die beiden Traktoren. Oben wohnten Umsiedler und Leute, die auf dem Hof arbeiteten.
Gegenüber befanden sich die Ställe für die Kühe, die Schweine und die Pferde. Im Obergeschoß lagen der Heuboden und die verschiedenen Speicher. Die Gewölbe im Unterbau ließen auf ein hohes Alter des Gemäuers schließen.
Den Abschluß links bildete die große Scheune, deren Wände aus dunklem Holz gefügt waren. Auf der Tenne stand die Dreschmaschine, ohne deren Summen ein Sommertag nicht vollständig gewesen wäre. Auf der Ostseite befanden sich die Remisen. Dort standen die landwirtschaftlichen Geräte, die Leiter- und die Kastenwagen, die Kutsche und der Pferdeschlitten.
Mein Großvater hatte das Haus Ende der zwanziger Jahre vollkommen umgestaltet. Er hatte es mit modernem Komfort ausgestattet und mit Turm, Erker und Zinnen schmücken lassen.
Für mich hatte das alles etwas Beständiges. Obwohl ich doch nur meine Kindheit dort verlebte, hatte ich ein starkes Heimatgefühl. Als ich wegging, wußte ich, daß es ein Abschied für immer war. Das Dorf war auf die Dauer kein Ort für mich. Aber ich habe mich nie wieder so beheimatet gefühlt wie dort.
Der Hof war eine Welt für sich. Hier herrschte tagsüber buntes Treiben. Wir Kinder spielten mit Puppen oder mit den jungen Katzen. Wir tobten trotz des strengen Verbotes in der großen Scheune. Wir malten Kästchen auf die Erde, warfen kleine Steine hinein und sprangen mit beiden Beinen hinterher. Auf dem Hausboden spielten wir Tischtennis. Im Winter trafen wir uns mit dem Rodelschlitten am Weg, der steil hoch zum Bahnhof führte.
Einmal war eine Cousine meines Vaters mit ihrer Tochter, die etwa in meinem Alter war, zu Besuch. Ihre Namen habe ich vergessen. Ich weiß nur noch, daß wir die Tochter Süße nannten, weil ihre Mutter sie so rief. Uns wäre es unvorstellbar peinlich gewesen, so gerufen zu werden.
Süße stand auf dem Hausstein, mit sauberen weißen Strümpfen, einem Dirndlkleid und einer Schleife im Haar. Sie roch nach einer Mischung aus Parfüm und Pipi.
Ich lud sie ein mitzuspielen. Aber Süße schüttelte den Kopf. Sie durfte sich nicht schmutzig machen. Wir hätten es gern gesehen, wie sich Süßes Strümpfe unseren anpaßten. Unsere Strümpfe waren grau oder braun und mehrfach gestopft. Meistens hatten sie ihren Besitzer schon mal gewechselt. Zum Mitspielen war es nun zu spät, denn Süße und ihre Mutter reisten ab. Mein Vater hatte seiner Cousine am Tag zuvor erklärt: »Du fährst morgen mit dem ersten Zug, der Anschluß hat. Und solltest du hier noch mal auftauchen, zeige ich dich an.« Ich hatte in dem großen Ledersessel gesessen, wo sie mich nicht bemerkten.
»Dieses Flittchen, mißbraucht unsere Gastfreundschaft für ihre dunklen Geschäfte«, sagte mein Vater später zu meiner Mutter.
»Und bringt sogar ihr eigenes Kind in Gefahr«, entrüstete sich meine Mutter.
In meiner Phantasie sah ich Süße und ihre Mutter in einer Zelle hocken, vor sich einen Becher mit Wasser und eine Scheibe trockenes Brot.
»Du kannst vielleicht gar nicht spielen«, provozierte ich Süße auf dem Hausstein. »Wo solltest du in Berlin auch spielen.« Meine Vorstellungen von der Großstadt waren trostlos, kein Baum, kein Strauch, aber jede Menge Hundehaufen. »In Berlin spielen wir genausogut und besser, det könnt ihr mir glauben«, widersprach Süße.
Da zählten wir alles auf, alle Orte, die es überhaupt gab, auch die Wälder und die Felsen, aber Süße war durch nichts zu beeindrucken. Sie schüttelte nur lächelnd den Kopf. Als wir unser Pulver schon verschossen hatten, kam sie mit ihrem Trumpf heraus: »Und in Berlin haben wir die Ruinen.«
Das saß. Darauf waren wir nicht gefaßt gewesen. Süße nutzte unsere Verblüffung und wurde zum erstenmal gesprächig. Sie erzählte von zusammenstürzendem Mauerwerk und von einem Schieberlager voller Schokolade, die sie unter sich aufgeteilt hätten. Und davon, wie sie eine Leiche gefunden hatten und von der Polizei verhört worden waren. Wir saßen auf der Mauer, die den Hausstein umgab, und staunten. Erst hatte ich die Sache mit der Schokolade am tollsten gefunden, neigte dann aber mehr zu der Leiche, schon wegen des Verhörs durch die Polizei.
»Hat die Leiche gestunken?« fragte ich, doch da kam ihre Mutter mit einem Koffer, und die beiden verschwanden grußlos durch das Tor. Am Abend suchte ich im Lexikon nach dem Wort Flittchen.
Meine früheste Erinnerung habe ich in einem Traum gehabt, der anders war als meine sonstigen Träume. Alles war sehr deutlich. Ich wußte beim Erwachen sofort, daß es kein normaler Traum gewesen sein konnte, sondern daß es eine Erinnerung sein mußte. Ich saß unten im Hausflur auf dem Topf, und eine Frau mit nicht sehr sympathischer Stimme lobte mich. Die Tür ging auf. Leute kamen herein.
Ich wäre gern vom Topf gerutscht, aber ich hatte schon die Erfahrung, daß solch ein Versuch für mich nicht gut ausging. Hinter einer halb geöffneten Tür hörte ich ein anderes Kind. Ich konnte nicht sehen, was es trieb. Aber ich beneidete es, daß es hinter der Tür sein durfte und sich nicht zu schämen brauchte.
Als ich meine Mutter befragte, erzählte sie, daß unten im Parterre ein Ingenieur eingezogen war, den mein Vater eingestellt hatte. Dieser hatte einen Sohn in meinem Alter. Er war das Kind aus meinem Traum, das hinter der Tür sitzen durfte. Die Frau des Ingenieurs und meine Kinderfrau standen im Wettbewerb, welches Kind eher sauber würde. Die Kinderfrau war mit mir kurz vor dem Ziel, als meine Großmutter Anna Emma Lina sie fristlos entließ, wozu sie gar nicht befugt war. Aber sie hatte gesehen, wie die Kinderfrau mich schlug, und das hatte sie empört. Durch diesen Vorfall kann ich meinen Traum oder, besser, meine Erinnerung zeitlich einordnen. Weil die Kinderfrau noch anwesend war, mußte es eine Erinnerung sein, die vor meinen ersten Geburtstag zurückreichte.
Die Ursprünge meiner nächsten Erinnerungen liegen viel später. Zum Beispiel die Erinnerungen an die Nächte in den Luftschutzkellern. Vor solcher Wirklichkeit konnte ein anständiges Gespenst nur neidvoll erblassen. Das Gespenst, das uns nachts in die Keller trieb, hieß Krieg. Auch als der Krieg zu Ende war, hockten wir verängstigt unten. Diesmal erschienen keine Gespenster, diesmal kamen die Amerikaner.
Meinen Vater trieb die Unruhe hinaus. Er blickte in jeden Winkel, ob alles in Ordnung war, und wollte schon ins Haus zurückkehren, als zwei amerikanische Soldaten in der Einfahrt auftauchten. Einer trug ein kurzes Gewehr, schußbereit, den Finger am Abzug. Mein Vater, der auf sie zuging, rief schon von weitem: »How do you do?« Das schien ihnen verdächtig. Als er näherkam, hob der mit dem Gewehr die Waffe. Meinem Vater, der stehenblieb, fiel nichts Besseres ein, als zu wiederholen: »How do you do?« Aller guten Dinge sind drei. Und als er seine Beschwörung zum drittenmal hergesagt hatte, nun schon mit einem Ton der Ungeduld in der Stimme, fingen die beiden an zu lachen. Mein Vater verstand nicht, was es da zu lachen gab. Er schwieg verdutzt. Als sie sein Gesicht sahen, lachten sie erst recht. Dann wurde der ältere der beiden plötzlich ernst. Er sprach sehr gut deutsch. Nachdem sie eine Weile ernsthaft miteinander geredet hatten, ernannte er meinen Vater zum neuen Bürgermeister.
Mein Vater und meine Mutter hatten immer gestritten, wer besser englisch spräche. Das war nun endgültig entschieden. »Wichtig ist nicht das, was man in der Schule lernt«, sagte mein Vater, »sondern daß man im entscheidenden Moment das Richtige zu sagen weiß.«
Manchmal trieben im Fluß Leichen an, die nicht identifiziert werden konnten. Sie wurden nach gründlicher Begutachtung auf dem Friedhof beigesetzt. Namenlos. »Sicher Soldaten, die nach Hause wollten«, sagte meine Mutter. Es gehörte zu den Pflichten des Bürgermeisters, daß er die Toten ansah. »Ich bin froh, daß ich damit nichts mehr zu tun habe«, sagte mein Vater. Ansonsten war er gern Bürgermeister gewesen. Von den Amerikanern ernannt, hatten ihn die Russen im Sommer gleich wieder abgesetzt. Die Siegermächte hatten den Westteil von Berlin gegen Thüringen getauscht.
Der neue Bürgermeister kam aus dem Osten, dorther, wo jetzt Polen war. Er sagte von sich, er wäre schon immer Kommunist gewesen. Es gab einige Leute, die behaupteten, sie hätten etwas anderes gehört. Aber sie sagten das bloß im Flüsterton, hinter vorgehaltener Hand. Sie konnten es nicht beweisen.
Bevor die Russen kamen, fuhr ein Lastwagen, gefolgt von zwei Limousinen, in den Hof. Ein Mann sprang heraus. Es war ein Geschäftspartner meines Vaters. Einer von denen, die vorgesorgt hatten und die sehr geeignet waren, aus dem sinkenden Schiff ein Wunder zu machen. »Laden Sie auf! Es muß aber schnell gehen. Überall Niemandsland. Die Amis weg. Die Russen noch nicht da. So eine Chance kommt nie wieder«, sagte der Mann mit eindringlicher Stimme.
»Gehen Sie mit. Die Russen stellen Sie und Ihre ganze Familie an die Wand!« mischte sich der Litauer ein, der hinzukam, um sich von meinen Eltern zu verabschieden. Er war bei uns für die Pferde zuständig gewesen.
»Aber warum denn nur?« fragte mein Vater.
Als die Autos ohne uns abgefahren waren, stand mein Vater, die Hand noch zum Winken gehoben, auf dem Treppenpodest vor unserer Haustür und sagte zu meiner Mutter: »Denen bin ich nicht gewachsen.« Er meinte seine Geschäftsfreunde, die kein Risiko scheuten. Mein Vater aber war ein braver Bürger, der sich manchmal heimlich nach einem kleinen Beamtendasein sehnte.
Im Herbst begann die Schule wieder. Im Klassenbuch stand beinahe hinter der Hälfte aller Namen: Vater gefallen oder Vater vermißt.
Für mich war der Krieg das Normale gewesen. Es war normal, daß Väter verlorengingen. Für meine Eltern sah das Normale anders aus. Es hieß: vor-dem-Krieg. Vor-dem-Krieg mußte alles besser gewesen sein. Wie besser, wurde mir vielleicht am deutlichsten, als meine Mutter im Keller das Regal ausräumte, in dem die Weinflaschen lagerten, die vor-dem-Krieg geleert worden waren. Ich saß auf dem Hof in einer Ecke und hatte mich mit den interessantesten Flaschen umgeben: Es gab schlanke und dicke, stolze und dumme, liederliche und geheimnisvolle Flaschen, die man sich als Flaschenpost auf abenteuerlichen Reisen vorstellen konnte. Flaschen, die Lust bereiteten, wenn man sie nur anfaßte. Es hätte gar nicht der bunten Etiketten und der wohlklingenden Namen bedurft. Von da an glaubte ich ohne weiteres, daß meine Eltern eine andere Normalität als ich erlebt hatten.
Als ich noch sehr klein war, fragte ich nicht, wie es kam, daß wir in diesem Schloß lebten. Alles war, wie es war. Schien immer so gewesen zu sein.
Bis mir mein Vater eines Tages zeigte, wo er als Kind gespielt hatte.
Es muß in jenem heißen Sommer, zwei Jahre nach Kriegsende, gewesen sein, der so trocken war, daß kein Grashalm wachsen wollte und die fast verhungerten Kühe, weil sie zu schwach waren, vom Liegen wieder auf die Beine zu kommen, im Stall an die Decke gehängt werden mußten. Schlachten war streng verboten.
In diesem Sommer war der Fluß zu einem schmalen Rinnsal geschrumpft. Man hatte den Stausee abgelassen. Ich ging an der Hand meines Vaters über den rissigen, stinkenden Schlamm, auf dem Schwärme von Fischen lagen, die uns einäugig anglotzten. Sie sahen sehr hübsch aus. Mein Vater blickte besorgt den Vögeln nach, die ihre Beute weit davontrugen, und sagte zu mir: »Hoffentlich gibt es keine Seuche.« Ich war sehr stolz, wenn mein Vater mit mir wie mit einer Erwachsenen sprach. Ich wußte zwar nicht, was eine Seuche war, aber ich stellte mir darunter etwas Schlüpfriges vor, etwas, was man nicht halten konnte, was überallhin drang.
Wir gingen über die Behelfsbrücke zur anderen Seite der Saale. Dort, wo gegenüber in halber Höhe der Zug in den Tunnel einfuhr, stiegen wir einen steilen Pfad empor, bis zu einer Stelle, von der man eine gute Aussicht hatte. Mein Vater zeigte hinunter und sagte: »Dort unten habe ich als Kind gespielt. Erkennst du die Reste des Mühlgrabens?« Ich erkannte nichts, ich sah nur Schlick. »Und dort haben wir gewohnt.« Mein Vater wies auf niedriges Gemäuer, in dem Wasser stand. Dann zeigte er mir, höher, eine gut gewachsene Eiche. Die Hochzeitseiche meines Großvaters.
Ich war nicht sehr konzentriert beim Zuhören. Ich wußte nicht, was ich von der Erzählung meines Vaters halten sollte. Wollte er mich verkohlen? Er konnte doch unmöglich als Kind in dem Wasser gelebt haben. Ich mochte es gar nicht leiden, wenn man mich für dumm verkaufen wollte.
Als ich ihm das gesagt hatte, erzählte er mir die Geschichte von Urgroßvater Anton, der das Dorf entdeckt hatte.
Was ihn in die gottverlassene Gegend führte, ist nicht überliefert. Vielleicht war es ein Abstecher. Vielleicht wollte er den Tunnel der neuen Eisenbahnlinie besichtigen.
Damals bestand das Dorf aus kleinen, mit Schiefer gedeckten Häusern, die malerisch über den Wiesenhang verstreut lagen. Öffnete man die Haustür, schlug einem Stallgeruch entgegen. Auf der rechten Seite blökte und gackerte es. Schafe, Ziegen, Hühner und Kaninchen hatten dort ihr Domizil. Linker Hand kam man zur Küche. Am Fenster standen in hölzernen Kübeln Porzellanblumen und Myrte. Die Katze lag auf der Ofenbank. Obwohl sie sich völlig uninteressiert zeigte, konnte man sicher sein, daß sie jede Veränderung im Raum auf das genaueste registrierte.
Hinter der Küche ging es in die gute Stube. Dort war es kalt. Die Sessel standen steif da, mit Tüchern und Decken gegen den Staub geschützt. Die gute Stube wurde nur an Feiertagen genutzt. Die Hausbewohner schliefen oben auf dem Boden in kleinen Verschlägen. Hinten rechts lagerte Heu und Stroh für die Tiere. Im Winter konnte es geschehen, daß am Morgen das Wasser in der Waschschüssel gefroren war.
Die Gegend war arm. Die Schwindsucht ging um. Das änderte sich etwas, nachdem die Papierfabrik zwei Kilometer flußaufwärts zu arbeiten begonnen hatte und der Ort an die Eisenbahnlinie angeschlossen wurde. Sommergäste kamen. In meiner Kindheit war der Ort ein Industriearbeiterdorf. Es gab viele Zugekommene durch die Umsiedler aus dem Osten und später durch die Grenztruppen.
Als Urgroßvater Anton in das Dorf kam, hatte er schon silberne Schläfen und wollte sich zur Ruhe setzen. Die Söhne waren alle außer Haus. Sohn Oskar, später der Vater meines Vaters, hatte eine schöne Stelle in Tirol. Sohn Alfred hatte in eine Papierfabrik in Schlesien eingeheiratet. Auch Sohn Max hatte getan, was getan werden mußte: Er war nach Amerika ausgewandert. Urgroßvater Anton hatte die kleine Holzstoffabrik, die er von seinem Vater geerbt hatte, verkauft. Es reichte gerade, um von den Zinsen einigermaßen gemütlich leben zu können. Nur ein Stachel blieb: Die Pacht einer Jagd würde er sich nicht mehr leisten können. Er war ein leidenschaftlicher Jäger, aber es reichte wirklich nicht. Das hatte ihm seine Luise auf Heller und Pfennig vorgerechnet.
Ich bin sicher, daß er sprachlos auf dem Felsen stand, den die Dorfbewohner Totenfels nannten, und überrascht war, solch ein landschaftliches Juwel vorzufinden. Ich stelle mir vor, daß er den Revierförster aufsuchte. Noch ohne besondere Absicht. Dort erfuhr er, daß die Jagd, zu der das Felsengebiet gehörte, noch zu verpachten war und daß der Fürst einen erfahrenen, zuverlässigen Mann gern als Pächter sähe. »Es gibt ein paar Leute, die sich freuen würden, zur Jagd eingeladen zu werden. Der Herr Brauereibesitzer, zum Beispiel. Der Herr Kantor, der Herr Fuhrunternehmer«, sagte der Förster zu Urgroßvater Anton. Er informierte ihn auch, daß die Wasserkraft der Saale bis dahin ganz ungenutzt geblieben war. Urgroßvater Anton könnte doch versuchen, die Wasserrechte zu bekommen und wieder Holzstoff zu produzieren, wofür die Voraussetzungen gerade besonders günstig wären. »Wenn das Ganze erst einmal läuft, ist es eine kleine Goldgrube«, versicherte der Förster. Der Ort war an das neue Eisenbahnnetz angeschlossen. Und die neue Papierfabrik war ein sicherer Kunde. Regelrecht begeistert war der Mann von seinen Vorstellungen. »Und das Holz bekommen Sie von mir. Abgemacht?« Urgroßvater Anton, der sich bemüht hatte, den rauhen Dialekt des Mannes zu verstehen, schlug ein, sagte aber einschränkend: »So Luise will.« Dann stieß er einen tiefen Seufzer aus.
Dieses Gespräch hatte an einem warmen Apriltag in der Försterei stattgefunden. Als Luise erstmals in das Dorf kam, schrieb man schon August, und die Verträge über das Wasserrecht und den Kauf des Geländes waren bereits abgeschlossen.
Auch Luise klatschte vor Freude in die Hände, als sie das Dorf sah. Als sie jedoch ihre primitive Notunterkunft auf der anderen Seite des Flusses besichtigte, wurde sie still. Eine Frau, die ihre Hilfe angeboten hatte und sie begleitete, sagte: »Hier können Sie nicht bleiben. So schlimm hausen ja nicht mal die Italiener.« Da besann sich Urgroßmutter Luise und sagte tapfer: »Es ist ja nur als Sommerfrische gedacht. Ich werde noch vor dem Winter in ein richtiges Haus einziehen.«
Als ihr Mann erklärte, an welche Stelle Wehr und Graben hinkommen sollten und sie mit kundigem Blick das Wasser abschätzte, erschrak sie sehr, denn sie ahnte, daß er auf das Frühjahrshochwasser hereingefallen war. Indessen schwärmte Urgroßvater Anton von den billigen Arbeitskräften, die er zum Aufbau des Anwesens bekommen würde, denn die Italiener hatten ihre Arbeiten am Tunnel gerade abgeschlossen und waren bereit, umgehend Wohnhaus, Fabrikgebäude und Mühlgrabenanlage zu bauen. Die Arbeit im Tunnel war schwer und auch gefährlich gewesen. Zwei Männer waren verunglückt. Das war für die betroffenen Familien eine Katastrophe.
Auch die Lage von Anton und Luise war bald katastrophal. Man wartete im Dorf schon auf die große Pleite. Aber man hatte nicht mit meinem Großvater Oskar gerechnet. Man kannte ihn noch gar nicht.
Gleich am Tage ihrer Ankunft hatte sich meine Urgroßmutter Luise hingesetzt und bei Kerzenlicht an ihren Sohn Oskar einen Brandbrief geschrieben, von dem ihr Mann nichts wissen durfte. Nach einiger Bedenkzeit war Oskar gekommen und hatte sich alles angesehen. Da war die Lage schon sehr schlecht – der Winter nahte, das Haus war noch nicht beziehbar. Die Fabrik stand erst als Rohbau. Das Geld war verbraucht. Den Neubauten, dem Dorf gegenüber, auf der anderen Seite des Flusses, sah man auf Schritt und Tritt an, daß der Bauherr sparen mußte.
Urgroßvater Anton gab sofort die Zügel aus der Hand, oder genauer, er legte sie in die Hand seines Sohnes.
Großvater Oskar blieb. Er leitete das Baugeschehen. Er besorgte einen Kredit. Er trieb den Aufbau der kleinen Fabrik voran, die mit Hilfe der Wasserkraft in einem Schleifverfahren das Holz mechanisch in eine faserige Masse verwandelte, es also in einen Zustand brachte, wie er für die Papierherstellung notwendig war. Diese Masse, auch Holzstoff genannt, wurde an die Papierfabrik verkauft. Es gibt Menschen, die sind von Lob und Anerkennung anderer abhängig. Es gibt Menschen, die ruhen ganz in sich. Sie sind kauzig, sie sind Originale, die sich treu bleiben. Sie sind Bauchmenschen. Sie beurteilen eine Situation mit dem Gefühl. Und zu diesem Urteil stehen sie total. Der Kopfmensch, der auf seinen Verstand setzt, wird dagegen nur zu unvollständigen Schlüssen und zu bedingten Aussagen gelangen, da das Leben nicht der einfachen Logik folgt. Während er noch zögert und zur Beurteilung einer Situation die schönsten Fallunterscheidungen macht, hat der Bauchmensch sein Urteil längst gefällt.
Großvater Oskar war ein Bauchmensch.
Er gehörte nicht zum Dorf. Und er versuchte auch nicht, Zugehörigkeit vorzutäuschen. Im Gegenteil. Er legte Wert auf Abstand. Allein in der Sprache trennten sie Welten.
Er stammte aus dem Hannoveranischen, aus einer Gegend, von der manche sagen, daß dort das beste Deutsch gesprochen würde. Er sagte nicht Sch-timme, sondern S-timme, nicht Sch-pinne, sondern S-pinne. Der Dialekt des Dorfes war eine deftige Mischung aus Thüringisch, Fränkisch und Bayrisch.
Trotz allem konnten sich die Dorfbewohner bald nicht mehr vorstellen, daß er im Dorf fehlte.
Einmal, als ich bereits nur noch als Besuch ins Dorf kam, sprach mich ein alter Mann an, der hatte von meinem Großvater eine Zigarre geschenkt bekommen. »Ich habe sie aufgehoben. Kannst vorbeikommen. Ich zeige sie dir.«
Ich habe meinen Großvater Oskar nicht mehr kennengelernt. Von den Bildern her stelle ich ihn mir als einen kleinen, stämmigen älteren Herrn mit dicker Nickelbrille vor, der durch den Garten geht und zu der alten Frau Weiß, die Unkraut jätet, vorwurfsvoll sagt: »Hier ist noch ein Pflänzchen.«
Im ersten Frühjahr, das Anton, Luise und Oskar im Dorf erlebten, war das Wetter sehr launisch. Im Gebirge, wo noch Schnee und Eis lag, wechselten Tauwettertage und Kälteeinbrüche einander ab, so daß es weiter flußabwärts mal Hochwasser und mal Niedrigwasser gab. Immer wenn das Wasser kam, arbeitete die kleine Fabrik auf vollen Touren, auch mitten in der Nacht. Dann hackte Großvater Oskar das Holz auf die nötige Größe, und seine Mutter speiste damit die Maschine. Man hörte das Geratter im ganzen Dorf. Die Bewohner schliefen unruhig. Aber gerade dadurch festigte sich das gute Verhältnis zu dem jungen Mann, sie waren von seiner Tüchtigkeit überzeugt. Großvater Oskar grübelte inzwischen über eine Veränderung von Wehr und Graben, die einen Ausgleich der verschiedenen Wasserstände bewirken sollte, so daß ein effektiverer Umgang mit dem Wasser möglich wurde.
Drei Jahre später war die Jagd gepachtet, zwar nicht von Urgroßvater Anton, wohl aber von seinem Sohn, der selbst ein leidenschaftlicher Jäger war. Außerdem brachte Oskar eine junge Frau ins Haus, meine Großmutter Rena. Das war kurz vor der vorigen Jahrhundertwende. Über vierzig Jahre vor meiner Geburt.
Manchmal bekomme ich einen Schreck.
In meiner Familie gab es immer die Tugendhaften und die Sünder. Zum Beispiel Großtante Toni: Sie war aus Liebe einem Offizier bis nach Afrika gefolgt und hatte sich dort erschossen. Ihr Name wurde in der Familie nicht mehr erwähnt. Nur durch Zufall erfuhr ich von ihrer Existenz. Auch die Geschichte von Großonkel Max kenne ich nicht. Noch heute nicht.
Großvater Oskar gehörte auf jeden Fall zu den Tugendsamen. Er war kein Kavalier, der den Damen den Hof machte. Die Ehe war ein Vertrag auf Lebenszeit. Und darauf konnte sich seine künftige Frau verlassen. Sie lernten sich durch eine Heiratsvermittlung kennen. Alles ging sachlich und wohlüberlegt zu.
Als die junge Frau im Tal einzog und sich umsah, schien es ihr, als ginge von dieser Gegend etwas Düsteres, ja Bedrohliches aus. Wohin sie auch blickte, in allen Richtungen war der Horizont ganz nahe. Wenn sie die Gegend vorher gesehen hätte, wäre sie vielleicht in ihrem Entschluß schwankend geworden.
Großvater Oskar entpuppte sich als jähzornig und herrschsüchtig. Er war ein Familientyrann. Seine Frau Rena unterwarf sich nicht ohne weiteres, so daß es heftige Szenen zwischen den Eheleuten gegeben hat. Anfangs lebte die Schwiegermutter, Urgroßmutter Luise, noch im Haus. Mit der war nicht gut Kirschen essen. Und Mutter und Sohn hielten meistens zusammen.
Als Urgroßmutter Luise sterben sollte – der Pfarrer war schon dagewesen, und die Familie legte die schwarzen Kleider bereit –, richtete sich die Sterbende plötzlich und unerwartet auf und schrie: »Hermine!« Und als Hermine mit verweinten Augen erschien, befahl sie mit fester Stimme: »Hol die Rehkeule vom Boden. Hier läßt man mich glatt verhungern.«
Und sie war dem Tode fürs erste entsprungen.
Der Jähzorn von Großvater Oskar ist in der Familie sprichwörtlich geworden. Wenn meine Mutter zu mir sagte: »Du bist wie dein Großvater Oskar«, so war das eine Kritik. Aber der Tonfall, mit dem es gesagt wurde, klang eher anerkennend.
Dort, wo der Hausgarten an den Friedhof grenzt, konnte ich leicht auf die Mauer hinaufklettern. Sprang ich auf der anderen Seite hinunter, stand ich direkt auf dem mit Efeu überwucherten Grab von Anton und Luise. Daneben das von Rena und Oskar. Heute sind sie alle längst vergessen. Ihre Gräber sind eingeebnet. Der Friedhof ist gesperrt. Wegen der Hygiene.
Aber es gibt mehr Spuren, als man denkt. Die Familie sucht man sich nicht aus. Sie ist wie eine Stafette. Der Stab wird von Generation zu Generation weitergegeben. Ehe man sich bewußt macht, worum es eigentlich geht, ist der Wechsel schon vollzogen.
AM TAG HÖRE ich das Rauschen der vorüberfahrenden Autos, das von Hauswand zu Hauswand geworfen wird. Die Geschäftigkeit der großen Stadt ist allgegenwärtig. Am Tag werden Türen zugeschlagen, heftige Worte gesagt und fremde Angelegenheiten geklärt. Der Tag ist verworren. Er erschöpft meine Seele. Hat sie immer erschöpft. Aber er tötet nicht.
Die Nacht hingegen ist wie ein tiefer Abgrund. Ein Abgrund in mir. In jedem Moment kann ich hinabstürzen. In der Nacht ist die Angst. Die tödliche Angst vor dem Tode. Die alles mit sich reißt, das Innen wie das Außen.
In der Nacht erwache ich. Die Stille ist vollkommen.
Die einzige Verbindung nach draußen ist die Furcht vor dem, was unausweichlich aus allen Richtungen auf mich zukommt. Am liebsten würde ich jetzt aufspringen und schreien. Aber die Schwäche hält meinen Körper wie eine Fessel gefangen. Wieder bin ich angebunden.
Als ich zwei Jahre alt war, schrieb meine Mutter in ihr Tagebuch: »Wir können sie jetzt nachts nicht mehr anbinden. Sie wehrt sich so dagegen, daß sie sich schon einmal beinahe erhängt hat.«
Wenn es hell wird, werden die Nachtgedanken zu Schemen. Übrig bleibt Gleichgültigkeit, ein Gefühl der Leere. Als ich die Augen wieder aufschlage, steht die Sonne schon hoch über dem Nachbardach.
ICH BESUCHE MEINE Mutter. Sie sitzt kerzengerade im Zimmer des Seniorenheims. Mit 95 Jahren wehrt sie sich dagegen, von mir gefüttert zu werden, weil sie Angst hat, ich bekleckere sie. Ich hingegen wünsche mir immer noch, von ihr geliebt zu werden. Ich brauche ihre Anerkennung.
Mit 90 wollte sie sterben. Aber seit sie eine Mitbewohnerin im Zimmer hat, geht es ihr viel besser. Die beiden Frauen verständigen sich tastend. An Tagen, an denen sie einander gut gesonnen sind, bin ich überflüssig. Meine Mutter beachtet meinen Besuch kaum. An Tagen, an denen sie sich nicht verstehen, bin ich willkommen.
Heute spricht sie kaum mit mir. Schwer zu sagen, ob sie mich ablehnt oder ob ihr der Zugang zu den Worten versperrt ist.
Wenn ich bedenke, wie ihr die Erinnerungen nach und nach abhanden gekommen sind und wie sie die Lücken mit Erfundenem zu füllen versuchte, gruselt es mich. Ein Mensch, der seiner Erinnerungen beraubt wird, ist am Ende vor sich selbst ein Niemand. Und man glaube nicht, daß die Kranken es nicht bemerken. Ich habe nicht verstanden, was mit ihr los war. Noch heute strahlt sie eine gewisse Würde aus. Meine Mutter war von uns beiden immer die Stärkere.
Eine Schwester fragt mich: »Wie geht es Ihnen?« und ist schon wieder verschwunden. Sie hat keine Antwort abgewartet. An diesem Tag geht es mir nicht gut.
Ich setze mich in den Rollstuhl meiner Mutter und lasse mich von ihr über den Flur im fünften Stock des Seniorenheims schieben. Das bereitet ihr sichtlich Vergnügen. Nie war die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter so eng wie in Zeiten, in denen ich krank war. Natürlich war ich oft krank. Ihre Fürsorge war nicht ohne Risiko für mich. Es konnte geschehen, sie diagnostizierte einen Fieberkrampf und hielt mich unter kaltes Wasser. Noch in ihren späten Jahren erzählte sie, wie sie mir auf diese Weise das Leben gerettet hätte.
Lag ich mit Fieber im Bett, hatte ich mindestens noch neun schulfreie Tage vor mir, drei Tage mußte ich ohne Fieber im Bett verbringen. Danach drei im Zimmer. Und die letzten drei Tage hatte ich Ausgang. Erst dann war meine Mutter zufrieden und stellte fest, daß die Krankheit überwunden wäre. Ohne Großmutter wäre das nicht auszuhalten gewesen. Deswegen wurde die Mutter meiner Mutter, meine Großmutter Anna Emma Lina, in Bewegung gesetzt. Sie kam nachmittags halb drei mit dem Zug aus dem Tunnel. Wenn sie mich im Bett liegen sah, sagte sie: »Den Vogel, der am Morgen singt, den holt am Abend die Katz.«
»Und was ein Häkchen werden will, das krümmt sich beizeiten!« erwiderte ich.
»Gut gemerkt. Vergiß es nur nicht!« spottete die Großmutter.
»Großmutter, warum hältst du dich so grade? Wolltest du kein Häkchen werden?«
»Ich? Ach, du alte Klugscheiße«, sagte Großmutter.
»Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz«, zitierte ich.
»Von mir hast du das nicht. Erzähl nur keinem, du hättest es von mir.«
»Der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum«, konterte ich.
»Wird die Schule nicht bald Sehnsucht nach dir haben?« fragte die Großmutter.
»Du weißt doch, Oma, ich bin die Klügste.«
»Jetzt stinkt es aber hier«, sagte die Großmutter, öffnete die Tür und versuchte zu entkommen.
Mein Vater nannte die Geschichten der Großmutter Walzen. Walzen und Großmutter waren untrennbar. »Sie gebraucht sogar jedesmal dieselben Worte, das soll mal einer aushalten«, stöhnte er. Die Großmutter wußte wohl, was ihr Schwiegersohn von ihren Erzählungen hielt, nicht zuletzt, weil er es ihr gesagt hatte. Aber das hatte kaum einen Einfluß auf ihr Mitteilungsbedürfnis.
Mein Vater, der nicht verwinden konnte, daß er nicht auf einem humanistischen Gymnasium gewesen war, traktierte mich mit lateinischen Sprüchen. Quod licet Jovi, non licet bovi