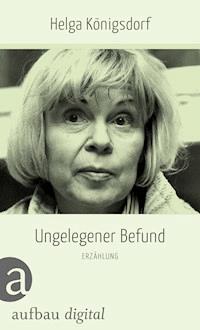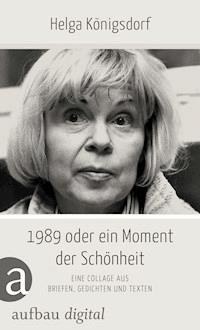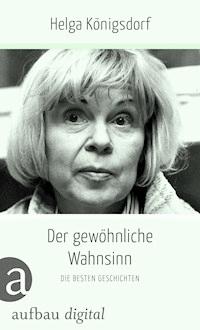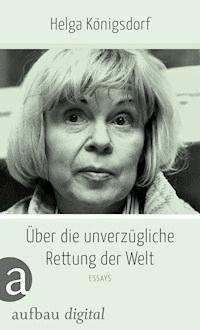9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schreiben wollte ich bereits als Kind. Mit Sechzehn verfaßte ich ein blutrünstiges Drama, worüber alle gewaltig lachten. Es mangelte mir an menschlicher Reife, denn ich begriff nicht, daß mir damit etwas sehr Schwieriges gelungen war. Ich wandte mich anderen Dingen zu, über denen ich meine schriftstellerischer Berufung aus den Augen verlor. Ich unterzog mich willig sämtlichen Frauenförderungsmaßnahmen, erwarb fast alle "Abzeichen für gutes Wissen" und leistete meinen Beitrag zur Reproduktion der DDR-Bevölkerung. Als ich mein altes Vorhaben längst endgültig vergessen hatte, brachen die vorliegenden Geschichten völlig ungerufen aus mir heraus. Damit möchte ich mich keineswegs vor der Verantwortung drücken, vielmehr sehe ich meinem unvermeidlichen Schicksal, nach Erscheinen dieser Geschichte ein unbemanntes Dasein fristen zu müssen, gefaßt ins Auge. - Helga Königsdorf
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Schreiben wollte ich bereits als Kind. Mit Sechzehn verfaßte ich ein blutrünstiges Drama, worüber alle gewaltig lachten. Es mangelte mir an menschlicher Reife, denn ich begriff nicht, daß mir damit etwas sehr Schwieriges gelungen war. Ich wandte mich anderen Dingen zu, über denen ich meine schriftstellerischer Berufung aus den Augen verlor. Ich unterzog mich willig sämtlichen Frauenförderungsmaßnahmen, erwarb fast alle »Abzeichen für gutes Wissen« und leistete meinen Beitrag zur Reproduktion der DDR-Bevölkerung. Als ich mein altes Vorhaben längst endgültig vergessen hatte, brachen die vorliegenden Geschichten völlig ungerufen aus mir heraus. Damit möchte ich mich keineswegs vor der Verantwortung drücken, vielmehr sehe ich meinem unvermeidlichen Schicksal, nach Erscheinen dieser Geschichte ein unbemanntes Dasein fristen zu müssen, gefaßt ins Auge. – Helga Königsdorf
Helga Königsdorf
Meine ungehörigen Träume
Geschichten
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Bolero
Lemma 1
Mit Klischmann im Regen
Krise
Meine ungehörigen Träume
1 Grippe
2 Aufruhr
3 Fremde
4 Der Direktor
5 Der Heiratsschwindler
Eine Idee und ich
Rundfahrt
Die Nacht beginnt am Tag
Heimkehr einer Prinzessin
Hochzeitstag in Pizunda
Nachsatz
Über Helga Königsdorf
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Meiner Liebe, die mir täglich stirbt und die ich immer neu erschaffe
Alle Ähnlichkeiten sind zufällig. Alle zufälligen Ähnlichkeiten sind beabsichtigt.
Bolero
Nein, ich weiß wirklich nicht, warum ich es getan habe. Eigentlich war überhaupt nichts Besonderes an ihm.
In jener Sitzung wurde ein Referat verlesen, dem man auch ohne böswilligen Scharfsinn die verschiedenen Zuarbeiter anmerkte. So ließ sich der Redner erst über den zurückliegenden Volkswirtschaftsplan aus, dann über den gegenwärtigen Volkswirtschaftsplan und schließlich über den bevorstehenden Volkswirtschaftsplan. Die langatmigen grundsätzlichen Bemerkungen und Schlußfolgerungen, die die jeweiligen Volkswirtschaftspläne begleiteten, unterschieden sich lediglich durch die ungleiche Sprachgewalt ihrer Schöpfer. Es muß etwa gegen Mitte des laufenden Volkswirtschaftsplanes gewesen sein, als mir die Blutwurststulle in meiner Tasche in den Sinn kam. Und zwar derart eindringlich, daß in mir der Nahrungsreflex und das im Prozeß meiner Persönlichkeitsentwicklung herausgebildete Normverhalten kollidierten. Mein weiteres Konzentrationsvermögen unterlag hoffnungslos der Zwangsvorstellung, während eines grundlegenden Referates in eine Blutwurststulle beißen zu müssen. Solchermaßen verwirrt, blieben meine Augen zum ersten Mal an ihm haften. Vielleicht, weil er weiter unablässig, auch später gegen Ende des kommenden Volkswirtschaftsplanes, aufmerksam und gewissenhaft in ein schwarzes Heft schrieb. Wie ich so zu ihm hinschaute, sah er hoch, wollte wieder seine Augen abwenden und konnte es nicht. Wenn mir in diesem Moment prophezeit worden wäre, daß er in meinem Leben, oder besser, ich einmal in seinem Leben so unerhört bedeutsam werden würde, ich hätte nur gelacht. Denn, wie ich schon sagte, es war nichts, aber auch gar nichts Besonderes an ihm.
Er war in jenem Alter, in dem die Männer über die Intensivierung ihres Lebens nachdenken. Als er sich mir während der Pause in den Weg baute, seine dicke Brille zurechtrückte und über sein schütteres Haar strich, überkam mich die alberne Vorstellung von einer magenkranken Dogge. Dabei waren es aller Wahrscheinlichkeit nach gerade dieser müde und verbrauchte Zug in seinem Gesicht und die Narbe, die seine linke Hand verunstaltete, die mein historisch verbildetes weibliches Mitgefühl mobilisierten. So verblieb meine Blutwurststulle, trotz aller Aufregung, die sie in meinem Nervensystem erzeugt hatte, in der Tasche, und ich gestattete ihm den Erfolg, mich zum Kaffeetrinken verführt zu haben.
Ihn aber beeindruckte dieses Erlebnis derart, daß er mir unsagbar beflügelter erschien, als dies der nackten Wahrheit entsprach. Ich hatte in jenen Tagen so selten etwas vor. Ich hätte aus Langeweile dem Teufel Gefolgschaft geleistet. Warum sollte ich also nicht mit einem angegrauten, lüsternen, dicken Mann ein kleines abgelegenes Restaurant aufsuchen.
Das Zigeunersteak – meine Blutwurststulle verfütterte ich am anderen Morgen vom Balkon aus an die Möwen – und der rote Wein waren seine Wahl. Ich bevorzugte damals eigentlich lieblichen Weißen, er aber sagte, der echte Kenner zeige sich am Rotwein. Ich dachte wieder darüber nach, ob er magenkrank sei.
In unserer Unterhaltung gab es nichts, dessen man sich erinnern müßte. Aber man sollte unserer Mittelmäßigkeit die vielen abgesessenen Stunden zugute halten und die tatsächlich widrige Gesprächssituation: keine verbindenden Erinnerungen, kaum gemeinsame Bekanntschaften, noch undeutlich verbotene Zonen in unseren separaten Welten. So brachten mir zwar seine Berichte über das Verheiraten einer Tochter mittelbar Aufschlüsse über seine familiäre Gegenwart, aber eigentlich konnte sie mir einschließlich seiner genaueren ehelichen Umstände absolut gleichgültig sein.
Wieso beglich ich, als er kurz hinausgegangen war, die Rechnung? Ich glaube, da lag bereits ein entscheidender Fehler. Mir war irgendwie wohl dabei, war ich ihm doch nun zu nichts verpflichtet. Aber es steckte nichts weiter dahinter als eine gründliche Fehlinterpretation der Gleichberechtigung, zumal mir meine Blutwurststulle sicherlich besser geschmeckt hätte als dieses zähe Zigeunersteak und ich den roten Wein nicht mochte. Auf jeden Fall stellte ich damals, als ich den Kellner heranwinkte, eine Weiche in unserer weiteren Rollenverteilung, denn man denke bloß nicht, ein Verhältnis wie unseres erfordere keine innere Ordnung.
Schlamperei oder umwälzender Elan sind hier noch weniger am Platz als bei anderen in das Fundament der Gesellschaft eingelassenen Verbindungen.
Wir sind dann später nie wieder in ein Restaurant gegangen, sondern er besuchte mich in meiner kleinen Wohnung in der zwölften Etage des Hochhauses, an dem die Balkone wie Bienenwaben kleben.
Die Liebe mit ihm war nicht sonderlich erfreulich. Er kam ohne weitere Einleitung über mich und beschäftigte sich an mir mit sich. Hinter der Sinnlichkeit der Frauen mutmaßte er Tonnenideologie, und folglich bemaß er die Kultur seiner Liebeshandlung in deren Quantität. Trotzdem wäre ihm die Offenbarung meines Empfindens wohl nicht als Niederlage nahegegangen, denn durch Statistiken aufgeklärt, schätzte er den Prozentsatz der frigiden Frauen im Abendland auf sechsundneunzig. Welche richtige Frau aber würde nicht ihren Ehrgeiz dareinsetzen, zu den verbleibenden vier Prozent gezählt zu werden. Außerdem war allen Gedankengängen vorzubeugen, die in der Frage endeten: »Warum ich eigentlich …?«
Während ich also für seine Befriedigung schwer atmete und leise stöhnte, dachte ich daran, daß das blaue Sommerkleid zur Reinigung müsse. Ich legte seine Hand mit der Narbe zwischen meine Schenkel, doch er begriff nichts. Vielmehr registrierte er mit Staunen die ihm neu erschaffenen Fähigkeiten zur Lust, überließ sich gänzlich dem passiven Genießen, so daß in der Zukunft ich über ihn kommen mußte, was meinem natürlichen Empfinden zuwiderlief.
Vielleicht hätte ich es nicht getan, wenn ich bedacht hätte, daß er so schreien würde. Aber das konnte ich wirklich nicht ahnen, denn er war der ruhigste Mensch, den ich gekannt habe.
Danach übermannte ihn meist die Müdigkeit, und er fiel in einen kurzen tiefen Schlaf, während ich einer kleinen Mahlzeit die letzte Würze verabreichte. Ich wußte bald um seine Neigung zu herausgeputzten Speisen mit überraschenden Nuancen und fremdartigen Namen und kredenzte ihm den Pepsinwein vor der Suppe. Vielleicht kam er anfangs mehr wegen der Liebe und später mehr wegen des Essens.
Ich machte mir nichts aus diesen Essen, denn mir war damals oft übel. Wissen überbrückt nicht immer die Abgründe unserer Furcht, und so quälte mich eine abergläubische Scheu vor der Pille. Dieser Eingriff in das feine Zusammenspiel jener Kräfte, die die Lebensprozesse steuern, schien mir grob und unzulässig. Unnachweisbar, und eben darum unheimlich, würde sich die Struktur meines Seins ändern. War ich dann noch ich?
Abwegig verstaubte Anwandlung einer Frau mit im übrigen durchaus moderner Weltanschauung!
Er mache sich Sorgen! Und ich müsse ihm schon erlauben, daß er sich Sorgen um mich mache. Derart beschämt, schluckte ich die Pille und konnte mich nur schlecht daran gewöhnen. Obwohl mein Arzt mir wissenschaftlich nachwies, diese anhaltende Übelkeit könne nur eine Folge psychischer Verkrampftheit sein, war mir doch ganz real schlecht. Ich sprach nicht länger darüber, schließlich nehmen so viele Frauen die Pille.
Im Winter rochen seine Anzüge nach abgestandener Rauchluft, und ich hängte sie manchmal auf den Balkon. Im Sommer kam er meist verschwitzt, und mich begann der Geruch seines Körpers zu stören.
In unserer späteren Zeit ist er oft müde gewesen. Ich drängte ihn nie. Es war mir einerlei. Wir hätten auch gleich mit dem Essen beginnen können.
Er führte ein einwandfreies Familienleben, in dem ich keinen Platz hatte, nicht einmal als entfernte Kollegin. Ich stimmte dem unbedingt zu. Nüchtern gesehen: Scherereien hätte es nicht verlohnt. Ein Geheimnis war auch eine Waffe. Eine Waffe gegen das unerhörte Gefühl der Verlassenheit, das mich damals wie ein wieder- und wiederkehrender Angsttraum bedrängte. Ein Spannungselement, und hing auch noch so viel Selbstironie daran. Ein Kontrast im Gleichklang meiner Tage.
Nur einmal, ein einziges Mal, habe ich bei ihm angerufen. Das war nach jener Sitzung, die acht Stunden gedauert hatte und in der ich als allerletzte zu Wort kam. Ich sprach und sprach, und keiner hörte mich. Ich sprach nicht nur, um gesprochen zu haben, ich hatte tatsächlich etwas zu sagen. Ich redete mich in Eifer, ich beteuerte, ich gestikulierte, ich beschwor. Und die einen packten schon ihre Taschen, andere sahen mißmutig auf die Uhr, noch andere hatten den Wechsel des Redners gar nicht bemerkt. Danach brauchte ich einfach irgendeinen Menschen. Ich suchte den Zettel mit seiner Telefonnummer, den er mir in Anfangsgroßartigkeit gegeben hatte. Ich wählte die ersten drei Nummern. Hier schaltete sich das Tonband ein: »Kein Anschluß unter dieser Nummer.« Ich versuchte es ein weiteres Mal. Das gleiche. Im Telefonbuch war er nicht eingetragen. Ich vergaß später, ihn danach zu fragen. Ich hätte sowieso nicht wieder angerufen.
Ich arbeitete viel und zuverlässig, damals. Ich ließ mir dieses und jenes aufbürden, das nicht mein Amt gewesen wäre. Ich war häufig erschöpft. Die Menschen sahen mich freundlich und hastig an. Wie schwer ist es doch, ein bißchen Glücksbedürfnis zu ersticken.
Er kam zu mir, wann es ihm paßte, und manchmal dachte ich: Dieses Mal war das letzte Mal, ich will nicht mehr. Es war und blieb eine verfehlte Sache. Aber wenn ich wochenlang nichts von ihm hörte, wuchs in mir der Ärger, und wenn er dann anrief, war ich erleichtert, daß ich mich nicht mehr zu ärgern brauchte, und da ich gerade nichts anderes vorhatte, kaufte ich ein und bereitete das Essen vor. Manchmal ging ich auch schnell noch zum Friseur. Und wenn er kam, erzählte ich ihm die letzten Witze und zog die Vorhänge zu, obwohl nur der Himmel ins Fenster sah. Er protestierte, aber die Vorstellung, er würde mein Gesicht dabei belauern, war mir außerordentlich unangenehm. Danach schlief er etwas, ich deckte den Tisch, schmückte ihn mit bunten Servietten und Gräsern in einer schmalen Vase, und der Klang von Ravels »Bolero« in Stereo erfüllte anschwellend den Raum.
Wenn er gegangen war, räumte ich die Wohnung auf, badete und saß lange gedankenlos an der geöffneten Balkontür.
Nein, wie ich es auch wende, da war kein Grund, es zu tun. Er hat mich immer gefragt, ob er kommen dürfe, und ich hätte nur »nein« zu sagen brauchen. Er wäre sicher recht verwundert gewesen und dann natürlich gekränkt. Hätte ich doch wenigstens ein einziges Mal, wenn er anrief, etwas vorgehabt, vielleicht wäre alles nicht passiert.
Seine Frau erwies sich als eine Enttäuschung.
Ich war vollkommen frei von Skrupeln. Das entsprang nicht so sehr einem Defekt meines Charakters als der Überzeugung, daß die Rechnung sehr zu meinen Gunsten stand, denn ich gab ihm doch ein bißchen Freude, und Freude, gegeben, strahlt im Abglanz weiter.
Ich sah sie bei einem Theaterbesuch. Es war reiner Zufall. Nicht etwa, daß ich ein attraktives Überweib erwartet hätte, aber ein derartig geringes Aufgebot an Persönlichkeit war niederdrückend. Es ist nicht zu verstehen, doch ich fühlte mich unbeschreiblich gedemütigt. Dagegen hat mich sein Erschrecken, sein »Vorbeiseh-Manöver« und seine spätere Beteuerung, er habe mich tatsächlich nicht bemerkt, eher belustigt.
Auch meine Beichte über jene mißglückte Ansprache belustigte uns sehr. Wir genossen das Spiel der kleinen absichtlichen Entstellungen, der riesenhaften Übertreibungen von Winzigkeiten, und ich wuchs zur tragischen Heldin einer amüsanten Posse. Meine Vorschläge und Ideen nahm er wohltuend ernst. Er setzte sich rückhaltlos ein. Wo mich noch Skepsis hemmte, wirkte bereits der Hebel seiner Tatkraft. Als man ihm die Medaille für ausgezeichnete Leistungen an die Brust heftete, war auch ich stolz. Natürlich konnte er unmöglich sagen, daß ich ihm die Sache in meiner kleinen Wohnung im zwölften Stock erklärt hatte.
Ohne Zweifel ist es jetzt, nachdem das alles passiert ist, für mich sehr günstig, daß niemand etwas von unserer näheren Bekanntschaft ahnte.
An jenem Abend kam er direkt nach einer Sitzung zu mir. Ich legte ihm die Kissen im Sessel zurecht, schob die Fußbank heran, draußen wurde es bereits dunkel. Ich sah, er war sehr müde. Ich kochte einen starken Kaffee, würzte ihn mit Zucker und Zimt, gab etwas Himbeergeist in die breiten Schalen, zündete ihn an und goß dann langsam den Kaffee hinein. Ich fand es rührend, daß er sagte: »Ich bin heute sehr abgespannt, aber ich wollte dich unbedingt sehen.« Ich trug den neuen hauchdünnen weinroten Hausanzug, sonst nichts, und als er mich an sich zog, spürte ich, er war doch nicht so müde. Irgendwie mochte ich ihn in diesem Moment wie nie zuvor. Ich war besonders zärtlich zu ihm und ganz ohne Verstellung. Als ich seinen Kopf an meine Schulter legte, knurrte er leise. Ich fragte ihn, was er denke, und er sagte, mich wegschiebend: »Ach nichts. Aber ich bin doch ein altes Schwein.«
Das andere geschah völlig unerwartet. Wir aßen schneller als sonst, weil er zu Hause nicht abgemeldet war. Dann ging er, schon im Anzug, aber noch in Strümpfen, auf den Balkon, lehnte sich über die Brüstung, um nach seinem Auto zu sehen. Wie er so auf Zehenspitzen stand und sich reckte, faßte ich seine Füße und riß seine Beine hoch. Er hat nicht versucht, sich festzuhalten, er war wahrscheinlich zu überrascht. Das erklärt auch, wieso er erst so spät geschrien hat. Da war er schon in der Höhe des siebenten oder sechsten Stocks. Seine Schuhe und seinen Mantel habe ich hinterhergeworfen. Ich räumte die Wohnung auf, badete und setzte mich an die offene Balkontür. Ravels »Bolero« erfüllte anschwellend den Raum.
Manchmal grübele ich darüber nach, wie diejenigen, die seinen Nachruf verfassen, die Tatsache, daß er ohne Schuhe Selbstmord beging, damit in Einklang bringen, daß er der korrekteste Mensch war, den sie oder irgend jemand anderes kannten.
Lemma 1
Hin und wieder stellt sich heraus, daß einer Erkenntnis, die man bereits als bedeutsamen Fortschritt der Wissenschaft gepriesen hat, ein Trugschluß zugrunde lag. Gesichert aber bleibt die Existenz derjenigen, die ihre Erleichterung über diesen Ausgang mit höflichem Bedauern bemänteln.
Es ist nicht auszudenken, was uns für Schwierigkeiten entstanden wären, wenn sich Johanna Bock nicht geirrt hätte.
Eine mathematische Arbeit besteht aus Theoremen und Texten zwischen den Theoremen. Ein Theorem unterteilt man in die Voraussetzungen, die Aussage und den Beweis, daß die Aussage unter diesen Voraussetzungen gültig ist. Die Zwischentexte sollen erklären, warum die Aussage unter diesen Voraussetzungen interessiert. Meistens werden aber nur Begriffe eingeführt und Bezeichnungen definiert. Dies geschieht nicht aus Böswilligkeit des Autors, vielmehr ist es häufig leichter, ein mathematisches Resultat abzuleiten, als dessen Bedeutung einzuschätzen. Manchmal gibt es auch keine Bedeutung.
Die Theoreme kann man in wichtige und weniger wichtige aufteilen. Wichtige Theoreme sind solche, die den Autor veranlaßt haben, die Arbeit zu schreiben. Die Aussagen der weniger wichtigen Theoreme werden lediglich in den Beweisen der wichtigen verwendet. Ein solches unwichtiges Theorem wird auch Lemma genannt. In seltenen Fällen stellt sich später heraus, entgegen der Meinung des Autors war gerade das Lemma das wesentliche Resultat. Dann bekommt das Lemma den Namen des Autors. Dieser ist zu diesem Zeitpunkt meistens schon alt oder verstorben. Jedenfalls glauben alle, die den Autor nicht kennen, daß er alt oder verstorben ist.
Die Theoreme und Lemmata in einer mathematischen Arbeit sind numeriert. Sie stehen in engem Zusammenhang. So findet man im Beweis von Theorem 11 die Formulierung »Wie man mit Hilfe des Theorems 9 leicht sieht, gilt …« Im Beweis des Theorems 9 steht: »Diese Aussage ergibt sich nach Lemma 3.« Im Beweis von Lemma 3 heißt es: »Diese Behauptung ist richtig, weil sich sonst ein Widerspruch zu Lemma 1 ergeben würde.« So kann es sich durch verwobene logische Schlußketten herausstellen, daß alle Behauptungen einer mathematischen Arbeit nur dann bewiesen sind, wenn Lemma 1 tatsächlich gilt. Wenn also beim Beweis von Lemma 1 kein Fehlschluß unterlaufen ist.
Aber Lemma 1 war falsch.
Johanna Bock gestattete ungeachtet aller modischen Langhaarfrisuren und Schüttelschnitte ihrem Haar nie mehr als fünf Zentimeter Länge. Das war aber sicherlich nicht der Grund, weshalb Professor Frischauf sie Jeanne d’Arc nannte, wenn sie es nicht hören konnte. Vielmehr befiel einen bei ihrem Anblick eine seltsame Mischung aus Mitleid und Mißtrauen. Um die Wahrheit zu sagen, es kam bei vorsichtigen Naturen in ihrer Gegenwart ein psychologisches Warnsystem in Gang. Ihr größter Fehler war ihr Fanatismus bei allen ihren Unternehmungen. Damit brachte sie die anderen in ihrer Umgebung nicht selten in Schwierigkeiten, wodurch sie dann selbst in Schwierigkeiten geriet, was sie stets ganz unvorbereitet traf.
Auf jeden Fall war Johanna eine leidenschaftliche Mathematikerin, und ihr wurde eine glänzende Zukunft prophezeit. Man hatte der Universität für sie und einen zweiten Beststudenten immerhin einen habilitierten Algebraiker zum Tausch bieten müssen.
Das von Professor Frischauf für Johanna formulierte Forschungsthema schloß zwar das seit langem ungelöste Kurzsche Problem über die Suboptimalität des kleinsten invarianten Eigenvektors ein, war aber selbstverständlich in einer Allgemeinheit gehalten, wie sie für die Planung angebracht ist. Auch kleine Randresultate konnten als Erfolge abgerechnet werden. Derartige Ergebnisse lagen bei der Aufstellung des Planes bereits vor. Johanna hatte sich jedoch in das Kurzsche Problem verbissen.
Eine der großen päpstlichen Bullen, so nannte man die Ansprachen des Direktors des Mathematischen Zentrums in der VVB Wissenschaften, war bei ihr auf fruchtbaren Boden gefallen. Der Papst ertrug es mit den Jahren immer schwerer, anderen zuhören zu müssen. Deshalb wurden seine Reden länger und länger. Die älteren Mitarbeiter waren bereits zu abgestumpft, um die Schönheit seiner Rhetorik noch voll würdigen zu können. In jener Ansprache hatte der Papst ausgerufen, man müsse endlich den Mut besitzen, sich wirklich tiefliegenden fundamentalen Problemen zuzuwenden. Mut zur risikoreichen Forschungsproblematik! Die Jugend solle herzhaft große Dinge anpacken und nicht zufrieden in Arbeiten mitschwimmen, deren Stellenwert von Anfang an nicht sonderlich verlockend erscheine.
Professor Frischauf, der eine Vorliebe für bildhafte Kommentare hatte, bemerkte zwar anschließend im kleinen Kreis seiner Mitarbeiter, ein guter Bauer müsse bei der Größe der Eier die Anatomie seiner Hühner beachten, und es ginge nicht, für ein unlegbares Riesenei Millionen Esser hungern zu lassen. Johanna hatte jedoch bereits Feuer gefangen.
Nachdem sie ein Jahr lang seltsam verstört durch das Haus gegangen war, in jeder unpassenden Situation hyperbelähnliche Gebilde auf Papierreste gezeichnet hatte und wegen mangelhafter Teilnahme am FDJ-Leben kritisiert worden war, übergab sie übernächtig an einem Montagmorgen Professor Frischauf ein umfangreiches sauberes Manuskript mit dem Titel: »Ein geometrischer Zugang zum 3. Kurzschen Problem«.
Man kann nicht behaupten, daß sie sich bei ihrem Vortrag im Seminar ihrem Leiter, Professor Frischauf, und den anderen Mitarbeitern gegenüber fair verhalten hätte. Vielmehr trat bereits eine deutliche Herablassung zutage. Sie gab unmißverständlich zu verstehen, daß sie sich mit dieser Arbeit in die Reihen der ganz Großen geschrieben habe. Ihr Ergebnis zeige, so sagte sie, man müsse sich bei der Festlegung der Entwicklungstendenzen des Fachgebietes auf die geometrischen Methoden zurückbesinnen.
Die Gedanken, die Professor Frischauf in diesem Moment erfüllten, sind unbekannt, denn wie immer in schwierigen Situationen blieb sein Gesicht absolut