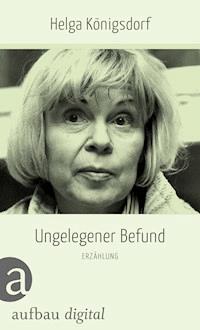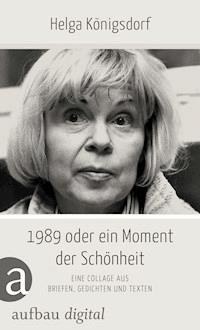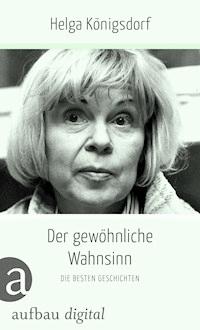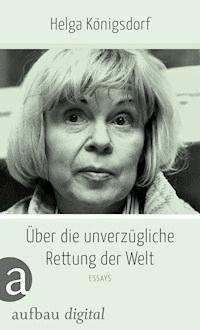9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lichtverhältnisse - sie können unterschiedlich sein, gut und schlecht, ungeeignet oder geeignet. Sie lassen Personen und Dinge im Dunkel, im Verschwommenen, oder sie stellen sie dem Betrachter in ein grelles, schonungsloses Licht, tauchen sie in freundliches, warmes. So wie es Helga Königsdorf in ihren neuen Geschichten tut, wenn sie auf vielfältige Weise über den Umgang der Menschen miteinander in Partnerschaft und Beruf, in der Familie, in unserer Gesellschaft reflektiert. Ernst und heiter, mit satirisch-ironischen, aber auch ganz leisen Tönen wird da erzählt: Von einer Schwangerschaftsunterbrechung, die die Betroffene eine Bilanz ihres Lebens ziehen läßt, von einem besessenen kleinen Erfinder, den sie Kugelblitz nennen, von der Einsamkeit und Angst einer Sterbenden. Und weil für eine Dichterin wie Helga Königsdorf nichts unmöglich ist, kann sie auch einen Ehemann in eine Ameise verwandeln, oder sie führt ihren Lesern vor, wie es so zugeht in himmlischen Gefilden, wenn dort ein Philosoph, ein Ökonom, ein Dichter und eine Käseverkäuferin wider Willen zusammentreffen. Auch diese Geschichten der Autorin sind, wie es in der Laudatio zum Heinrich-Mann-Preis heißt: „...angefüllt mit Erfahrungen, gelebtem und gesehenem Leben, mit Komik und Trauer, mit Realität und dem Spiel der Phantasie."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Lichtverhältnisse – sie können unterschiedlich sein, gut und schlecht, ungeeignet oder geeignet. Sie lassen Personen und Dinge im Dunkel, im Verschwommenen, oder sie stellen sie dem Betrachter in ein grelles, schonungsloses Licht, tauchen sie in freundliches, warmes. So wie es Helga Königsdorf in ihren neuen Geschichten tut, wenn sie auf vielfältige Weise über den Umgang der Menschen miteinander in Partnerschaft und Beruf, in der Familie, in unserer Gesellschaft reflektiert. Ernst und heiter, mit satirisch-ironischen, aber auch ganz leisen Tönen wird da erzählt: Von einer Schwangerschaftsunterbrechung, die die Betroffene eine Bilanz ihres Lebens ziehen läßt, von einem besessenen kleinen Erfinder, den sie Kugelblitz nennen, von der Einsamkeit und Angst einer Sterbenden. Und weil für eine Dichterin wie Helga Königsdorf nichts unmöglich ist, kann sie auch einen Ehemann in eine Ameise verwandeln, oder sie führt ihren Lesern vor, wie es so zugeht in himmlischen Gefilden, wenn dort ein Philosoph, ein Ökonom, ein Dichter und eine Käseverkäuferin wider Willen zusammentreffen.
Auch diese Geschichten der Autorin sind, wie es in der Laudatio zum Heinrich-Mann-Preis heißt: »… angefüllt mit Erfahrungen, gelebtem und gesehenem Leben, mit Komik und Trauer, mit Realität und dem Spiel der Phantasie.«
Helga Königsdorf
Lichtverhältnisse
Geschichten
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Kugelblitz
Sachschaden
Unterbrechung
Die geschlossenen Türen am Abend
Die Himmelfahrt des Philosophen Bleibetreu
Vertrauen
Polymax
Gewitter
Die Ameisenmetamorphose
Kirchgang
Reise im Winter
Der Rummelplatz
Über Helga Königsdorf
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Kugelblitz
Es kostete Mühe, an diesen Tod zu glauben. Man konnte davon lesen, ohne daß sich ein Gefühl von Endgültigkeit einstellen wollte. Man mußte schon die Vernunft bemühen, die auch sofort mit Argumenten zur Hand war, denn die Zahl der Jahre entsprach den statistischen Prognosen. Kein Drama also, sondern ein fälliges Ereignis. Anlaß für Bilanz. Anlaß für Deutungen und Umdeutungen. Vieles würde gesagt werden. Vieles verschwiegen. Daran war nichts Ungewöhnliches. Wen kümmerte schon, daß es jemanden gab, den gerade die Auslassungen betrafen. Betroffen hatten.
Friedrich Kummer legte die Zeitung beiseite, räumte das Frühstücksgeschirr in die Kochnische und gab Hansi, dem Kanarienvogel, frisches Wasser. Nun blieb nur noch, das Radio abzustellen und die Blechbüchse mit den Frühstücksbroten in die Aktentasche zu schieben. Die Schuhe standen auf dem Flur bereit. Der Anorak hing am Garderobenhaken. Alles hätte seine Ordnung gehabt, wäre wie immer gewesen. Aber er verhielt mitten in den gewohnten Abläufen und starrte auf den braungeränderten Fleck an der Zimmerdecke.
Zu seiner eigenen Verwunderung empfand er weder Bitterkeit noch Zorn. Im Gegenteil. Freundlich, beinahe gerührt konnte man sein Gedenken an den Verstorbenen nennen, und das war mehr, als man von ihm erwarten durfte, denn der Tote trug Schuld daran, daß Friedrich jetzt in einer tristen Kreisstadt zwischen renovierungsbedürftigen Wänden in der Gesellschaft eines Kanarienvogels hauste.
Er entfaltete die Zeitung wieder und las noch einmal den Nachruf auf den verdienten Erfinder Rudolf Knack. Sein Name sei über die Grenzen des Landes hinaus bekannt geworden, stand da in unbeteiligter Druckerschwärze. Seine Erfindungen hätten eine ökonomische Tragweite, deren Umfang gar nicht hoch genug einzuschätzen wäre. Von Stehvermögen war die Rede. Trotz bürokratischer Widerstände …
Trotz bürokratischer Widerstände. Friedrich sagte diese Worte laut vor sich hin und klopfte mit der Handfläche skandierend den Takt dazu auf die Tischplatte. Der tote Erfinder – ein guter Erfinder, von dessen Schrullen man nachträglich großmütig abstrahierte. Jetzt, da man seiner sicher war, da alles feststand, würde man ein Denkmal errichten. Jede Zeit braucht ihre Helden, und dieser konnte sein eigenes Bild nicht mehr verderben. Ein Denkmal, das zugleich Rehabilitierung für ihn bedeutete. Für Friedrich Kummer, der dasaß, in Socken, die Brotbüchse und die geöffnete Aktentasche neben sich. Eine späte Rechtfertigung mit dem einzigen kleinen Schönheitsfehler: Es interessierte sich niemand mehr dafür. Die Zeit seiner ersten Begegnung mit Knack wurde bereits als Geschichte verbucht.
Damals war Friedrich ein junger Assistent am Forschungsinstitut für Meta-Makrologie und hatte eine fest umrissene Aufgabe. Die experimentelle Lösung gab zu Rätseln keinen Anlaß. Eine Fleißarbeit, mit der er seinen ersten Doktorhut verdienen sollte und seinem Leiter ein Stück vom zweiten. Krieg und eine bis vor kurzem durchlässige Grenze hatten für Lücken in der Wissenschaftshierarchie gesorgt. Aber es gab ehrgeizige Pläne. Schenkte man denen Glauben, so würde das Land in kürzester Zeit nur noch von Ingenieuren und Wissenschaftlern bevölkert sein. Ein junger strebsamer Mensch, der brav seine Prüfungen absolvierte, konnte sich durchaus einiges für die Zukunft ausrechnen. Solche Überlegungen wollte Friedrich Kummer allerdings später nicht mehr wahrhaben, und er schüttelte entrüstet den Kopf, traf er auf dererlei Gedanken in der nächsten Generation.
Aber sogar jetzt, am Tisch sitzend, die Zeitungsanzeige betrachtend, konnte er sich das Gedankenspiel nicht versagen, aufzulisten, was wohl die Zukunft für ihn bereitgehalten hätte, wäre er Rudolf Knack nicht begegnet. Vielleicht stünde er an der Spitze eines Instituts, wäre technischer Direktor oder lehrte an einer Universität. Mochte sein, man hätte ihn gar zum Akademiemitglied gewählt. Das alles wäre möglich gewesen. Die Schicksale gleichaltriger Kollegen aus jenen Jahren, die sich, wie es Friedrich Kummer erschien, durch nichts vor ihm ausgezeichnet hatten, bewiesen es.
Aber das waren fruchtlose Grübeleien. Die Weichen seines Lebens waren durch Rudolf Knack gestellt worden.
Als Friedrich nach beendigtem Studium in das Institut eintrat, war dort der Stern Knacks bereits im Niedergehen. Er hatte eine Art Narrenfreiheit genossen. Aber dann hielt ein straffer Leitungsstil Einzug. Der neue Direktor, ein energischer Mittdreißiger, verkündete in seiner Antrittsrede, die Zeit des Dilettantenparadieses sei endgültig vorüber. Es gehörte zu seinen ersten Amtshandlungen, Knack als Bereichsleiter abzulösen, weil dieser nicht die erforderliche Qualifikation nachweisen konnte. Aber noch durfte Knack seinen eigenen Einfällen nachgehen, unterstützt von einem Laboranten, der kurz vor der Berentung stand und den niemand sonst haben wollte.
Rudolf Knack war ein kleiner Mann mit gesträubtem Kopfhaar und etwas hervorquellenden Augäpfeln. Ansonsten gab es von seiner körperlichen Erscheinung nichts Einprägsames zu vermelden. Dennoch hinterließ er überall, wo er auftauchte, einen unauslöschlichen Eindruck. Nichts war ihm so fremd wie Bescheidenheit und Fähigkeit zum Unterordnen. Er signierte schon damals seine Briefe mit dem selbstverliehenen Titel »Erfinder«, was ihm erst Spott, dann zunehmend Ablehnung und Feindschaft eintrug. Zwar besaß er kein Zertifikat, jedoch ein Autodidaktenwissen von erstaunlicher Breite. Seine Sprache war nicht die übliche wissenschaftlich sachliche, sondern eine eigene, bildhafte. Das verleitete manchen, ihn nicht ernst zu nehmen. Meldete er sich in einer Veranstaltung zu Wort, begann es meistens mit einer scheinbar naiven Anfrage, die der Befragte mit einer kurzen Bemerkung abzutun glaubte. Doch genau auf diese Bemerkung schien Knack gewartet zu haben. Sofort folgte der Nachstoß. Und der traf. Hatte Knack sein Opfer erst am Haken, ließ er so schnell nicht locker. Ohne Ansehen von Rang und Person. Ohne die geringste Verbindlichkeit. Einmal kam es nach dem Vortrag eines ausländischen Gastes fast zu einem Skandal, woraufhin Knack Teilnahmeverbot an den wissenschaftlichen Veranstaltungen des Hauses erhielt. Wegen Hemdsärmligkeit.
Dann kam die Zeit der Reformen. Von Profilbereinigung und Konzentration war die Rede. Die Pläne wurden immer langfristiger. Wollte man den Papieren trauen, waren wissenschaftliche Weltrekorde abzuhakende Alltäglichkeiten. Die Knackschen Forschungsthemen fielen wegen zu geringem Potentialeinsatz dem Rotstift zum Opfer und damit auch die von ihm benötigten Geräte und Chemikalien. Er bombardierte sämtliche in Frage kommenden Instanzen mit Eingaben und Beschwerden, wobei er keinen Zweifel an seiner Überzeugung ließ, das Institut werde von einer Herde beamteter Dummköpfe verwaltet.
Von all dem ahnte der neue Assistent Friedrich Kummer nichts. Noch unvertraut mit den örtlichen Gegebenheiten irrte er in einer Tür und geriet in Knacks Laborraum. Er wollte sich mit Entschuldigungen zurückziehen, doch der kleine Mann winkte ihn herein und begann, ohne Umschweife über sein laufendes Experiment zu fachsimpeln, als hätten sie ein längeres Gespräch nur mal so eben für eine kleine Weile unterbrochen gehabt. Auch befragte er den Jüngeren in diesem und jenem Punkt um seine Meinung. Friedrich, noch bereit, vor jedem, der länger dem Institut angehörte als er selbst, Respekt zu empfinden, verließ Knack geschmeichelt und mit dem Vorsatz, in der Literatur nachzulesen, um sich das Zutrauen, das ihm entgegengebracht wurde, auch zu verdienen. Die Kollegen reagierten mit nachsichtigem Spott, als bekannt wurde, der Neuling sei auf Kugelblitz hereingefallen. Einmal hatte Knack elektrische Entladungen durch ein Gefäß mit Stubenfliegen geleitet und hartnäckig behauptet, er habe einen Miniaturkugelblitz beobachtet, als eine der Fliegen in den Entladungsfunken geriet. Aber das Experiment erwies sich als nicht reproduzierbar, denn die Fliegen waren nie dazu zu bewegen, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein. Niemand hatte seinem Bericht Glauben geschenkt.
Kugelblitz. Man hätte keinen treffenderen Namen für Rudolf Knack finden können, dachte Friedrich Kummer. Er holte eine Schere vom Regal und schnitt die Anzeige aus. In Gedanken sah er sich bereits ein Buch verfassen und in großen Lettern den Titel schreiben: Kugelblitz. Gab es einen Berufeneren als ihn, sich zu diesem Leben zu äußern. Trug er nicht geradezu eine höhere Verantwortung. Diesem Gedanken nachsinnend, stellte er überrascht fest, daß er noch nicht auf einer Endstation angelangt war, unabhängig von seinen derzeitigen geographischen Bestimmtheiten. Die Wahrheit über dieses Leben durfte nicht verschwiegen werden. Auch wenn sein Einsatz diesmal einem Toten galt, er mußte seinen Weg mit Rudolf Knack zu Ende gehen. Daran konnte ihn niemand hindern. Ebensowenig, wie ihn damals die spöttischen Bemerkungen der anderen davon abhalten konnten, immer häufiger als Gast im Nachbarlabor aufzutauchen.
Es hatte ihn immer wieder dorthin gezogen. Da er noch wenig Erfahrung besaß, ergab sich bei seinen experimentellen Arbeiten manche Unsicherheit. Er scheute sich, seine scharfzüngigen Kollegen um Rat zu fragen. Knack dagegen erwies sich in solchen Fällen als geduldiger Lehrmeister. Seinerseits schien er erfreut zu sein, in dem jungen Mann einen interessierten Zuhörer gefunden zu haben, dem er seine Pläne erklären konnte. So kam es, daß Friedrich allmählich in die phantastisch anmutenden Projekte des Erfinders eingeweiht wurde. Auch von der Erzeugung künstlichen Hochleistungschlorophylls war schon die Rede gewesen, wobei sich weder Kummer noch Knack der gewaltigen technologischen Konsequenzen einer derartigen Entdeckung bewußt waren. In dieser Zeit jedenfalls noch nicht.
In dem überfüllten Laborraum Knacks liefen meistens mehrere Versuche gleichzeitig, da der Erfinder jeder neuen Idee leidenschaftlich anhing. Eine kritische Wertung fiel ihm schwer.
»Nun?« schloß er eine seiner Erläuterungen zur Chlorophyllsynthese und sah Friedrich beifallheischend an.
Dieser wollte etwas Anerkennendes erwidern, zögerte aber, da er zu enthusiastischen Ausbrüchen, wie sie Knack befriedigt hätten, nicht fähig war. Im Umgang mit Knack mußte er ständig gewärtig sein, den Fehdehandschuh hingeworfen zu bekommen. Er parierte durch Ausweichen ins Unernste. So pegelte sich zwischen ihnen ein etwas ruppiger Ton ein, durch den sie sich aber beide nicht gekränkt fühlten.
»Nun?« hatte Knack seine Frage wiederholt und Friedrich herausfordernd angestarrt.
»Erst mal abwarten, ob es stimmt«, erwiderte Friedrich, wohl wissend, daß er den anderen enttäuschte.
»Ob es stimmt!« brauste Knack auf. »Das ist genau die Reaktion von Leuten, deren geistige Energie niemals für eine Erleuchtung ausreicht. Hämisch abwarten, ob es schiefgeht. Und das passiert ja auch in neunundneunzig Prozent aller Fälle. Darum können sich solche Typen die Hände reiben. Sie sind a priori die Kings. Wenn du nur bei dem verbleibenden einen Prozent hinterher schnell genug die Kurve kriegst, kannst du groß rauskommen.«
»Mach ich«, erwiderte Friedrich grinsend. »Wirklich. Mach ich. Wenn es stimmt.«
Eines Tages wurde der Assistent Kummer über Sprechfunk zu seinem Abteilungsleiter gebeten. Dieser, nur wenige Jahre älter als Friedrich, sah ihn prüfend an, seufzte und wies auf einen Stuhl.
Er habe im Leben die Erfahrung gemacht, daß man Menschen sehr wohl nach dem Umgang, den sie bevorzugten, beurteilen könne. Er wolle indessen davon absehen, dieses Verfahren auf Friedrich Kummer anzuwenden, denn er halte ihm seine Unerfahrenheit zugute. Jedoch setze er voraus, daß sie einer Meinung wären: Jemand, dem man Arbeitsmöglichkeiten einräume, die sich andere erst durch Leistung verdienen müßten, hätte alle Veranlassung, seinerseits ein wenig Dankbarkeit zu zeigen. Was sei aber davon zu halten, wenn dieser Jemand statt dessen seine Wohltäter verleumde und gegen sie intrigiere?
Bei diesen Worten reichte er Friedrich die Kopie eines Briefes von Rudolf Knack an eine höhere Leitung. Friedrich las und erschrak. Hier beherrschte einer die Spielregeln nicht. Oder wollte sie nicht beherrschen.
Es gibt eine Sorte Menschen, fuhr der Abteilungsleiter fort, die können gar nicht anders, als ständig Unruhe stiften. Ein Leiter, der für die Arbeitsatmosphäre seiner Einrichtung die Verantwortung trage, müsse Querulanten wie Knack wohl oder übel möglichst schnell eliminieren. Oder doch wenigstens isolieren.
Er untersagte Friedrich jeden weiteren dienstlichen Kontakt zu Rudolf Knack. Danach kam er auf die Arbeit des Assistenten Kummer zu sprechen und endete mit einigen kritischen Bemerkungen zu deren Fortgang.
Friedrich hatte nach diesem Gespräch eine beschämende Verunsicherung empfunden. Einerseits konnte er sich den Argumenten seines Leiters nicht verschließen, und es bedrückte ihn, Menschen, die er achtete, durch seine unbewußte Solidarität mit einem Übelgesonnenen beleidigt zu haben. Andererseits wollte sich bei ihm kein Abscheu, ja nicht einmal Abneigung gegen Knack einstellen. Eher bangte er um den Erfinder und um dessen Pläne. Was sollte nun aus dem Chlorophyllexperiment werden, auf dessen Ausgang sie beide gespannt gewesen waren. Aber er hatte eine Weisung erhalten und hielt sich daran. Wenn auch mit Gewissensqualen.
Davon sollte er bald befreit werden. Die Eliminierung Rudolf Knacks fand schneller statt, als abzusehen war. In jener Zeit begann man auch im Ausland an der Chlorophyllsynthese zu arbeiten. In einem Übersichtsartikel wurden unter anderem Resultate Knacks erwähnt, von denen in seinem Institut niemand etwas ahnte. Damit lag eindeutig ein Verstoß gegen die Anordnungen vor. Knack hatte seine Ergebnisse der Öffentlichkeit ohne Genehmigung preisgegeben. Er war fristlos entlassen worden.
Wie lange das schon her war. Aber noch heute quälten ihn diese Erinnerungen.
Friedrich Kummer schob Brotbüchse und Zeitungsausschnitt in die Aktentasche und machte sich auf den Weg.
Er hatte den Zwiespalt seiner Empfindungen mit den Jahren verdrängt, aber nicht bewältigt. Insgeheim beneidete er Menschen, die konsequent Partei ergreifen konnten und die durch nichts zu verunsichern waren. Er hingegen neigte dazu, die Dinge bald von der einen, bald von der anderen Seite aus zu sehen, und die Sichten, die sich ihm boten, standen nicht selten im Gegensatz zueinander. Aus diesem Hang zum Tüfteln und Deuteln resultierte ein Mangel an Persönlichkeit, der ihm selbst bewußt war, ohne daß er daran etwas zu ändern vermochte.
Wurde der Lebensweg eines Menschen wirklich so wesentlich von Zufällen bestimmt, wie man das gewöhnlich annahm? Hatten ihn zum Beispiel die Begegnungen mit Rudolf Knack aus der Bahn geworfen, wie er sich das lange Zeit einreden wollte? Lag nicht vielmehr das meiste in der eigenen Person begründet. Allein die Tatsache, daß Knack sich später ausgerechnet wieder an ihn wandte, war sicher kein Zufall. Jeder andere hätte den Erfinder kaltblütig abblitzen lassen, weil ein Handel mit diesem Menschen ein verdammtes Risiko darstellte. Die negativen Eigenschaften Knacks lagen auf der Hand. Selbstgerecht und rücksichtslos. Den Gefühlsregungen seiner Mitmenschen hatte er nicht die geringste Beachtung geschenkt, sondern seine Legitimation einzig und allein aus der eigenen Opferbereitschaft für eine Idee abgeleitet. Aber gerade das war es, wovon sich Friedrich angezogen fühlte.
Nach Knacks Entlassung mochten ungefähr zwei Jahre vergangen sein. Als Friedrich an einem frostkalten Winterabend das Institut verließ, sah er Knack unter der Bogenlampe auf der anderen Straßenseite stehen und heftig winken. Der kleine Mann schien überhaupt nicht verändert. Sie waren noch kaum zehn Meter nebeneinander gegangen, da befand sich Knack schon mittendrin im Bericht über sein derzeitiges Experiment. Zu Hause. Auf dem Küchentisch. Er war gekommen, um ihn dazu einzuladen. »Du wirst staunen«, sagte er und stampfte sich auf dem hartgefrorenen Boden die Füße warm. Friedrich war erleichtert, daß der andere ihm nichts nachtrug.
Knack wohnte in einer dörflichen Vorortstraße. Seine kleine, unwahrscheinlich dicke Frau hing an ihm mit einer bedingungslosen Gläubigkeit. Aber die Bewunderung, die sie für ihn empfand, beraubte sie nicht der eigenen Individualität. Im Gegenteil. Die fröhliche, tatkräftige Konsequenz, mit der sie bereit war, sich seinen Zielen unterzuordnen, hatte etwas Erhabenes.
Es gab keinen Winkel im Haus, der nicht allmählich Werkstattcharakter annahm. Das Büfett im Wohnzimmer, wo normale Leute ihr gutes Geschirr aufbewahrten, diente als Ersatzteillager. Das Bad glich eher einem chemischen Labor. Das Herz des ganzen Unternehmens befand sich auf dem Küchentisch. Hier stand eine Anlage, die etwas produzierte, von dem Knack behauptete, es sei künstliches Chlorophyll. Noch nicht effektiv. Ökonomisch noch nicht verwertbar. Aber immerhin.
Von nun an fuhr Friedrich häufig zu den Knacks. Zwei- oder dreimal in der Woche. Sie diskutierten und werkelten bis tief in die Nacht. Hin und wieder war auch ein Handwerksmeister aus der Nachbarschaft zugegen, der für Knack kleine Aufträge erledigte. In den Bibliotheken kannte man sie als ungeduldige Kunden. Aufgeregt warteten sie auf jedes neue Heft der einschlägigen Fachzeitschriften, immer in Sorge, es könnte ihnen jemand auf den Fersen sein und an ihnen vorbeiziehen, weil er bessere Bedingungen hatte.
Friedrich war seit einem Jahr verheiratet, und seine Frau Margrit erwartete ihr erstes Kind. Durch seine häufige Abwesenheit fühlte sie sich vernachlässigt. Sie machte ihm Vorwürfe und weinte manchmal. Friedrich hingegen fühlte sich unverstanden. Er fand sie kleinlich. Ein Vergleich mit der Frau Knacks fiel nicht zu Margrits Gunsten aus.
Eines Tages stockten Knacks Untersuchungen. Ohne ein Thermozet konnten die Energiebilanzen nicht nachgeprüft werden. Von diesen kleinen elektronischen Importgeräten gab es in Friedrichs Institut mehrere Exemplare, die manchmal monatelang nicht benutzt wurden. Er hatte keine Bedenken, eines zu entleihen. Natürlich konnte er sich unter den gegebenen Umständen keine Genehmigung einholen.
Wenige Wochen später klingelte ein hagerer, streng aussehender Herr bei den Knacks, der sich als Gerichtsvollzieher auswies. Rudolf Knack stand tief in der Kreide. Unter anderem waren zwei Darlehensverträge, die größere Summen betrafen, fällig. Der Gerichtsvollzieher entdeckte das kostbare Meßinstrument mit der Inventarnummer des Institutes für Meta-Makrologie, und da ihm dieser ganze Haushalt nicht geheuer vorkam, erstattete er vorsichtshalber Anzeige.
Die Disziplinarmaßnahmen gegen Friedrich Kummer schlossen eine strenge Rüge und die Absetzung seines laufenden Promotionsverfahrens ein. Von einer Gerichtsverhandlung wurde abgesehen, weil er sich hinreichend reumütig zeigte und ohne Einwände einer Strafversetzung in einen kleinen Betrieb im Norden des Landes zustimmte. Seine Frau war zwar mit ihm gezogen – was ihr viele hoch anrechneten –, doch ihr Verhältnis änderte sich.
Margrit nahm nun die Ruder ihres gemeinsamen Lebens fest in die Hand. Sie bekamen ein zweites Kind, eine größere Wohnung und ein Auto. Abends erwartete sie Rapport von seinem Tag. Er setzte sich nicht zur Wehr, denn es hatte auch etwas Beruhigendes. Er erinnerte sich an keinerlei Anfechtungen aus jenen Jahren, die scheinbar gleichförmig dahingingen. Höchstens, daß sich nachträglich das Gefühl einstellte, er habe diese Zeit in irgendwie herabgemindertem Zustand verbracht. Aber das war eine rückwärtige Interpretation. Die alten Geschichten gerieten in Vergessenheit. Sein Name stand in den Kaderentwicklungsplänen. Er wurde Nachfolgekandidat für den technischen Direktor. Kurz, sein Lebensschiff schien wieder auf festem Kurs. Nur gab es da noch irgendwo einen Mann namens Rudolf Knack.
Eines Tages erhielt er eine Ladung zur Abteilung Inneres in Sachen Knack. Friedrich hatte für einen Moment das Empfinden, Anwärter auf einen Nervenzusammenbruch zu sein. Als dieser ausblieb, redete er sich in Zorn. Aber es gelang ihm lediglich eine Zornfassade. In Wirklichkeit gelüstete es ihn sehr, Nachricht vom Schicksal des Erfinders zu erhalten. Doch diese wurde ihm zunächst nicht zuteil. Vielmehr sollte er selbst Auskunft zu dessen Person und Treiben geben. Er hatte sich damals dieses Ansinnens mit dem Hinweis, bezüglich des neuerlichen Fortgangs nicht sachkundig zu sein, entledigt.
Mit solchen Erinnerungen befaßt, nahm Friedrich seinen gewohnten Weg über holpriges Kopfsteinpflaster, vorbei an windschiefen Fachwerkhäusern. Er überquerte den Marktplatz, zwängte sich zwischen parkenden Autos hindurch und erreichte die enge Nebenstraße, in der sich seine Dienststelle befand. Es schien ihm, als hätten die vertrauten Straßen und Plätze härtere Konturen bekommen. Die Nachricht aus der Zeitung hatte seine Sinne geschärft. Eine Art übermütiger Aufbruchstimmung bemächtigte sich seiner. Kehrten sich nun nicht alle Vorzeichen um? Wurden nicht die einstigen Katastrophen zu den eigentlichen Höhepunkten?
Wie war das damals weitergegangen? Er hatte mit gebotener Vorsicht versucht, etwas über den Verbleib des Erfinders in Erfahrung zu bringen. Doch seine Nachforschungen blieben erfolglos. Er hörte erst wieder von Knack, als er vom Minister für Meta-Makrologischen Anlagenbau zu einer persönlichen Aussprache gebeten wurde.
Der Minister war ein älterer Mann mit ungesunder Gesichtsfarbe. »Es wäre sehr schön«, sagte er zu Friedrich, »wenn Sie sich die neueren Arbeiten Rudolf Knacks einmal ansehen würden.«