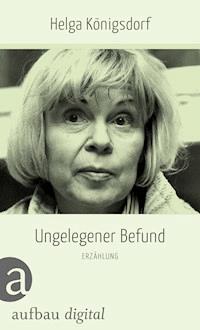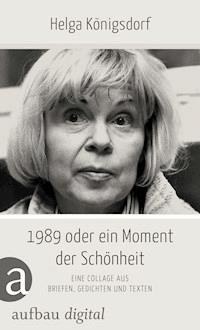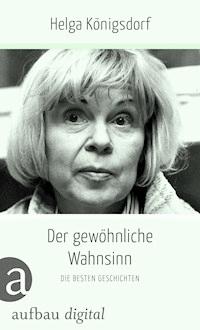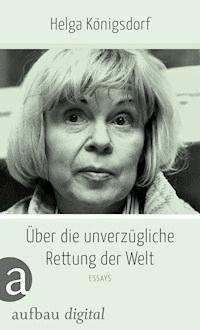9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Nacht, in der man auf der Berliner Mauer tanzte, scheint schon eine halbe Ewigkeit zurückzuliegen. Jedenfalls für die Bewohner im 7. Stock eines Mietshauses im Osten der Stadt. Was den Menschen in diesem Roman widerfährt, hat mit dem Alltag der deutschen Einheit zu tun. Helga Königsdorf hält sich mit der ihr eigenen Ironie die Geschehnisse auf Distanz - um erst recht herauszufinden, wie diese emotionsgeladene Zeit niemanden unberührt ließ.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
Die Nacht, in der man auf der Berliner Mauer tanzte, scheint schon eine halbe Ewigkeit zurückzuliegen. Jedenfalls für die Bewohner im 7. Stock eines Mietshauses im Osten der Stadt.
Was den Menschen in diesem Roman widerfährt, hat mit dem Alltag der deutschen Einheit zu tun.
Helga Königsdorf hält sich mit der ihr eigenen Ironie die Geschehnisse auf Distanz – um erst recht herauszufinden, wie diese emotionsgeladene Zeit niemanden unberührt ließ.
Helga Königsdorf
Im Schatten des Regenbogens
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Buch lesen
Über Helga Königsdorf
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Niemand konnte sich erinnern, die Farben der Blumen und der Schmetterlinge je so strahlend erlebt zu haben. Das Gelb des Löwenzahns hatte bereits im April die Rasenflächen in leuchtende Teppiche verwandelt. Die Sonne schien tagein, tagaus. Wie immer war die Liebe zum ersten Mal, und die Lustbarkeit des Sommers zog bis in den letzten Winkel der Stadt. Kinder wurden geboren. Sie hießen Sabrina oder Felix. Die Menschen trugen bunte Kleider und wendeten ihre Gesichter zum Licht.
Sie vergaßen sogar zu sterben. Die Bestattungsunternehmer sahen besorgt zum Himmel, ob nicht bald Regen käme. Aber selbst die Nachfrage bei den Intensivstationen der großen Krankenhäuser, zu deren Personal die Tüchtigen unter ihnen Beziehungen aufgebaut hatten, ergab eine Fehlmeldung. Und das nun schon seit Wochen.
Die Stadt pulsierte und veränderte sich täglich. Aber das waren alles Geringfügigkeiten, verglichen mit den Plänen, die es für sie gab, damit sie für die Mächtigen des Landes empfangsbereit würde. Die Bewohner der Stadt lasen davon in der Zeitung und waren ein bißchen stolz. Aber sie hatten auch Angst, daß für sie kein Platz bleiben würde. Es wäre ihnen lieber gewesen, man hätte sie, wenigstens der Form halber, gefragt. Diejenigen, die sich in der Geschichte auskannten, wußten, daß es für die Stadt schon viele Pläne gegeben hatte. Sie sagten: Kommt Zeit, kommt Rat.
Die meisten nannten es noch immer »nach drüben gehn«, wenn sie die ehemalige Grenze vom Westen nach dem Osten, oder umgekehrt, überquerten, und sie brauchten dafür einen Grund. Dort, wo einst die Mauer die Stadt zerschnitten hatte, verteidigte man nun seine Kneipen gegeneinander. Es war, als läge die Nacht, in der man auf der Mauer getanzt hatte, schon eine halbe Ewigkeit zurück. Doch keiner konnte sich vorstellen, daß man sich noch einmal so trennen lassen würde. Und diejenigen, die insgeheim noch immer überzeugt waren, dieses Bauwerk hätte einstmals den Frieden gerettet, waren so sehr in der Minderheit, daß sie versuchten, dies möglichst schnell zu vergessen.
Keiner ahnte, was die Zukunft bringen würde. Aber die Zeit lief. Sie lief schneller und schneller.
Die Mieter der Eckwohnung im siebenten Stock des Hauses Paul-Meschkewitz-Straße dreiundachtzig, irgendwo im Osten der Stadt, wälzten sich nachts schlaflos auf ihren Lagern.
Niemand hatte sich je Gedanken darüber gemacht, welche Verdienste der Namensgeber der Straße eigentlich hatte. Die erklärenden Schilder waren lange verschwunden. Die Geschichte war der allgemeinen Gleichgültigkeit anheimgefallen. Auch die Akten darüber blieben unauffindbar. Deshalb trug die Straße, trotz beachtlichen zwischenbehördlichen Schriftverkehrs in dieser Angelegenheit, noch immer den alten Namen.
Die Nummer dreiundachtzig war eines jener Häuser, deren Zimmer den Geruch nach Beton nie völlig verloren. Sie waren schnell und mit schlechter Prognose errichtet worden. Die Fachleute hatten schon, als sich die Häuser noch im Rohzustand befanden, auf die schier unlösbaren Probleme hingewiesen, die dereinst mit ihrer Entsorgung verbunden sein würden. Die Hitze des Sommers hing auch nachts in allen Räumen. Aber die Hitze war nicht der eigentliche Grund dafür, daß die Bewohner der Eckwohnung im siebenten Stock keine Ruhe fanden. Sie waren Gestrandete, die eine Gemeinschaft verband, von der sie wußten, daß sie nicht von Dauer sein würde. Und keiner von ihnen hatte eine Vorstellung davon, wohin ihn die nächste Woge tragen würde. War das Klappen einer Tür zu hören, fanden sich bald alle mit übergeworfenen Kleidungsstücken und verlegenen Gesichtern in der Küche ein, als hätten sie nur auf das Signal gewartet: Ruth Makuleit, die einen nach dem anderen bei sich aufgenommen hatte. Der Alte, bei seinem Einzug noch formal Direktor eines Zahlographischen Institutes. Die Alice, die immer noch etwas von einer »Alice im Wunderland« an sich hatte und deren korrekter Name fast in Vergessenheit geraten war. Die alte Frau Franz. Und Herr Peteraut, der als letzter dazugekommen war. Ruth Makuleit kochte Tee, und es konnte geschehen, daß sie stundenlang herumsaßen und einander auf die Nerven gingen. Aber das Alleinsein war noch unerträglicher.
Ruth Makuleit, der Alte und die Alice kannten einander durch ihre Arbeit am Zahlographischen Institut seit mehr als zwanzig Jahren. Jeden Moment konnte zwischen ihnen Streit ausbrechen. Der Anlaß war meistens so unbedeutend, daß er hinterher nicht mehr auffindbar war. Man hatte zu viel seelische Atmosphäre im Bauch, und ein Gewitter war fällig. Der Blitz fuhr hin, wo es sich gerade anbot. Am Morgen begegnete man sich wieder in der Weise von Leuten, die einander nichts mehr vormachen können.
Der Alte sagte über sich und die Alice, sie seien bereits jenseits von Gut und Böse. Damit meinte er, daß sie sich gegenseitig alles angetan hätten, was Menschen einander antun konnten.
Im Frühsommer, als sie wieder einmal nachts in der Küche saßen, sagte Frau Franz: »In Wirklichkeit passiert kaum etwas, was es nicht in der Bibel schon gegeben hätte.« Die Vorgänge im Lande erinnerten sie an die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Nur wäre diesmal der Vater bereits tot.
Sie hatte von sich behauptet, Lehrerin gewesen zu sein. Auch Schauspielerin, Kriminalpolizistin und Stewardeß. Was niemand glaubte. »Deswegen erzähle ich es ja auch nicht gern.« Seufzte die alte Frau.
Frau Franz war knapp achtzig Jahre alt und wohnte schon länger im Haus als Ruth Makuleit. Sie hatte gedacht, ihr könnte nichts Schlimmes mehr passieren. »Wer solche Zeiten überlebt hat wie ich, wer sich so oft umstellen mußte, der hat gelernt, mit den Wölfen zu heulen, mit den einen oder mit den anderen. Da kann mir jemand erzählen, was er will.« Sagte Frau Franz.
Aber die neuen Wölfe heulten nicht. Die schwiegen und rechneten. Das hatte Frau Franz aus dem Gleichgewicht gebracht. Nachdem sie dreimal mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren war, um der Welt zu beweisen, daß es sie noch gab, als Person und nicht nur als Verwaltungsakt, und die Welt lediglich mit Rechnungen reagiert hatte, die ihr auf dem Postweg zugestellt wurden, hatte sie eines Tages Ruth Makuleit gefragt, ob sie zu ihr ziehen dürfte.
»Der Mensch ist nicht zum Alleinsein gemacht.« Sagte Frau Franz. Und Ruth Makuleit, die sich immer eine Familie gewünscht hatte, willigte sofort ein.
Eines Abends, sie wohnten noch allein in der Wohnung, hatte Frau Franz an Ruth Makuleits Zimmertür geklopft und sie mit geheimnisvoller Miene in das Eckzimmer gebeten. Dort lagen ihre Schätze ausgebreitet. Die »Wertsachen«, wie sie von Frau Franz genannt wurden. Schmuck und ein silbernes Tafelservice mit Goldeinlage. »Geschenk des französischen Königshofes an den sächsischen.« Sagte Frau Franz mit gedämpfter Stimme. Und dann erzählte sie, wie ihre Eltern die Weltwirtschaftskrise überstanden hätten. »Mit dem Mut, den einer hat, der sich im Besitz einer Rückversicherung weiß. Falls du verstehst, was ich meine.« Sagte Frau Franz. Nur wegen der Wertsachen habe der Bruder das Gymnasium besuchen dürfen. Und auch ihre eigene Ausbildung sei anders undenkbar gewesen. Noch nicht als Lehrerin. Das wäre sie erst nach dem Krieg geworden. Das Kriegsende habe sie irgendwo in Süddeutschland erlebt. »Ich weiß selbst nicht mehr genau, wo das war. Das ist alles so lange her.« Sagte Frau Franz. Aber daran erinnere sie sich, die Wertsachen habe sie, in Ölpapier verpackt, im Stollen eines Bergwerks versteckt. Erst vor den Amerikanern und dann vor den Russen. »Aber vor den Eigenen mußtest du dich genauso vorsehen. Da war der Bruder manchmal schlimmer als ein Wildfremder.«
In der Nachkriegszeit habe sie mit dem Bewußtsein gelebt, vor dem Ärgsten bewahrt zu sein. »Nie im Leben hätte ich sonst den Mut gehabt, mich scheiden zu lassen und mit zwei Kindern allein zurechtzukommen. Das waren damals noch ganz andere Zeiten. Mehr solche wie jetzt wieder. Da hatten es die jungen Frauen nicht so gut wie ihr, später.« An dieser Stelle kam sie ein bißchen aus dem Konzept, denn es fiel ihr ein, daß Ruth nie von einem Mann erzählte und daß sie auch keine Kinder hatte.
»Was ich nur sagen wollte: wenn wir hier zusammen wohnen, sind deine Schwierigkeiten auch meine.« Mit diesen Worten hatte sie das Gespräch beendet und keinen weiteren Kommentar geduldet. Ruth Makuleit hatte sich nicht zwischen Verärgerung und einer verlegenen Rührung entscheiden können. Manchmal ertappte sie sich nun dabei, daß sie dachte: Wenn es ganz schlimm kommt, sind da ja noch immer die Wertsachen.
Inzwischen waren sie zu fünft in der Wohnung. Die Alice hatte das Angebot Ruth Makuleits, bei ihr einzuziehen, sofort angenommen. Ruth Makuleit hatte sich das Zimmer, das neben dem Bad lag, reserviert. Die Alice war in das Nebenzimmer gezogen. Dem Alten, der nach seiner Ehescheidung ohne Bleibe gewesen war, hatten sie das große Balkonzimmer gegeben, was dieser verlegen abwehren wollte, aber die beiden Frauen bestanden darauf.
»Es mangelt ihm an Stil.« Hatte Ruth Makuleit gesagt, die sich erinnerte, wie der Alte das repräsentative holzgetäfelte Dienstzimmer seines Amtsvorgängers gleich zu Beginn seiner Zeit als Direktor verdorben hatte, indem er es durch Zwischenwände aus Preßplatten unterteilen ließ, um zusätzliche Arbeitsplätze für Mitarbeiter zu schaffen. Was diese gar nicht erfreute, denn durch den chronischen Raummangel konnte die lästige Präsenzpflicht immer wieder umgangen werden.
Frau Franz wohnte im Eckzimmer und Herr Peteraut im Durchgangszimmer. Die Zimmer von Frau Franz und vom Alten erreichte man nur über das Durchgangszimmer. Ruth Makuleit hatte den Schlafbereich im Durchgangszimmer durch einen Vorhang abgeteilt.
Es war ein Vorschlag der Alice gewesen, den Alten in der Wohngemeinschaft aufzunehmen. Ruth Makuleit hatte sofort zugestimmt. »Ihr müßt wissen, was ihr tut.« Hatte Frau Franz gesagt. »Aber dieser Mann bedrückt mich.«
Der einzige, dessen Lebenslauf für die anderen völlig im dunklen lag, war Herr Peteraut. Er war arbeitslos. Für ihn sprach, daß er die Miete für ein Vierteljahr im voraus bezahlt hatte und daß er wie Hans Albers aussah. Allerdings entpuppten sich jetzt Leute als Gauner, die man früher mit der größten Gewißheit als Biedermänner eingestuft hätte. Den Vorgänger von Herrn Peteraut hatten sie auch für vertrauenswürdig gehalten. Ruth Makuleit stellte es sich anstrengend vor, wie jemand anderes auszusehen und sich immer dafür rechtfertigen zu müssen, derjenige nicht zu sein.
In jener Frühsommernacht, in der Frau Franz das Gespräch auf den verlorenen Sohn gebracht und damit den Auftakt zu einer heftigen Diskussion gegeben hatte, trank Herr Peteraut seinen Tee stehend. In der einen Hand trug er den schwarzen Dederonbeutel, der etwas Schweres enthielt und den er immer mit sich führte. Aus der Art, wie er ihn hütete, schlossen die anderen, daß er etwas Kostbares enthalten müsse. Herr Peteraut war ausgehfertig gekleidet.
»Verzeihung! Ich gehe noch weg.« Sagte er höflich, stellte das leere Teeglas in die Spüle und strich unsichtbare Krümel vom Tisch. Schon von der Tür her setzte er noch hinzu: »Ich habe etwas zu klären.«
Das sagte er nicht zum ersten Mal. Am Anfang waren sie wirklich besorgt gewesen, der Mann könnte etwas Unbesonnenes vorhaben. Aber keines der Vorkommnisse, von denen die Zeitungen berichteten, ließ sich mit Herrn Peterauts Ausgängen in Zusammenhang bringen.
Jetzt war nur noch Frau Franz mißtrauisch. Als die Tür hinter ihm ins Schloß gefallen war, sagte sie: »Irgend etwas ist mit ihm nicht in Ordnung. Das könnt ihr glauben. Ein Mensch, der sich so verhält, immer mit diesem Beutel, der hat doch etwas zu verbergen. Irgend etwas treibt den um.«
»Manchen treibt es jetzt um.« Brummte der Alte.
»Könnte das nicht ein Terrorist sein!« Sagte Frau Franz.
»Ein Terrorist! Der Herr Peteraut! Niemals! Wieso ausgerechnet Terrorist?« Staunte Ruth Makuleit.
»Na ja. Ich will ja nichts gesagt haben. Aber es könnte doch eine Bombe sein, die er herumträgt.«
Es war still. In dem großen Haus. Und auf der Straße. Die Zurückgebliebenen hörten, wie sich die Schritte von Herrn Peteraut draußen allmählich entfernten. Aber es war keine gute Stille. Sie hatte etwas Lauerndes, Unheimliches, so als könnte sie jederzeit, durch einen Schrei oder einen Schuß zerrissen, ihr wahres wölfisches Gesicht zeigen.
»Ein Terrorist – niemals.« Sagte der Alte, der sich fast persönlich beleidigt fühlte, so als würde ein anderer vorgezogen.
Frau Franz sagte gekränkt, es wäre ihr doch nicht recht, mit einer Bombe vor der Tür zu leben.
Als Frau Franz »Gute Nacht!« wünschte, zog sich auch der Alte zurück.
»Ich bin überzeugt, der rettet jetzt die Welt.« Sagte die Alice. »Wenn ich an die Stromrechnung denke.« Seufzte Ruth Makuleit.
Währenddessen war Herr Peteraut durch menschenleere Straßen gegangen, hatte auf einem S-Bahnhof gewartet, war umgestiegen und fuhr nun in östliche Richtung. Unter den Mitfahrenden gab es eine Menge zweifelhafter Gestalten, die Peteraut musterten. Erblickten sie aber sein Gesicht, dem weder Angst noch Angriffslust, sondern nur Gleichgültigkeit abzulesen war, dann kümmerten sie sich nicht weiter um ihn. Solch ein Gesicht wirkte wie eine Vorahnung von Unglück.
Auf einem Vorstadtbahnhof verließ er die S-Bahn. Sein Weg führte ihn aus dem erleuchteten Bahnbereich heraus, durch ein kurzes Waldstück. Es war so dunkel, daß er die Arme nach beiden Seiten ausstrecken mußte, um sich tastend zu orientieren. Er verfügte offenbar über genaue Ortskenntnisse.
Nachdem er den Wald verlassen hatte, durchquerte er eine Kleingartenanlage. An einem großen, mit Drahtzaun abgesperrten Gelände, auf dem mehrere Lagerhallen standen, blieb er eine Weile stehen, als besänne er sich, was nun zu tun sei, und ging dann weiter.
Der Weg mündete in eine Allee, die von knorrigen Eschen und Kastanien gesäumt wurde, deren Äste sich hoch oben wie das Schiff einer Kirche wölbten. Jetzt stand der Mond flach über dem Horizont. Eine Rotte Wildschweine brach durch das Maisfeld linker Hand. Rechts tauchte ein Kasernengelände auf. Als der Mann schon ein Stück an den Kasernen vorüber war, begegnete ihm eine Gruppe Offiziere. Der eine stutzte, als er Peteraut erblickte, und sagte etwas zu seinen Kameraden, was Peteraut nicht verstand. Das Lachen brach ab. Die Männer wandten sich um und sahen Peteraut hinterher, der mit schnellen Schritten in der Dunkelheit eines ausgedehnten Waldgeländes verschwand, das sich bis zum nächsten Ort hinzog.
Mitten in der Nacht geckerte die Amsel, die ihren Schlafplatz auf dem Sims an der Hauswand hatte, weil die Straßenbeleuchtung in ihr ein Morgengefühl vortäuschte. Ehe sie jedoch dazukam, ihr erstes Tirili zu schmettern, war der Schlaf erneut über sie gefallen.
Die Alice schlief nicht. Sie stellte sich eine Wiese mit Klee vor und dachte darüber nach, wieso Klee, der doch am staubigsten Straßenrand wuchs, für sie fast zum Symbol für Reinheit wurde. Sie dachte jetzt oft die komischsten Dinge, auf die sie früher nie gekommen wäre und die scheinbar nichts mit ihr zu tun hatten und die sich doch alle irgendwie auf sie bezogen. Der Verstand marschierte keineswegs schnurstracks auf sein Ziel los. Der Verstand verweigerte sich noch immer. Verschloß sich Erkenntnissen, die der Seele geschadet hätten. Er umkreiste eine Sache erst einige Male, ehe er sie zerlegte, analysierte und eventuell ganz neu zusammensetzte, wodurch diese, obgleich die Bestandteile die alten waren, nun eine ganz neue Bedeutung erhielt. Manchmal war dieses Neue von solch einer verblüffenden Logik, daß die Alice selbst nicht fassen konnte, es lange Zeit anders gesehen zu haben.
In der Alice war die Erinnerung an ganze Perioden ihres Lebens ausgelöscht oder nicht mehr aufrufbar. Und sie war überzeugt, daß dies seinen Sinn hatte. Aus der Schulzeit waren nicht einmal Träume im Gedächtnis geblieben. Manchmal entdeckte sie jedoch Fähigkeiten bei sich, die nur damals in sie hineingeraten sein konnten. Lauter nützliche Dinge. Zum Beispiel konnte sie Socken stricken. Richtig mit Ferse und Spitze. Sie konnte mit offenem, arglosem Blick das Gegenteil von dem sagen, was sie für richtig hielt, und selbst bis zu einem gewissen Maß daran glauben.
Das Schicksal hatte sie bereits in jungen Jahren mit Begabung und Schönheit geschlagen. Und mit einer ehrgeizigen Mutter, die mit ihrer Tochter verwirklichen wollte, was ihr selbst nicht gelungen war. Der Bruder der Alice hatte sich solchem mütterlichem Ehrgeiz durch leichten Schwachsinn entzogen.
Knapp zehnjährig wurde die Alice bereits als Wunderkind herumgereicht. Sie nahm an sämtlichen Schülerwettbewerben weit oberhalb ihrer Altersklasse teil. Bei einer schriftlichen Prüfung war sie zum ersten Mal auffällig geworden. Sie hatte drei leere Seiten abgegeben. Die Mutter hatte das Kind eingeschlossen, aber zu ihrer Verwunderung schien es diese Maßnahme nicht als Strafe zu empfinden. Es stand stundenlang am Fenster. Wenn die Mutter hereinkam und das Kind ansprach, zeigte sein Verhalten nichts Auffälliges. Die Mutter hätte gern einen Arzt konsultiert. Sie war aber klug genug, sich zu sagen, daß man ihre Sorgen nicht ernst nehmen würde. Sie sorgte sich jedoch ernstlich. Wunderkinder hatten keine hohe Lebenserwartung. Das wußte sie. Aber es machte sie betroffen, daß der Zusammenbruch seine Zeichen so früh setzte. Allmählich richtete sie ihre Energie auf andere Dinge.
Seit dieser Zeit hatte die Alice als ein Talent auf dem Gebiet der Zahlographie gegolten, das zu den schönsten Hoffnungen berechtigte. Was sich später bestätigen sollte. Ihre Doktorarbeit enthielt die Lösung des berühmten Kurzschen Problems, das seit über hundert Jahren zu den großen offenen Problemen der Zahlographie gehörte.
Es hatte im Zahlographischen Institut der V(ereinigung) V(olkseigener) B(etriebe) der Wissenschaften nicht wenige gegeben, die der Alice dies mißgönnten. Ihr Ruf war ihr vorausgeeilt, bevor sie an das Institut kam. Die Neider sagten, von ihr stamme weder die Formulierung des Problems noch die Methode, mit der es nun, elegant, gelöst worden war. Nicht einmal die Idee, diese Methode auf das Problem anzuwenden, ginge auf sie zurück, sondern auf ihren Doktorvater. Für den hatte allerdings dieser sensationelle Ausgang überhaupt nicht im Bereich des Möglichen gelegen, und er wurde seines Lebens nicht mehr froh, als er bedachte, wie leichtfertig er die Aufgabe an eine Doktorandin abgegeben hatte, anstatt sie selbst zu bearbeiten. Kollegen rieten ihm, seinen Namen mit auf die entscheidende Publikation zu setzen. Aber da diese in einer internationalen Fachzeitschrift erfolgte, in der die Autoren alphabetisch aufgeführt wurden, wodurch sein Name an die zweite Stelle gerückt wäre, empfand er eine unüberwindliche Abneigung dagegen.
Damals war der Vorgänger des Alten noch im Amt gewesen. Der wurde später, auf einer Dienstreise in ein tropisches Land, das Opfer seiner Freßsucht. Er verspeiste eine übermäßige Portion Avocados und hatte gerade seinen Gastgebern versprochen, er würde ihnen das weibliche Wunder zur Besichtigung zusenden, wenn sie alle Kosten trügen. Er hatte noch gedacht, er müsse der Frau unbedingt raten, diese Früchte zu probieren, als er einen Druck in der Magengrube verspürte und einen Schmerz unter dem Schulterblatt. Das Blau des Himmels erstrahlte purpurrot. Dann wurde es in ihm dunkel.
Im Prinzip war dieses Ereignis überfällig gewesen. Der Alte hockte bereits in den Startlöchern, die führende Rolle der Partei auch im Zahlographischen Institut durchzusetzen. Eigentlich wollte er wohl eher die Rolle der landeseigenen Zahlographie in der Welt durchsetzen. Eine Rolle, die diese sich erst unter seiner Führung verdienen sollte. So waren die Ziele des Alten und der Partei nur auf dem ersten Blick in Übereinstimmung.
Als der Alte an das Zahlographische Institut berufen worden war, hatte sich die Alice auf der Stelle in ihn verliebt. Verliebtheit war bei ihr ein glückloser Dauerzustand gewesen. Wie die meisten Menschen hatte sie es sorgsam vermieden, ihren Verstand auf sich selbst zu richten.
In diesem Sommer lebte sie zum ersten Mal ohne bedrängende Zielstellung. Zum ersten Mal hatte sie Muße, über sich und ihre Rolle in der Welt nachzudenken. Man hätte auch sagen können, zum ersten Mal gab es nichts, keinen bedrängenden Termin, kein ungelöstes Problem, womit sie solchem Nachdenken den Weg verlegen konnte. Wenn sie nun erkennen mußte, welchen simplen Grundmustern sie gefolgt war und wie leicht es gewesen wäre, die Dummheiten ihres Lebens durch bewußtes Verhalten zu vermeiden, erfüllte sie eine große Verwunderung. Aber dann sagte sie sich, daß ihr solche Erkenntnisse nichts genützt hätten. Denn ein derart verständiges Leben wäre gar nicht ihr Leben gewesen, sondern ein fremdes, irgendwie reduziertes.
Eigentlich war es ihr immer um Liebe gegangen. Vielleicht gehörte sie zu den Menschen, die als Säuglinge zu wenig Zärtlichkeit empfangen hatten und denen der Hunger nach Zuwendung wie ein unauslöschbares Muster in die Seele eingraviert war.
Im Verhältnis zur Mutter hatte sie gelernt, daß Leistung Liebe einbringen konnte. Es war verführerisch, den Erfolg als das Eigentliche, die Bewunderung, die er einbrachte, als Ersatz für Liebe zu nehmen. Verführerisch und gefährlich. Nichts machte so schnell süchtig wie Erfolg, und der konnte niemals den eigentlichen Hunger stillen.
Das ganze Unglück begann damit, daß jemand geliebt werden wollte und sein eigenes Liebehabenwollen für Liebe hielt. Das wollten alle: geliebt werden. Aber an der Liebe herrschte in der Welt großer Mangel.
Aus Hunger nach Liebe konnte der Mensch so weit verkommen, daß er sich der schäbigsten Surrogate bediente. Der Heuchelei des Betrügers. Der falschen Schwüre. Der Streicheleinheiten der Macht. Des Jubels der Menge. Und in manchen Sommernächten eines Esels.
Aber nichts davon erlöste die Seele aus ihrer Not. Wie nach einem Strohhalm griff der Mensch nach dem Angebot eines Wir, um sein ungeliebtes Ich zu bergen. Er brauchte eine Heimat, einen Sinn, eine kollektive Idee, der er sich unterordnen, in deren Dienst er sich hervortun konnte, ohne daß es auf sein Ich angekommen wäre.
Die Alice hatte ein Gefühl, als wäre sie in einem Rausch von Klarsichtigkeit. Sie war bereit, sich auf sich selbst einzulassen. Langsam und allmählich. Sie mußte erst mit sich vertraut werden, sonst wäre sie vielleicht tot umgefallen. Einst ausgezogen, um geliebt zu werden und ohne zu wissen, wie man das macht, hatte sie alles mögliche gelernt. Nur nicht zu lieben. Die Liebe war immer noch wie eine unentfaltete Knospe in ihr. Aber die Blütezeit war vorbei.
Draußen dämmerte der Morgen. Die Amsel war längst ausgeflogen. Die Alice hing ihren Gedanken nach. Es schien ihr, daß ihr Verstand und ihre Seele nicht zusammenpaßten. Es war ein Glück, daß man Seelen nicht besichtigen konnte. Sie lachte ein bißchen vor sich hin, während ihr dieses und jenes einfiel. Und das war gut so. Sagte sie, sich selbst zur Ermutigung.
Sie war nur sechs Jahre jünger als der Alte. Doch gehörte sie einer anderen Generation an. In Zeiten großer historischer Umbrüche ist der Abstand zwischen den Generationen geringer. Der Alte hatte noch einen Eindruck von Gloria und Fall eines anderen Systems erhalten, wenn es auch Kindheitserinnerungen waren. Er gehörte zu den Autodidaktenjahrgängen, die, ohne Vorbilder, schnell zu Amt und Würden gekommen waren.
Manchmal hatte die Alice das Gefühl, als Kind und in ihrer Jugend ein anderer Mensch gewesen zu sein. Ein Mensch mit verminderter Fähigkeit zu einer eigenständigen Weltsicht. Sie war in einem Dorf aufgewachsen, hatte in ihren Kinderwelten gelebt und von Liebe geträumt. Die einzige Störung war der Ehrgeiz der Mutter gewesen. In jener Gegend sprachen die Menschen mit großer Bestimmtheit. Die Alice konnte sich nicht erinnern, daß die Mutter jemals eine Möglichkeitsform verwendet hätte. Es war die Stärke der Mutter gewesen, nie an sich zu zweifeln. Und die Alice hatte lange gebraucht, bis sie zum ersten Mal an der Mutter zweifelte. Ja, es hatte ein halbes Leben gedauert, bis sie gelernt hatte, die eigenen Unsicherheiten auch nur sich selbst einzugestehen. Und es war, als hätte in diesem Moment erst ihr bewußtes Leben begonnen.
Sehr früh hatte sie ein instinktives Anderssein empfunden. Alle Versuche, sich anzupassen, waren ab einer gewissen Grenze gescheitert. Das wurde von ihrer Umgebung sofort feinfühlig registriert und brachte ihr den Ruf ein, arrogant zu sein.
Die Alice hatte sich in die einfachen Wahrheiten der Zahlographie geflüchtet. Es schien ihr, als wäre sie kopfüber in ein Meer von Abstraktionen gesprungen und erst viel später wieder aufgetaucht. Auch die Sehnsucht nach einer Autorität war tief in ihr eingraviert. Um sich zu befreien, mußte sie erst einmal jede Autorität niederreißen und sich die Welt von Grund auf selbst erklären.
Was bedeutete zum Beispiel das Wort »deutsch« für sie? Wenn man sie gefragt hätte, ob sie sich als eine Deutsche fühle, hätte sie vielleicht, aus alter Gewohnheit, erst einmal abgewehrt. Sie hätte gelacht und behauptet, sie sei ein Indianer. Doch nach einigem Nachdenken hätte sie dann zugeben müssen, daß sie ein ziemlich deutscher Indianer wäre.
Sie war mit Karl May aufgewachsen. Karl May erhielt man durch Tausch. Zerlesene Bücher, denen manchmal die wichtigsten Seiten fehlten. Mut war ihr Problem gewesen. Unzählige Male hatte sie, in ihren Vorstellungen, am Marterpfahl gestanden und nicht mit der Wimper gezuckt. Nur der Mutter zuliebe hatte sie die erniedrigende Rolle des »lieben Mädchens« gespielt. Und die Mutter hatte nicht kapiert, daß da in Wirklichkeit der Große Häuptling stand, der Tapfersten einer, der sich fürchtete, abends im Dunklen allein gelassen zu werden.
Mut war die Frage. Ob man auf der richtigen Seite stand, dagegen nicht. Auch nicht, ob es so etwas wie eine richtige Seite überhaupt gab. Man war Apache und kein Sioux. Die Alice kannte niemanden, der nicht auf der richtigen Seite gestanden hatte. Man war Antifaschist. Man war für den Frieden. Man war für eine gerechte Welt. Für mehr konnte man gar nicht sein.
Immer wieder kamen ihr Zweifel, ob sie ihren Erinnerungen trauen durfte. Es war unglaublich schwierig zu rekonstruieren, was sie damals wirklich gedacht hatte, weil sich immer die Sicht und das Wissen von später darüberschoben. Sie bezweifelte, daß die »richtige« Seite überhaupt die Angelegenheit irgendeiner Logik gewesen war.
Nachträglich dachte sie auch, daß die Quelle für die Selbstgewißheit der Mutter in Wahrheit eine totale, aber verdrängte Verunsicherung gewesen sein mochte. Die Antworten, die diese Generation gegeben hatte, waren insgesamt enttäuschend ausgefallen. Nichts davon, wie ihnen das alles passiert war. Sie hatten damit nichts zu tun gehabt. Und wenn doch –, sie schwiegen. Vielleicht wollte sie auch niemand wirklich hören. Sie hatten erst Kaisers und später Führers Geburtstag gefeiert und dazwischen ein Stück unverstandenes, mißratenes Erwachsenendasein absolviert. Aber die Alice dachte, daß die eigene Bilanz kaum besser aussah. Auch sie hinterließen nichts. Aus Erfahrung wurde wieder keine Erkenntnis.