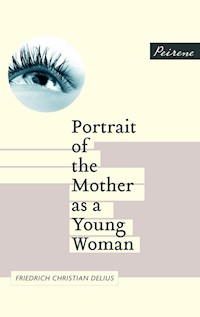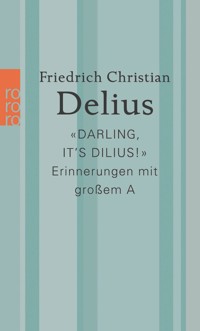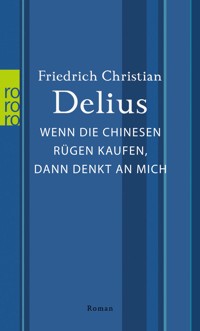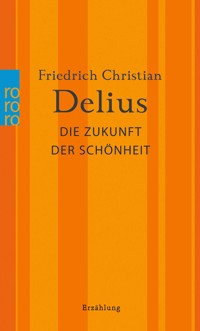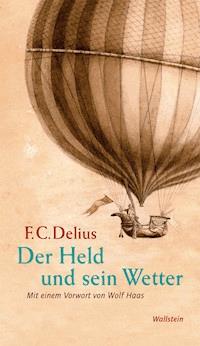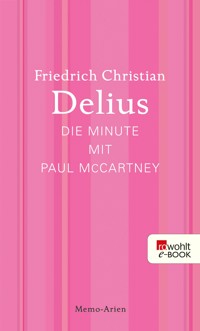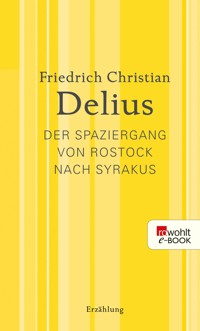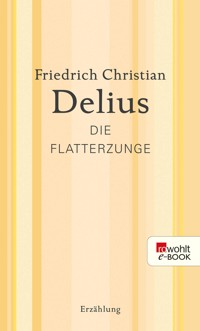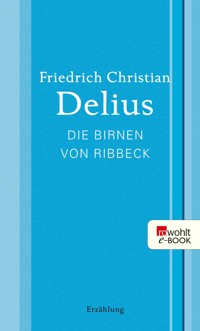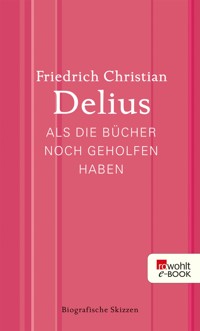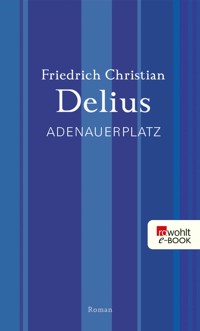
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Delius: Werkausgabe in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
Eine schicksalhafte Nacht in der Großstadt: Ein deutsch-chilenischer Wachmann auf der Suche nach Liebe, Zugehörigkeit und Gerechtigkeit. Felipe Gerlach, ein politischer Flüchtling aus Chile, arbeitet als Hilfswachmann bei der Firma «Secura» in einer bundesdeutschen Großstadt. Nacht für Nacht patrouilliert er rund um den tristen Adenauerplatz, prüft verschlossene Ladentüren und hält Ausschau nach Verdächtigem. Doch in dieser besonderen Nacht wird sein Alltag auf den Kopf gestellt. In immer überraschenderen Wendungen ergründet Friedrich Christian Delius die Chancen einer Rückkehr in die Heimat, die Möglichkeiten einer Einbürgerung im Deutschland der 80er Jahre und die Tragfähigkeit von Felipes Liebe zu seiner deutschen Freundin. Auch ein kleiner Kampf gegen einen zwielichtigen Südamerika-Spekulanten entspinnt sich. So wird aus dem vielschichtigen Gesellschaftsroman Adenauerplatz unversehens eine verhaltene Liebesgeschichte und ein diskreter Krimi. «280 Seiten gespannt, gerührt, zornig, atemlos.» (Die Zeit)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Friedrich Christian Delius
Adenauerplatz
Werkausgabe in Einzelbänden
Roman
Über dieses Buch
Der Deutsch-Chilene Felipe Gerlach lebt als politischer Flüchtling in einer bundesdeutschen Großstadt. Er hat einen Job als Hilfswachmann bei der Firma «Secura»: Unverdrossen läuft er rund um den tristen Adenauerplatz, prüft verschlossene Ladentüren und hält Ausschau nach verdächtigen Personen. So auch in dieser Nacht, in der der Roman spielt. Felipe versucht nach vorn zu blicken. Die Chancen der Rückkehr, die Möglichkeiten einer Einbürgerung im «ewigen Manövergebiet Deutschland», die Tragfähigkeit der Liebe zu seiner deutschen Freundin und der kleine Kampf gegen den Südamerika-Spekulanten Ellerbrock werden vom Autor in immer überraschenderen Wendungen durchgespielt. So wird aus dem vielschichtigen, suggestiven Großstadtroman, aus dem Nachtbuch «Adenauerplatz», unversehens eine verhaltene Liebesgeschichte und ein diskreter Kriminalroman.
«280 Seiten gespannt, gerührt, zornig, atemlos.» (Die Zeit)
Impressum
Die Arbeit des Autors an diesem Roman wurde durch den Deutschen Literaturfonds e.V. gefördert.
Neuausgabe August 2013 Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, August 2013
Copyright © 1984 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Walter Hellmann
ISBN 978-3-644-03611-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Leo acht
Am anderen Ende
Ein heller Mantel
Serenade
Der Adenauer
Das süßere Geld
Der kleine Sprung auf die andere Seite
Deutschlandlied
Fünf Autogramme
Wohin mit dem Knüppel
Rondo 1
Zwei Schläge
Unter Männern
Schritt für Schritt
Im schönsten Wiesengrunde
Lügt!
Bausteine einer Legende
Ein gefundenes Fressen
In den Bäumen
Rondo 2
LH 505
Liebesverbot
Nachtstück 1
Das laute Herz
Ein unbekannter Täter
Solidarische Empfindungen
Ein Markstück
Nachtstück 2
Wie das Licht fällt
Der Engel im Ofenrohr
Warten auf den Mann der Zukunft
Rondo 3
Azúcar, sugar, Zucker
Meter um Meter
Fensterplatz
Sachdienlicher Hinweis 1
Einzelgänger
Rolling Stones, Landreform
Zärtlichkeiten im Dienst
Nachtstück 3
Trauermarsch
Zwei Komplizen
Sachdienlicher Hinweis 2
Gift
Rondo 4
Die deutsche Spur
Plastik
Hinwendungen zu Deutschland
Zappelphilipp
Nachtstück 4
Dialog Nord-Süd
Der Freund Amerikas
Drei Schritte bis Sibirien
Nach Aktenlage
Sachdienlicher Hinweis 3
Schweinschwein
Alle Menschen werden Br…
Ein ziviler Prozess
Im stillen Meer der Nacht
Eine Ohrfeige
Rondo 5
Denkmal
Nachtstück 5
Geh nicht
Rollen lassen
Nur ein Juwelier
Sachdienlicher Hinweis 4
Kontrollgang
Nachruf
Der kleine Schweitzer
Freund oder Feind
Ein paar Tote
Rondo 6
Unter dem Pflaster
Sachdienlicher Hinweis 5
Durch die Wand
Nachtstück 6
Zweikampf
Sachdienlicher Hinweis 6
Alles okay
Alarmbericht
Im Westen geht die Sonne auf
Editorische Notiz
Rezensionen
Biographische Angaben
Leo acht
Es schlug neun, als Felipe Gerlach verkleidet war. In einer schweren, nachtblauen Jacke mit Uniformknöpfen, eine Krawatte an der Gurgel, auf dem Kopf eine Schirmmütze, so stand er für seine Rolle bereit. Er trug nicht die Mütze der Soldaten, der Polizisten, der Rotkreuzhelfer. Zivil gekreuzte Schlüssel kündeten von bester Absicht. An seinem Hosenbein war ein Stück Gummiknüppel zu sehen. Ein Funksprechgerät hing wie eine Waffe im Futteral. Alles da. Alle Knochen geordnet. Alles klar. Zwei Handgriffe auf die Jackentaschen, ein Gruß zum Kollegen in der Zentrale, dann verließ ein gut getarnter Mann die Etage der Wachgesellschaft Secura und begann seine erste Runde.
Das Abendlicht war von den Straßenlaternen schon fortgeschoben, der Himmel mit schwarzen Wolken gefleckt, und die dunklere Dämmerung rückte Schritt um Schritt näher. Gegen die Härte der Bürgersteigplatten wehrte sich der Körper mit ruhigen Bewegungen und fand allmählich zum gewohnten lockeren, achtunggebietenden Gang. Felipe Gerlach lief ohne Heftigkeit vorwärts, als habe er nur den einen Wunsch, federnd und leicht und wie von allein seine Strecke zurückzulegen. Ein Wettkampf gegen sich selbst oder gegen die Uhr. Ohne Zuschauer, ohne Schrittmacher, ohne Gegner.
Beim ersten Blick zur Seite in ein Gardinengeschäft sah er durch stramm gefaltete Mustertextilien sein Abbild gespiegelt huschen. Eine Vogelscheuche, eine Verbrecherscheuche. Eine Vogelscheuche, der es nicht gelang, das Gesicht der Uniform anzupassen. Die Unfähigkeit, eine ernste, ordnungswütige Miene aufzusetzen, erheiterte ihn. Die Kleider zu tauschen war er imstande, aber nicht das Gesicht zu wechseln wie ein Schauspieler. Ja, einen einzigen Vorsatz hatte er gefasst, als er sein Kostüm zum ersten Mal anprobieren musste. Beim geringsten Anzeichen, eins zu werden mit der Figur, die er darzustellen hatte, eins zu werden mit Uniform und Mütze und Knüppel, bei der ersten Einfühlung in seine Rolle wollte er sofort kündigen. An diesem Abend sah er keine Kündigungsgefahr.
Er bog in die Friedrichstraße ein. Hier fing das City-Revier an. Die Arbeit, Augen offen halten, Verdächtiges melden, einzelne Geschäfte kontrollieren. Von nun an hatte er dem Revierbuch zu folgen und hieß für die Zentrale Leo acht. Leo acht gab seine Position durch, Ebert/Ecke Friedrich.
Die Ampel sprang auf Rot, und Felipe bremste den schon begonnenen Schritt. Er hatte es nicht eilig, er grüßte hinauf zum freundlichen Warterot. Er übte Geduld. Alles Training, sagte er sich, alles Training. Warten, die Sekunden abschmeckend warten. Wenn er in Stimmung war, konnte er seinen Job als Übungsprogramm betrachten, Warten ohne nervös zu werden für Fortgeschrittene. Die Trainingsstunden kosteten nichts. Er hatte Glück, er verdiente sogar Geld damit. Fast zehn Mark für die Stunde Warten, Laufen, Beobachten, Laufen. Warten und denken: Dies ist nicht die Wirklichkeit, dies ist nicht mein wahres Leben, alles nur ein Trainingsprogramm, eine Übung für später, es ist gleichgültig, was du jetzt tust, ob du wartest vor dieser Ampel oder in einer anderen Steinlandschaft, ob im Wald oder im Buch, in der Musik oder im Bett, in der eigenen Haut oder in einer fremden. Das Ampelrot sprach: Lass dir Zeit, lass dich nicht überfahren, lass dir Zeit. Felipe bildete sich ein, wenigstens das gelernt zu haben in den achteinhalb Jahren, Zeit haben, gelassen bleiben. Aber er opponierte zugleich gegen das erzwungen Gelernte. Er war kein Meditationskünstler. Es gab immer noch etwas in ihm, das vorwärtsdrängte, das sich nervös wehrte gegen den Stillstand. Das grüne Männchen erschien, das mit starrem Schritt aufforderte zu gehen. Ein eiliger Angestellter, der Angst hat, eine halbe Minute zu spät ins Büro zu kommen.
Vor dem ersten Geschäft, dessen Sicherheit der Firma Secura anvertraut war, blieb Leo acht stehen, ein Fotogeschäft. Die Eisengitter waren heruntergelassen, die Türen zweifach verschlossen. Keine Unregelmäßigkeiten. Er bediente die Kontrolluhr und meldete der Zentrale sein Okay. Er sah gern in die vollgeladenen Schaufenster mit Fotogeräten und entdeckte sofort die Leicas, die wunderbaren, die heiß ersehnten, die unerreichbaren Maschinchen, von denen er früher geträumt hatte. Die Leicas waren nicht allein. Fünfzig, sechzig Kameras blickten ihn durch die Gittermaschen an. Sie sahen kleinen, metallischen Zootieren ähnlich, mit übergroßen Augen. Sie lagerten träge und traurig im Scheinwerferlicht, aber Felipe ließ sich nicht täuschen, er kannte sich aus. Die Kameras lagen auf der Lauer, die schwarzen, hungrigen Reptilien spähten nach Futter. Sie suchten ein Objekt. Brennweiten, Belichtungszeit, Entfernung, alles war elektronisch gemessen, gespeichert, geregelt und bereit für den kleinen, gefährlichen Biss. Das einzige Objekt war Gerlach. Die Auslöser schnappten nach ihm, sechzig Blenden gingen auf und bissen los. Die Filme schluckten die Bilder und rückten automatisch weiter, bereit für die nächste Attacke. Das Phantombild von Felipe Ramón Gerlach Hernandez war rasch fertig. Es fehlte nur noch die Tat.
Der Fotografierte zog eine Fratze. Nicht getroffen. Er ging weiter, schlenderte die Friedrichstraße entlang, verwandelte sich wieder in Leo acht und steuerte den Adenauer an, den zentralen Platz der Stadt. Gegen Viertel nach neun sollte er zum ersten Mal dort auftauchen und seine Uniform zeigen. Abschrecken, beobachten, melden. In dieser Nacht war mehr zu tun als das übliche Programm. Das Herz schlug schneller, Krimibilder flimmerten vorüber. Nicht getroffen. Felipes winzige Aufregung missfiel Leo acht. Die Kameras im Nacken. Klick, Biss, getroffen. Nicht blinzeln, nicht grinsen, nicht wackeln. Die Kameras im Rücken, alle Auslöser bereit, sechzig Blenden gingen auf.
Am anderen Ende
Gestern oder heute oder wann, ein Postbote reißt Felipe aus dem Vormittagsschlaf und streckt ihm ein Telegramm hin. Felipe, als Langschläfer verdächtigt, mag den anzüglichen Blick des Boten nicht und murmelt etwas von Nachtschicht. Aber er ist schon verwirrt von der Klarheit seiner Ahnung. Wer überrascht einen Fremden schon mit Telegrammen, das kann nur der Tod sein. Seine Ahnung ist banal und trifft zu. Der Tod meldet, in einem spanischen Satz mit mehreren Rechtschreibfehlern, Mutter gestorben, Montag Beerdigung, Gruß Carlos. Auf dem Bett liegend, hingestreckt und die Hände auf der Brust, ist sein erster deutlicher Gedanke: Nun sind sie alle tot. Er meint alle, die einmal älter waren als er. Er vergisst für einen Moment, dass die meisten seiner Onkel und Tanten noch leben. Er spürt eine wirre Erleichterung. Von nun an, denkt er, bist du kein Sohn mehr.
Erst allmählich beginnt ihn die Nachricht aufzustören. Es ist Montag. Selbst wenn das Telegramm rechtzeitig gekommen wäre, um eine Flugreise bis in den äußersten Süden Amerikas zu buchen, fortzufliegen und vierundzwanzig Stunden auf schmalen Polstern abzusitzen – bis nach Osorno zur Beerdigung wäre er auf keinen Fall gelangt. Einreiseverbot. Wie ein Fallbeil hängt über allen Grenzstationen seines Landes das Einreiseverbot. Der Name Felipe Ramón Gerlach Hernandez steht auf der viele tausend Namen langen Liste der Ausgesperrten. Ausgesperrt, weil es den Mördern nicht gelungen ist, ihn zu ermorden. Ausgesperrt aus seinem Land, weil er vor vielen Jahren für sein Land gearbeitet hat. Weil er nicht aufgehört hat, die Mörder Mörder zu nennen. Es ist ihm verboten, zu Hause Freunde zu haben und Verwandte zu besuchen, einen einzigen Menschen zu umarmen. Verboten, die vertrauten Straßen entlangzuschlendern und Haustüren zu öffnen. Das Sitzen im Café oder das Anfassen eines Telefonhörers könnte mit dem Tod bestraft werden. Unerlaubtes Landen auf einem Flugplatz wird im günstigen Fall mit Abschiebung geahndet. Nicht einmal den Friedhöfen darf er sich nähern.
Carlos, der Bruder, weiß das genau. Felipe wird wütend auf ihn, den Älteren, den Schlaufuchs, den Anpasser. Der hat das Telegramm mit Absicht verspätet geschickt. Der rücksichtsvolle Schurke, wahrscheinlich bildet er sich ein, seinem kleinen Bruder zu helfen und ihm das Nachdenken über eine weite Trauerreise zu ersparen. Selber über die seltsamen Pflichten zur letzten Ehre, über die Risiken und Kosten einer solchen Reise zu entscheiden, nicht einmal das erlaubten sie ihm. Es ist wieder mal klar, die Verwandten brauchen ihn nicht. Sie bleiben rachsüchtig, immer noch. Das Einreiseverbot hilft, den Verräter fernzuhalten. Das Telegramm ist sachlich, kein Wort zu viel. Es hätte von Militärs abgefasst sein können.
Später, gegen Mittag, als er ans Frühstücken geht, stellen sich die ersten Bilder ein. Am anderen Ende der Welt wird sie beerdigt. Am anderen Ende der Welt, wie viel Protzerei liegt in diesem Satz! Auf dem anderen Kontinent ist noch Morgen, Zeit der Begräbnisse. Von ferne hört er ein süßliches Heulen. Die Szene malt sich von selbst aus, je mehr er sich dagegen sträubt. Die Gemeinde der Pietisten von Osorno betrauert die Schwester im Glauben, Elena Lisa Hernandez Ladewig, die Frommen bewegen sich schleppend im Takt ihrer wimmernden, schrillen Gesänge. Die Lieder, die Bilder wehen heran und liefern ihn einer gespenstischen Erinnerung aus, mit der er in diesen Augenblicken nichts zu tun haben will.
Er versucht, das Gesäusel und den langsam schreitenden Leichenzug mit Musik zu bekämpfen, doch er wagt nicht, sich auf eine Schallplatte festzulegen. Lieber Zufälliges aus dem Radio. Die klassischen Tempi tragen eine falsche, schwermütige Feierlichkeit ins Zimmer. Die Rockmusik dagegen mit dröhnenden Bässen rückt an mit stumpfem Gleichmut, walzt platt, schiebt weg. Nichts passt. Ein Knopfdruck, weg mit den schmerzenden Tönen!
Er greift zur Zeitung. Es herrscht Aufregung in Deutschland. Eine Regierung ist auseinandergebrochen, die Korrespondenten spekulieren über eine neue und beobachten jeden Schritt und jede Grimasse der Politiker. Das Publikum kann der Verteilung von Gunst und Macht zusehen, aufgeregt, aber stumm. Die neuesten Nachrichten haben für Felipe etwas Vertrautes. Irgendjemand zieht im Hintergrund die Fäden, die Puppen tanzen aufgeregt, kippen und stehen in neuer Konstellation wieder auf. Immerhin, es geht ohne Schüsse ab. Felipe meint Bescheid zu wissen und liest doch alles zu diesem Thema wie ein Völkerkundler, der seine Forschungsergebnisse über einen wunderlichen Stamm ergänzt und bestätigt findet. Dann räumt er das Geschirr weg, ohne die Tasse oder das Messer fallen zu lassen. Er staunt darüber, denn er hat die ganze Zeit ein kleines Unglück erhofft, wenigstens ein paar Scherben, vielleicht ein Schnitt in der Hand. Das Telegramm bleibt neben der Zeitung liegen, er hätte es gern unter den Schlagzeilen versteckt. Er liest es noch einmal, Buchstabe für Buchstabe.
Dann ruft er seine Freundin an, Anke im Stadtarchiv. Ihr Apparat ist besetzt, und er zufrieden. Eine Anstrengung weniger.
Doch er weiß nicht, wohin mit der Todesnachricht. Ein Hubschrauber knattert über die Dächer. Felipe hat den Wunsch, sich in Bewegung zu setzen. Aber schon wieder laufen, nein. Die ganze Nacht gelaufen, die nächste Nacht wieder laufen, nein. Er braucht einen ruhigen Nachmittag. Aber er kann nicht in der Wohnung hocken, als sei nichts geschehen. Er spürt noch kein Zucken der Trauer. Als Randfigur der Familie hat er nicht einmal den Vorteil, seine Verlegenheit mit Aktivitäten zu verbergen, wie es Angehörige sonst tun, die ihre neu geweckte Angst vor dem Tod mit den technischen Einzelheiten des Ablaufs des Begräbnisses in Schach halten, mit Behördengängen, Telefonaten, Anzeigen, Absprachen mit Pfarrern und Beerdigungsunternehmern, mit Umsicht für Gästelisten, Speisefolgen. Felipe ist kein Angehöriger. Er hat nicht einmal eine Reise zu planen, weder den Arbeitgeber zu verständigen noch Urlaub zu beantragen. Wären noch vier, fünf Tage Zeit, er hätte vielleicht das Konsulat aufsuchen und mutig nach einer Ausnahmegenehmigung fragen können, neuerdings wurde nicht jeder Antrag auf einen Kurzbesuch in Familienangelegenheiten abgelehnt. Auch für diesen Test war es zu spät.
Ein heller Mantel
Ein milder Septemberabend, aber die Bürgersteige waren so wenig belebt wie immer. Warum den Deutschen der Wunsch abgestorben war, sich abends auf Straßen und Plätzen promenierend zu treffen, hatte Gerlach nie verstanden. An der Kälte konnte es nicht liegen, denn auch in der warmen Jahreszeit mieden die Bewohner nach Geschäftsschluss ihre Kaufstraßen, als seien sie ein Herd der Gefahr. Die Stadt hatte wenig schöne Seiten, aber allein das konnte kein Grund sein. Schließlich hatten die Bewohner den Programmen der Verhässlichung zugestimmt. Es musste mit der allgemeinen Angst vor Begegnungen und Berührungen zu tun haben. Vielleicht waren die Leute viel zu erschöpft, sammelten sich müde in den Wohnzimmern und saßen den Abend ab. Sie wollten keine Anstrengungen mehr. Sie starrten die Ausrufer auf den Bildschirmen an und warteten nicht einmal auf Erklärungen. Vielfarbige Filmbilder bewiesen jeden Abend aufs Neue, wie gefährlich die Welt außerhalb der eigenen Wände war. Die Gefahr, immer sprungbereit, lauerte überall, vor der Haustür, auf der Straße, erst recht in der Stadt. Die Zuschauer waren gefasst auf Vergeltung, sie fühlten sich schuldig, sie blieben lieber in ihrem Bau. Die wenigen Menschen, die noch die Kraft aufbrachten, an einem Abend in der Woche ein Vereinslokal, ein Restaurant oder ein Filmtheater der Innenstadt aufzusuchen, den Opernsängerinnen oder den Lautsprechern der Diskotheken zuzuhören, die parkten ihre Autos möglichst nah am angesteuerten Ziel. So blieben nur einzelne oder paarweise verstreute Passanten, die auf der Suche nach Abwechslung und Gesellschaft abends zu Fuß die City durchstreiften. Die wenigen galten, weil sie wenige waren, als Risikopersonen. Als gefährdet oder gefährlich. Als potenzielle Opfer oder Täter. Für sie war die Polizei da und die Wachleute in den Funkwagen. Und weil das nicht genug schien, hatten einige Männer wie Felipe Gerlach zusätzlich Ordnungshüter zu spielen, Streifengänger in verschiedenen Bezirken der Stadt.
Wie aus dem Hinterhalt drängten plötzlich Leute schubsend vorbei. Felipe hasste es, angerempelt zu werden. Er sah einen Angriff darin. Er mochte die Eiligen nicht, die Gehetzten, die Galoppmenschen, die Blitzmädels, die Terminboys, die Windhunde, die nichts verpassen wollten.
Herausgefordert, hielt er sich zurück und ging hinter den Remplern her, zwei junge Frauen und zwei Männer, auch sie schienen den Adenauerplatz anzusteuern. Er folgte ihnen und blickte nach vorn, vier Rücken, die ganze Breite des Bürgersteigs. Die Falten auf dem hellen Mantel der außen gehenden Frau. Die schwarzen Haare über dem strengen, eiligen Körper. Der Rücken der Mutter. Sie dreht sich nicht um, sie läuft weg, sie dreht sich zu spät um. Felipe, vier oder fünf, ein vergessenes Kind, soll einige Tage bei den Großeltern Gerlach bleiben. Die Mutter hat das Kind abgeliefert und will sich verabschieden. Das Kind will keinen Abschied, es spielt oben im Haus mit einer Cousine, die einige Jahre älter ist, ein geheimnisvoll großes Mädchen. Die Mutter steht unten im Hausflur und ruft das Kind herunter, ungeduldig, herrisch. Sie will den Schwiegereltern zeigen, dass ihr Kind gehorchen kann. Das Kind spielt, es ist mit dem großen Mädchen verbündet. Die Mutter will los, sie muss den Bus erreichen. Das Kind weigert sich, das Spiel aufzugeben und die Treppe hinunterzusteigen. Es sagt: Komm du doch rauf! Kampf im Treppenhaus, immer heftigere Befehle, Schreie kreuzen sich, immer schärferes Nein. Die Mutter droht, sofort zu gehen, ihre Drohung bestärkt das Kind. Dann die schrille, gebrochene Stimme von unten: Ich geh jetzt! Die Haustür knallt. Das Kind spielt eine Weile mit der Cousine. Dann reißt auf einmal eine entsetzliche Angst in ihm auf, die Angst, die Mutter verloren zu haben, die Schuld, sie verstoßen zu haben, jetzt, für immer. Der Junge hastet die Treppe hinunter und rennt hinaus und hinter ihr her, eine endlose Allee entlang zur Straße hin, wo er sie weit vor sich laufend sieht, den Rücken unterm hellen Mantel, den immer näheren Rücken, der sich nicht umdreht, den strengen, eiligen Körper, den triumphierend abgewandten Kopf, bis endlich sie den brüllenden Jungen erhört und stehen bleibt und auf ihn zukommt. Aber es ist zu spät, die Trennung war schon vollzogen.
Er lief den vorgeschriebenen Weg. Bevor eine alte Traurigkeit sich ausbreiten konnte, steuerte er auf das Schuhgeschäft zu, das er zu inspizieren hatte. Er prüfte die Türen und Gitter. Auch die Schuhe waren für Eilige gemacht, die schnellen Sohlen, die Turnschuhstreifen, die neuen Stromlinienformen, alles trieb zur Schnelligkeit an. Der Hilfswachmann tat seine Arbeit und gab sich gelassen.
– Leo acht an Zentrale.
– Zentrale an Leo acht?
– Objekt Drei Drei Fünf, alles okay.
– Objekt Drei Drei Fünf?
– Ja.
– Da war doch vorgestern das Schachtgitter locker. Siehst du mal nach?
– Moment. Ja, alles fest verankert.
– Okay, Leo acht.
Er merkte wieder, wie nützlich ihm die Uniform war, die er seit drei Monaten trug. Man streifte eine dicke Jacke über, und schon war man weniger verletzlich, weniger nervös. Die Uniform bewahrte vor Selbstmitleid, vor weinerlichen Gefühlen. Da er so bekleidet war, als erwarte er nur Feinde auf der Welt oder als habe er mehr als sich selbst zu verteidigen, vermochte er leichter Distanz zu gewinnen zu allem. Die Uniform passte ihm nicht, sie gefiel ihm nicht, sie stand ihm nicht, aber sie ermöglichte ihm zu leben in diesem exotischen Deutschland, ein Land, das gut zu ertragen war, wenn man sich verkleiden konnte.
Serenade
Die Rekruten standen aufrecht, sie waren nicht verletzt. Gesund, tauglich, wehrbereit, die Augen geradeaus. Sie hatten die ersten Geländeübungen hinter sich, ihr Kreislauf hatte schon einen Marsch mit Sturmgepäck ausgehalten. Sie hatten allen Schlamm abgeduscht, sie hatten Gehorsam bewiesen, sie ließen sich vorzeigen. Sie hatten Handschuhe an, sie waren feine Herren jetzt. Die feinen Herren schossen nicht, sie standen still, sie standen stramm, Paradeaufstellung im Flutlicht. Die Stiefel drückten den Stadionrasen platt. Sie rissen keine Löcher wie die Fußballstollen oder die Speere der Leichtathleten. Die feinen Herren schonten das Gelände, sie hatten keine bösen Absichten. Eine Feierstunde war zu überstehen, ein Eid nachzusprechen. Das Heeresmusikcorps spielte eine Serenade, die Blechbläser waren gut besetzt. Die Zuschauer klatschten Beifall, und die Soldaten rührten sich nicht. Ein Offizier in leuchtendem Grau trat vor, stolzierte aber nicht wie ein Ordensgockel, sondern suchte mit Schlichtheit zu überzeugen, noch ehe er ins Mikrophon sprach.
Anke Hennig sah der Schau abschätzig zu. Sie suchte das Gesicht ihres Bruders, den man zum Rekruten gemacht hatte. Unter den Baskenmützen waren die Köpfe alle ähnlich, nur durch die Schnurrbärte und die Farbe der Haare unterschieden. Sie konnte den Bruder nicht finden unter den Vorderleuten. So viele Soldaten hatte sie noch nie auf einem Haufen gesehen, und wie waren sie starr, steif, käsig! Durch das Stadion bellte die Lautsprecherstimme des Kompaniechefs. Anke war freiwillig gekommen. Sie war nicht scheu, sie wollte das Spektakel einmal aus der Nähe betrachten, die letzte Reihe der Tribüne war ihr nahe genug.
Was stellte man mit diesen Jungens an, die das Strammstehen so bescheuert fanden wie ihr Bruder? Auch Wolf Hennig wollte kein Soldat werden. Er war Jugendvertreter in seinem Betrieb, Metaller, er kannte genug Argumente gegen Rüstung und Soldaten, aber er weigerte sich, den Wehrdienst zu verweigern. Zuerst hatte er gesagt, die Demokratie müsse verteidigt werden trotz allem. Ja, aber ausgerechnet in der Kaserne? Daraufhin hatte er behauptet, er wolle nicht kneifen, er sei kein Feigling, er gehe mit seinen Kollegen. Okay, der Arbeiter tut, was man von ihm erwartet, und zwar solidarisch. Du hast gut reden, Schwester. Schließlich hatte sie herausgefunden, dass Wolf auf keinen Fall den toten Opas die Scheiße wegwischen wollte, wie er sagte, die Spastis füttern oder Kindermädchen spielen. Die Angst vor den Kranken und Alten, die war es, die Angst der Achtzehnjährigen vor dem Tod war das stärkste Motiv, Soldat zu werden trotz allem. So kamen die Kompanien zusammen. Aber es fehlte etwas. Der Kompaniechef musste sich anstrengen, er hob die Stimme. Eben nicht Kadavergehorsam ist gefragt, sondern Treue, die letzten Endes Treue zu sich selbst bedeutet. Was für Worte! Kadavergehorsam, was dachten sich diese Männer dabei, wenn sie solche Wörter ins Mikrophon brüllten, dachten sie an Kadaver? Und Treue? Als ginge es hier um einen Ehevertrag. Mit welchem Staat sollten diese Burschen schon fremdgehen? Sich dem Staat verpflichten irgendwie, das ließ sich noch einsehen. Aber Treue zu sich selbst, letzten Endes? Der Kompaniechef, zwischen Ziersträuchern in Kübeln, hatte gut reden. Er bestimmte, was Treue sein sollte im Ernstfall, und wenn die Vorgesetzten des Vorgesetzten entschieden, dann wurde nicht mehr von Treue geschwafelt.
Sie wusste, auch ihr Bruder konnte bei solchen Sätzen nur wütend werden. Unruhig war er bestimmt schon. Er war Fußballer, Stürmer, er brauchte Bewegung, er hasste das Strammstehen. Eine Tortur, jemanden wie ihn ausgerechnet auf einem Fußballplatz stillstehen zu lassen, länger als eine Stunde, zwei Halbzeiten lang. Ein milder Septemberabend, die schönsten Stunden für Trainingsspiele unterm Flutlicht. Felipe hatte es besser, er konnte sich wenigstens bewegen wie ein normaler Spaziergänger. Wolf trug Handschuhe, Anke konnte sich leicht vorstellen, wie die Handschuhe kniffen am kleinen Finger, die Soldaten durften sich nicht rühren, die Handschuhe nicht zurechtzupfen, alle Hände an der Hosennaht. Arme Idioten, dachte Anke, unglaublich, was sich ausgewachsene Männer gefallen lassen! Sie fühlte sich stärker als alle diese ausstaffierten Kerle zusammen. Die feinen Herren, im schneidenden Flutlicht standen sie da wie in die Kälte geschoben, schon erstarrt und zum Einfrieren bereit. Ein unerwartetes Mitleid regte sich in ihr, oder war es der Wunsch, die Männer aus ihrem Bann zu erlösen? Sie sah sich die Tribüne hinabsteigen, durch die Zuschauer drängen, an den wachsamen Feldjägern vorbeiziehen, langsam über den Rasen auf die Soldaten zugehen und ihnen den blöden, geradeaus gerichteten Kopf verdrehen, durch die Reihen schlendern und den Jungen das Zauberwort zuflüstern, das sie von aller Totenstarre befreite, und ihren kleinen Bruder begrüßen, ihm die schwarze Baskenmütze abnehmen und eine gescheite Jacke überwerfen, mit ihm ein Bier trinken gehen und noch einmal über alles reden.
Auf der Tribünenseite saß Anke zwischen den stummen Eltern der jungen Rekruten, es waren junge Eltern. Man hatte sie persönlich eingeladen, und nun sahen sie stolz und verängstigt auf ihre Söhne in der grauen Uniform hinunter. Sie hatten Soldaten gezeugt. Fesch und sauber stand er da, der Junge, und schon entrückt, nicht mehr zu erkennen zwischen seinen Kameraden, ein Mann schon mit Stiefel und Koppel und fertig wofür. Im Zentrum der Tribüne saßen Offiziere, pensionierte Kasernenkameraden und die beflissenen Vertreter der lokalen Politik, sie hatten Beifall geklatscht beim Aufmarsch, Beifall nach der Serenade, Beifall bei Treue und Frieden und Freiheit. Die Stehplätze im weiten Rund waren mit Soldaten gefüllt, die als Zuschauer abkommandiert waren. Auch wehrhaft begeisterte Bürger waren zugegen, die an diesem Abend etwas erleben wollten, ein erhebendes Schauspiel, eine Demonstration gegen die Friedensschwätzer, ein Wonnegefühl gemeinsamer Stärke. Vor der Tribüne und im Stadionrund waren Feldjäger auf dem Posten, Gesicht zum Publikum.
Das Stadion war zum militärischen Sicherheitsbezirk erklärt worden, da brauchten die Polizisten des Heeres mit den erwarteten Wehrdienstgegnern nicht lange zu fackeln. An den Eingängen neben mannshohen Stacheldrahtrollen konnte jeder Besucher lesen: Vorsicht Schusswaffengebrauch! Trotz aller Absperrungen und Kontrollen waren Störer ins Stadion eingedrungen, leicht zu erkennen an disziplinlosem Gehabe und struppigen Kleidern zwischen den ordentlichen Zuschauern. Der Kompaniechef holte tief Luft, als stehe der Höhepunkt seiner Rede bevor. Diese Soldaten demonstrieren unsere Bereitschaft zum Frieden. Unruhe platzte auf nach diesem Satz, in der Kurve rechts sah Anke die Feldjäger einzelne, zappelnde Gestalten greifen und abführen.
Die Rekruten zappelten nicht, sie griffen nicht zu, sie standen fest. Nein, sie kippten nicht um. Der Gehorsam und die teuren Uniformen hielten ihre Leiber zusammen. Bis zur Unterhose waren sie einheitlich solide gekleidet. Weg mit den Uniformen, weg mit den Unterhosen. Anke fiel es nicht schwer, sich die jungen Männer nackt vorzustellen, schreckensbleiche Körper auf dem grünen Rasen aufgereiht stehend, das Glied schlaff, das Glied gekrümmt, das Glied aufrecht und wieder schlaff. Eine Kompanie von Wichsern, das Bild passte genau in die zackige Zeremonie. Sie überlegte, ob diese Männer sich weniger leicht zu Befehlsempfängern degradieren ließen, wenn sie zur Liebe imstande wären, nicht nur zum Ficken, zur Liebe.
Ach, gib nicht so an, nur weil du vorhin erst bei einem Mann gelegen hast! Es waren nicht einmal zwei Stunden vergangen. Felipe. Den einsamen Felipe in den Armen, der sie angerufen, auf sanfte Weise zu Hilfe gerufen hat. Es soll nichts zerbrechen, nichts falsch gemacht werden. Es ist die einzige unaufdringliche Geste, die ihr einfällt, eine tastende Antwort auf den entfernten Tod seiner entfernten Mutter. Nach einer stummen, trockenen Stunde, in der keine Lust aufkommt zwischen ihnen und keine Nähe selbstverständlich wirkt, sagt er früher als sonst, er müsse sich allmählich fertig machen für die Arbeit. Mit einem traurigen, lauschenden Blick spricht er, und mit diesem Abschiedsblick weckt er ihr Begehren. Sie möchte ihn nur anrühren, aber dann geht alles sehr schnell. Sie spürt, der will alle seine rotierenden Gedanken wegvögeln, eine subtile, köstliche Rache nehmen mit ihr an dem Telegramm und was an diesem Telegramm hing, die Lieblosigkeit und Starrheit der Toten, der Schmerz über seine anhaltende Verbannung, der Ärger über seinen traurigen Job. Felipe hält sich nicht zurück, sie zeigt sich nachgiebig, er entlädt alles auf sie, sie versteht ihn, aber sie will nicht missbraucht sein, auch nicht von ihm. Es war ihr zu viel, es war ihr zu wenig, es war ihr nicht genug. Sie spürte es wieder, das wohlige Prickeln zwischen den Schenkeln. Sie fühlte sich, trotz Felipes Heftigkeit vorhin, stark und glücklich jetzt, zwischen lauter Männern sitzend, die mit ihrer Männlichkeit protzten. Sie trug Felipes Geruch mit sich, und inmitten dieser obszönen Szenerie kam es ihr vor, als berge sie als Einzige das Geheimnis der Zärtlichkeit, und der Gedanke an den verborgenen Geruch spitzte ihr abgeklungenes Begehren wieder an. Sie war am falschen Ort. Hier waren Härte und Imponiergehabe gefragt und sonst nichts. Sie hätte keinen dieser zur Parade aufgestellten Männer genommen, auch den schönsten nicht, sie wusste, sie wird bei einem Soldaten nie die Zeilen aus dem Lied vergessen, Soldaten sehn sich alle gleich, lebendig und als Leich. Nein, sie wollte auf Felipe warten, auf ihren armen Felipe, der durch die Stadt laufen musste die ganze Nacht, auf Felipe bis morgen früh.
Sie hatte genug gesehen. Sie stand auf, um das Stadion zu verlassen, als die Rekruten im Chor der Bassstimmen den auswendig gelernten Text nachbeteten, dumpf und trostlos wie ein Vaterunser, und brummend gelobten, der Bundesrepublik treu zu dienen, als einige junge Leute über die Barriere flankten, über die Aschenbahn und quer über den Rasen stürmten und um die Soldaten herumkurvten, die mit Grabesstimme murmelten: so wahr mir Gott helfe. Der erste Läufer wurde schon auf der Aschenbahn hakenschlagend von den Feldjägern ergriffen, zwei drangen bis zur Fahnenabordnung vor und hätten fast die Bundesfahne zu Boden gezerrt, wenn die Polizeisoldaten karategeschult nicht im letzten Moment zugepackt hätten, ein Vierter erreichte das Mikrophon und brüllte: Nie wieder Krieg! und ließ sich dann, nach einer lässigen Drehung, festnehmen.
Alle Störer eingefangen, Arme auf den Rücken gedreht, im Polizeigriff harmlos und schwach. Die Zuschauer atmeten auf, der Skandal war beendet. Die vier wurden gefangen an der Tribüne vorbeigeführt, Beifall.
– Aufhängen!, hörte Anke einen Mann rufen.
– Vergasen!, schrie jemand.
Ein älterer Herr, der nah am Durchgang stand, ließ es sich nicht nehmen, einen Langhaarigen, der beinah die Fahne verletzt hätte, ins Gesicht zu treten und dem nächsten, der ihm von den Feldjägern beinah auffordernd hingehalten wurde, einen Fausthieb zu verpassen.
Anke witterte die Gefahr und setzte sich wieder. Die Feier ging weiter. Es sprach ein Zivilist, ein Minister.
Der Adenauer
– Bin jetzt am Adenauer, meldete Leo acht der Zentrale und prüfte sein Revier.
Mittelhohe Hochhäuser, in der Nachkriegszeit eilig hinzementiert, standen neben Neubauten der siebziger Jahre, die mit metallischen Fassaden und abweisendem Glas prunkten. Auf den teuersten Verkaufsflächen zwischen Banken und Kaufhäusern spreizten sich die Läden der Optiker, Jeans-Großverkäufer, der Apotheker und Fernsehhändler. Pelzhaus, Modepalast, Einkaufsparadies, das war der Dreiklang der Glücksversprechen. Die großen Geschäftsbauten waren bis unters Dach belegt mit den Büros der Krankenkassen, Werbeagenturen und Handelskammern, mit Praxisräumen und Verwaltungsnebenstellen. Über allem prangten die Leuchtschriften der Versicherungsgesellschaften, die, nur durch einen typischen Schriftzug und eine bestimmte Farbe unterschieden, an allen Gebäuden die gleiche Sicherheit versprachen. Auch die Banken hatten für ihre Leuchtbuchstaben und Signets besondere Farben gepachtet und halfen mit, den Platz mit seiner grellen, vom Geldwahn inspirierten Architektur in die Schale bunten Neonlichts zu rücken. Der Adenauer, wie die Einheimischen sagten, bot kein Denkmal zum Anschauen und keine Bank zum Sitzen. Die Bäume waren längst aus der Erde gerissen, das Gesträuch in der Mitte des Verkehrsknotenpunkts weggehackt. Hier pflegten die städtischen Gärtner die Steine und die Blumenkübel am Anfang der Fußgängerstraßen. Der Platz war scheußlich, sonst nichts. Als einziges nicht käufliches und nicht zum Kauf aufforderndes Ding leuchtete die Normaluhr über einem der U-Bahn-Eingänge. Inmitten der zusammengedrängten Asphaltstraßen und der geschminkten Gebäude wirkten das schlichte Zifferblatt und der unbestechliche Takt der Zeiger beinah wie ein Stück Natur.
Aus mehreren Richtungen schossen die Autos heran, hielten in Doppelreihen lärmend vor den Ampeln und stürzten weiter um die Ecken zum nächsten Rotlicht. Hier trafen die U-Bahnen die Straßenbahnen und die Busse die Busse. Ein Platz zum Umsteigen, zum Weitergehen, zum Verschwinden in der Fußgängerunterführung, aber kein Platz zum Bleiben. Ein Bierausschank, eine Spielhalle, zwei Schnellgaststätten waren die einzigen Oasen am Adenauerplatz.
Leo acht nahm keine Einladung an, er lief durch das Herz seines Reviers, mit gleichgültigem Blick an den leuchtenden, sparsam gefüllten Schaufenstern vorbei. Glaswände überall, nicht nur die hochversicherten Schaufensterscheiben, auch Banken und Kaufhäuser mit ihren türlosen Glastüren gaben den Anschein, als könnten sie mit zwei, drei Schritten betreten werden, als gebe es keine Hemmschwellen mehr. Durch das Glas schienen die Geschäftshäuser wie ausgehöhlt, die schmalen Betonsäulen und die Stahlträger angefressen von Flitter und Glanz und Leuchten, obwohl die Fassaden nicht baufällig wirkten. Nur das Glas, Felipe wurde die Frage nicht los, ob das Glas genügend haltbar war, dem mächtigen Druck der Warenberge hinter dem Dekorationsmaterial standzuhalten, es lag doch so viel vervielfacht gestapelt in diesen Speichern, dass es fraglich war, ob die dünne Glaswand hielt und wie lange, wie lange, bis das Glas knackt und bricht und Anzüge, Schuhe, Pelzmäntel, Jeans und Akten und Prospekte und alles ballenweise und durcheinander herausquillt und den Bürgersteig, die Fahrbahnen und den ganzen Platz überschwemmt.
Der Platz war leer, und darin lag die Gefahr. Leo acht hatte auf die Leute zu achten und auf eine Handvoll Geschäfte. Nicht auf die Statik, die Stadtplanung, das Warenangebot. Abschrecken, beobachten, melden. Die Passanten. Die Passanten waren keine harmlosen Konsumenten mehr. Die hatten sich um die Kassen geschart und dann, nach Geschäftsschluss, fluchtartig ihre steinernen Marktplätze verlassen. Wenn die Angestellten der Banken und Kaufhäuser, der Boutiquen und geleckten Geschäfte die Tagesabrechnung geprüft und die Türen verriegelt hatten, wurde das städtische Umsatzzentrum mit zunehmender Dunkelheit zum Schauplatz einer beschränkten Kriminalität. Die leeren Fußgängerstraßen, die U-Bahn-Eingänge, Unterführungen und Passagen, die Nischen und Gassen rund um den Platz luden zum Angriff ein. Direkt unter den Leuchtschriften der Versicherungen war die Gefahr am größten. Die Angriffe richteten sich auf Passanten und ihre Brieftaschen oder direkt auf die Waren in den Schaufenstern. Junge Leute probierten ihr Glück bei einem Überfall, und sie hatten am Adenauer größere Gewinnchancen als beim Lottospiel. Der zentrale Platz bot mit den sechs Straßen, die hier zusammenstießen, eine gute Auswahl an Fluchtwegen.
Der Adenauerplatz kam beinah täglich in die Zeitung. Scheiben am Adenauerplatz zertrümmert. Adenauerplatz – vier schlugen zu: Opfer verstorben. Die Stadtverwaltung antwortete: Kriminalstatistisch liegen wir im Durchschnitt, kein Grund zur Sorge. Die Kaufleute der City forderten, den Anfängen zu wehren. Denken Sie an New York! Die Polizei versprach erhöhte Wachsamkeit. Den Lokalredakteuren ging der Stoff nicht aus. Die Kaufleute der City wollten Taten sehen. Sie zahlten die höchsten Mieten. Ein schlechter Ruf des Standorts Adenauerplatz stieß Kunden ab. Das Image färbte die Bilanz. Die Lokalredakteure blieben am Ball. Junge Männer prügelten unbekanntes Ehepaar. Einundzwanzigjährige im Adenauertunnel vergewaltigt. Zur guten Bilanz hatte die Polizei beizutragen. Der Polizeipräsident sprach von fehlenden Planstellen, Überlastung, Überhang an Überstunden. Für personalintensive Streifengänge könne man keine Beamten zusätzlich freistellen, vor allem nicht zur Nachtschichtzeit. Die Lokalredakteure fragten: Machtlos gegen die Kriminellen vom Adenauerplatz? Die Kaufleute der City wiesen noch einmal auf ihre Steuerzahlungen hin. Sie drängten. Man dürfe die privaten Wachgesellschaften nicht vergessen, die ohnehin zum Schutz der Geschäfte im Citybereich tätig seien, unbürokratische Regelungen, dem konzessionierten Bewachungsgewerbe die Möglichkeit geben, die nötigen Abschreckungseffekte erzielen, nicht in den polizeilichen Kompetenzbereich eingreifen. Die Täter schlugen Scheiben ein, jede Nacht ein Zwischenfall. Die Lokalredakteure ließen nicht locker. Die Verfasser des Polizeiberichts waren um Sachlichkeit bemüht.
In den Büros der Stadtverwaltung, des Arbeitsamts, des Polizeipräsidiums und der Wachgesellschaften entschloss man sich zur Erprobung eines neuen Modells zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung. Devise: Flagge zeigen! Die Wachgesellschaften wurden mit Subventionen des Arbeitsamts dazu bewegt, mehrere geeignete Arbeitslose als Hilfswachmänner einzustellen. Ein Kompromiss für alle Beteiligten, ein Modellversuch, und plötzlich war Geld da.
«Nachtwächter für City-Bereich gesucht» – Felipe Gerlach hatte sich keine Chancen ausgerechnet, als er die Anzeige las. Ausländer durften zwar Essen kochen und Abfälle zu den Kehrmaschinen schaufeln, durften Leichen verbrennen und an Bleiöfen stehen. Aber eine Innenstadt hüten und Sicherheit und Ordnung, wie die Deutschen sie lieben, das war ein Privileg, das ließen sie sich nicht so schnell aus der Hand nehmen. Felipe war nicht wild auf diesen Job gewesen, ein Anruf, ein Vorstellungsgespräch, eine Proberunde mit dem Oberwachmann Vogelsang, und schon lief er als Nachtwächter herum und wurde dafür bezahlt, das Schlimmste zu verhüten.
Der Refrain eines Schlagers wehte aus der Bierhalle. Die weißen Tauben sind müde, krächzte der Sänger. Der Hilfswachmann wusste, er verhütete das Schlimmste nicht.
Das süßere Geld
Der Steuerberater zauberte Rinder herbei und bot sie zum Kauf an. Er lächelte, und die Tiere vermehrten sich im Nu. Er bot den Hauptgewinn, die freie Auswahl. Die großformatigen Farbfotos waren der Beweis, er verfügte über eine unendliche Zahl, tausend Rinder oder mehr, das hing allein von seiner Tüchtigkeit ab. Er wies auf die Fotos, der Kunde sah kein Trugbild, und die Begierde des Kunden wuchs. Zwei Herren saßen sich geschäftlich gegenüber, sie rechneten und sahen riesige Herden weiden, schwarz gefleckte, elfenbeinfarbene, erdrote Tiere, die ihre Köpfe hochwarfen und die glänzenden Hörner zeigten, alle schlanker als die lahme europäische Milchkuh, aber auch wilder und störrisch, die Tiere wie im Wilden Westen, der Film vom Cowboy im Land der unendlichen Weiden lief wieder an, mit dem Lasso schwingend reiten und reiten und die wilden Rinder fangen und hinter Zäune sperren und zähmen, als Besitzer und Herr geschickt und raubeinig glücklich sein für immer.
Diesen Traum verkaufte Kurt Ellerbrock, ein Meister der Abschreibungskunst, ein gefragter Anlageberater, der Wert darauf legte, als Steuerberater angesprochen zu werden. Er saß in seinem Büro in der Beckstraße mitten in Deutschland und trieb die Herden über das Weideland auf dem anderen Kontinent. Er konzentrierte sich auf das Verkaufsgespräch, er wollte endlich zum Abschluss kommen. Es war spät geworden, selbst für den verlängerten Montagabend, den er für die persönliche Beratung der guten Kunden reservierte, die tagsüber keine Termine frei hatten. Am Montagabend gaben die Kunden das Geld leichter her als am Wochenende. Ellerbrock streckte die Beine aus, als müsse er sich von einem langen Ritt erholen. Wenn der Montag mit den zehn, zwölf Bürostunden überstanden war, dann waren die Gehälter und Betriebsausgaben für eine Woche schon fast verdient, ab Dienstagnachmittag floss das süße Geld.
Dr. Dreisch saß vor ihm, Hautarzt und gutwilliger Kunde mit jährlich wiederkehrenden Abschreibungsbeschwerden. Dreisch war schon überzeugt von dem neuen Projekt, das sah Ellerbrock ihm an, er kannte seine Cowboys. Aber er durfte ihn nicht überfahren. Dreisch zögerte noch, die fünfzigtausend herzugeben. Er musste zeigen, was er für ein skeptischer Bursche ist, ein zäher Kerl, der auf keinen Hausierertrick hereinfällt. Ellerbrock ließ ihm diesen Glauben. Der IOS-Schock wirkte immer noch, da waren sie alle auf die Nase gefallen, und seitdem legte die Kundschaft Wert darauf, nicht als naiv und dumm zu erscheinen. Dreisch hatte sich von Ellerbrock schon ein Stück Land im Süden Amerikas vermitteln lassen. Der Name Dr. Dreisch war seit einem Jahr in einem Grundbuch verzeichnet, mit deutschen Namen unter spanischen Rubriken. Es war ein erhabenes Gefühl, ein kleiner Anteil am südamerikanischen Kuchen. Der Kuchen schmeckte, Dreisch wollte mehr. Er war es müde, in Berlin zu investieren. Die versprochenen Steuervorteile schlugen zwar immer noch günstig zu Buche, aber es wurde zu viel Wirbel um diese Abschreibungen gemacht. Vereinzelt wurden Namen von Anlegern ans Licht gezerrt, man wurde an den Pranger gestellt, das Wort Verlustzuweisung bekam einen negativen Beigeschmack. Man musste an stillere Beteiligungen, man musste weiter, man musste an die Zukunft denken, da kam ihm Südamerika gerade recht.
Die Zeiten waren vorbei, in denen nur Großindustrielle und Konzerne an die Urwälder und Farmgebiete des riesigen Halbkontinents herangingen. Nun drängelten die scheuen Goldgräber des Mittelstands. Ellerbrock organisierte ihren Einstieg, er war der Pionier. Er brauchte kein Buschmesser und keinen Kompass. Er hatte ein paar Treuhandgesellschaften gegründet und kannte die Herzen der standesbewussten Einkommensteuerzahler. Er wies den Weg nach Westen weit über den Atlantik in eine Nische der Freiheit und Stabilität. Seine Firmen drüben dirigierten die Vermessungstrupps und die Planierraupen und die gewaltigen Sägen. Seit kurzem hatte er etwas Neues, die Rindersparkasse, der Geheimtipp aller Abschreibungssportler in dieser Saison. Ellerbrock verkaufte Rinder auf riesigen Farmgebieten, die er verpachtete oder ebenfalls zum Kauf bot. Weil Rinder geringwertige Wirtschaftsgüter sind, konnten die gesamten Investitionen als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben gelten. Auch alle anderen Kosten sollten für die Landwirtschaft typische Betriebsausgaben sein, das war Ellerbrocks Entdeckung. Und er war stolz auf seinen bauernschlauen Einfall, die biederen Begriffe Rind und Sparkasse kombiniert zu haben.
In fünf Minuten unterschreibt er, Ellerbrock wusste Bescheid. Er hat schon Land gekauft, es wurden schon Bäume für ihn gefällt und Sägewerke in Betrieb gehalten, er will nun auch das Viehzeug haben. Dr. Dreisch war nicht der Mann, der dem Reiz eines solchen Angebots widerstand. Es wurden ihm mehr als drei Wünsche auf einmal erfüllt, wenn er die Unterschrift gab. An erster Stelle stand der Wunsch, dem Staat, der ihm die großzügigste Geldschöpfung erlaubte, möglichst keine Abgaben zu überweisen. Der Wunsch nach einem Stück Land fernab stand gleich daneben, ein paar sichere Quadratmeter in Krisenzeiten, vielleicht die Rettung eines Tages. Und nun wuchs der Wunsch, ein paar hundert Rinder in weiter, prächtig grüner Landschaft unter Palmen sein Eigen zu wissen, ein paar hundert Rinder Gras fressen zu lassen für ihn, die Steuergelder wiederkäuen zu lassen für ihn und Milch und Steaks zu liefern für seine Konten. Der Wunsch gefiel ihm, er war natürlicher, er war schöner als die schönsten Quadratmeterpreise in Berlin und romantischer als die spekulativen Abschreibungsprojekte in der Film- und Ölbranche. Die Vorstellung, eine Viehherde zu besitzen, beruhigte und trieb ihn an. Er hatte keine Lust, Bauer zu spielen oder Viehzüchter, noch dazu in einem so fernen Land, weit von allen Konzertsälen. Bei diesem Vieh lief alles wie von selbst. Steuervorteil 300 Prozent auf ein Eigenkapital von 25000 Mark, die Herde völlig aus Steuern finanzierbar, dazu bekam er im dritten Jahr 12500 Mark aus den Gewinnen der Viehzucht und der Abforstung als bare Mittel hinzu, die Hälfte des Eigenkapitals immerhin, wenn Ellerbrocks Finanzplan stimmte. Dreisch vertraute seinem Steuerberater, man kannte sich einige Jahre, nicht nur geschäftlich, man zahlte auch Beiträge für die gleiche Partei. Der Arzt hatte sich längst entschieden, und es fiel ihm nur noch eine Frage ein.
– Das mit der Nachbesteuerung müssen Sie mir noch einmal erklären, wie Sie das schaffen wollen, die Gefahr der Nachbesteuerung von mir und den Meinen abzuwenden.
– Das macht alles die Landwirtschaft, Herr Doktor, sagte Ellerbrock und bot einen zweiten Cognac an. Dreisch lächelte, lehnte ab und hörte aufmerksam hin.
– Hohe Steuervorteile, das wissen Sie ja, haben oft den Nachteil der Nachversteuerung. Aber beim Projekt Rindersparkasse ist das definitiv ausgeschlossen, und zwar wegen der landwirtschaftlichen Sonderbestimmungen des Einkommensteuergesetzes. Nicht einmal bei Betriebsaufgabe brauchen Sie hier nachzusteuern. Das ist ja das Einmalige an diesem Angebot. Eine echte Lücke im Steuerrecht, und diese Lücke ist sozusagen der Grundstein für unser ganzes steuerrechtliches Konzept, maßgeschneidert.
Dreisch spürte Durst, er hätte den Cognac nicht ablehnen sollen, den er nur aus Trotz verweigert hatte, nüchtern wollte er überzeugt werden. Ellerbrock blickte Dreisch ins Gesicht, und als der Arzt nicht reagierte, nahm er sich vor, die Sache mit dem Herdenbuch noch einmal aufzutischen, das Herdenbuch beeindruckt jeden Kunden.