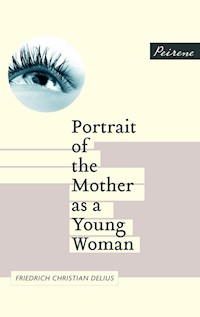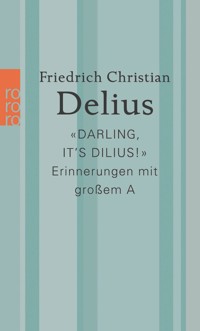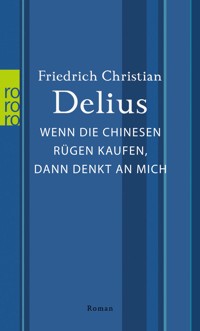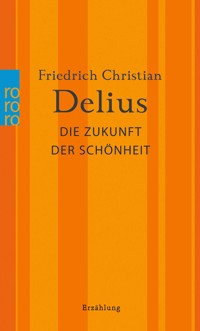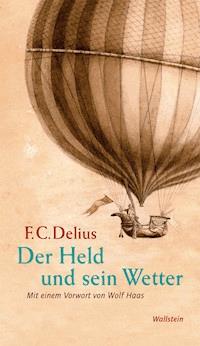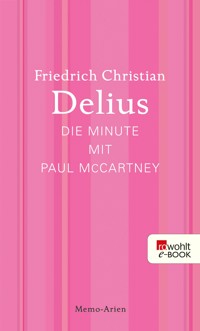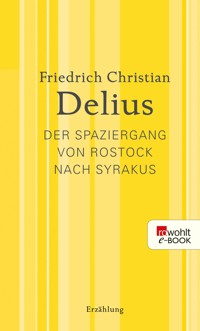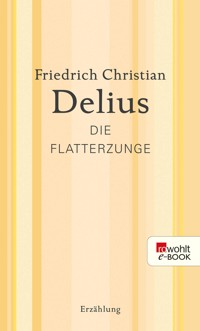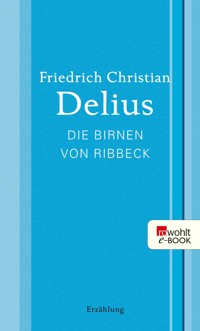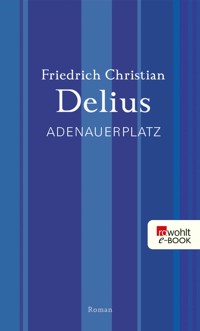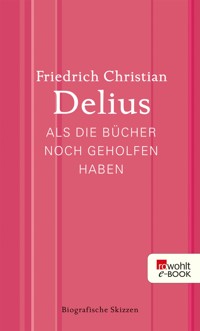
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Delius: Werkausgabe in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
Welches war der verrückteste Moment in der Literaturgeschichte seit 1945? Warum verliebte sich ein junger deutscher Autor in Susan Sontag? Wie veränderten die Schüsse der sechziger Jahre die Sprache? Wie spielte Rudi Dutschke Fußball? Warum klagte ein Konzern wie Siemens gegen eine Satire? Wie wurde Literatur durch die Berliner Mauer geschmuggelt? Seit fast fünf Jahrzehnten ist Friedrich Christian Delius Akteur und Beobachter des deutschen Geisteslebens. Schon mit einundzwanzig las er vor der Gruppe 47, wurde wenige Jahre später Lektor bei Wagenbach, dann bei Rotbuch. Er erlebte Sternstunden und Tiefpunkte der Linken sowie ihre Zerrissenheit angesichts des beginnenden RAF-Terrors. Mit seinen Romanen wurde er zum poetischen Chronisten deutscher Zustände – wobei er die Kunst stets gegen die Politik verteidigte. In seinem Erinnerungsband liefert Delius bestechende Deutungen der tiefen politischen Spaltungen von den Sechzigern bis zur Wendezeit, zeichnet Porträts von Weggefährten und Autoren wie Wolf Biermann, Heiner Müller oder Günter Kunert, Nicolas Born, Thomas Brasch oder Herta Müller und spricht über das Glück der Literatur. Ein ebenso persönliches wie eindrucksvolles Zeugnis einer Epoche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Friedrich Christian Delius
Als die Bücher noch geholfen haben
Biografische Skizzen
Vorsätze
Wenige Tage nach dem Ende der Schlacht von Stalingrad nicht weit vom Vatikan in das warme Frühlingslicht von Rom geboren, die Mutter eine milde Mecklenburgerin, der Vater ein westfälischer Pfarrer, zwischen hessischen Wäldern und Fachwerkhäusern, Bücherregalen und Fußballplatz Lesen und Schreiben gelernt und zugleich stotternd und stumm geworden – wo fängt es an, das Ich, das mit gelähmter Zunge zur Sprache drängt und im Alter von zehn Jahren mit der Schreibmaschine des gefürchteten Vaters sich einen «Weltplan» tippt? Und als «Beruf» angibt: Dichter.
Dies Rätsel habe ich auch in der Erzählung «Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde» nicht gelöst, und ich will es nicht lösen, denn es treibt mich voran. Wer schweigt und stottert, mag, im Idealfall, ein besonders glühender Liebhaber der Sprache sein. Die Vorstöße vom Schweigen zum Schreiben, vom Fußballfan am Radio zum Bastler epigonaler Gedichte, die Expeditionen von weitschweifenden Leseabenteuern zu abgehackten Zeilen, ich habe sie rational nie begriffen. Ich entdeckte ganz neue, selbst induzierte Glücksgefühle, ich spürte die Wohltat, mich am Schopf der eigenen Texte aus dem Sumpf der Sprachlosigkeit ziehen zu können, mit jedem neuen und möglicherweise besseren Gedicht festeren Boden unter den Füßen zu gewinnen und so das «entmündigte Ich wieder aufzurichten». (Kertész). Es wuchs die Lust am Widerspruch – erst gegen die Sprache der Väter, Großväter und Götter, dann gegen die Sprachen der Floskeln, der Macht, der Wirtschaft, der Ideologie. Wenigstens auf den Spiel- und Kampfplätzen der schriftlichen Sprache durfte ich mich stark fühlen, viel stärker als ich war, was wiederum die jugendliche Arroganz beförderte. Schreiben hieß Opposition und Selbstentdeckung, und ein dauernder Kampf gegen den Dilettanten, Nichtskönner und Hochstapler, als den ich mich sah.
Es zog mich ins Zentrum der deutschen Reibungen und Widersprüche, anderthalb Jahre nach dem Mauerbau. Aber was wäre Berlin gewesen ohne den Weg durch die Mauer, ich brauchte Gesprächspartner in beiden Berlins. Die politischen Schübe von 1965, 1966, 1967, 1968 haben mich nicht gehindert, zehnmal mehr Jean Paul und Fontane zu lesen als Marx. Theorie war meine Sache nie, Aktionismus noch weniger, und die Höhepunkte meiner Studentenbewegung waren ein gelungener Steilpass auf Wolfgang Neuss, eine Dissertation über «Der Held und sein Wetter» und das Werfen eines Steines in London. Die Maxime von Friedrich Schlegel begleitet mich seit 1965: «Jeder Satz, jedes Buch, so sich nicht selbst widerspricht, ist unvollständig.» Ein heimlicher Romantiker, wer möchte das nicht sein? Oder doch ein aufklärerischer Ästhet, der sich an Walter Benjamins Anspruch orientiert «Ein Autor, der die Schriftsteller nichts lehrt, lehrt niemanden»?
Nichts kann so falsch sein wie die Erinnerung. Jahrzehnte später sieht alles so einfach aus und glatt: der kleine Schritt von der Schulbank unter das literarische Zirkuszelt, die Kurzstrecken vom ersten zum zweiten, dritten oder fünften Buch, die Übungen im politischen Speerwerfen, die Weitsprünge mit drei Gedichtzeilen in die Gerichtssäle und wieder zurück, die Stabhochsprünge über Berliner Mauern, die Hindernisrennen zum Entdeckerglück, der Zehnkampf der Verlegerei. Also, noch einmal von vorn: ein paar Nahaufnahmen literarischer Lebenskapitel aus den Zeiten, als die Bücher noch geholfen haben.
I.Zwischen Ich und Wir
Jungdichter, Lach- und Lehrmeister
Zum Lachen hatte ich sie gebracht, die Literaten, die kritischsten Köpfe, die man sich im Jahr 1964 vorstellen konnte. Rund hundert Leute hatten zugehört, hatten zustimmend gelacht, und mir schien es, jetzt, wo es vorbei war, ein leichtes Spiel: sie erheitert zu haben mit einigen kurzen, pointierten Gedichten, bei der ersten Lesung am Morgen, nach dem Frühstück, viele Zuhörer vielleicht noch verkatert, alle milde gestimmt. Die ganze gefürchtete und gehasste, die geschätzte, dämonisierte, verehrte Gruppe aus Autoren und Kritikern schaute auf mich, den stotternden Drittsemesterstudenten aus Berlin, ich hielt die Blicke aus, ich hielt sie gern aus, mein kurzer Auftritt war nicht peinlich gewesen, ich hatte nicht gestottert, ich hatte die Probe bestanden. Der Stuhl, auf dem ich saß, wurde elektrischer Stuhl genannt, doch es fand keine Hinrichtung statt. Im Gegenteil, man lobte und ermunterte mich, ich hatte Glück gehabt. Nur einer hatte Einwände – und bot sich ein Jahr später als Doktorvater an.
Aufgereiht sah ich sie vor mir sitzen, die schreibenden Meister mit den berühmten und weniger berühmten Namen, die unerbittlichen Kritiker mit großem und weniger großem Einfluss, die jungen Dichter und viele Unbekannte in der Schulhalle von Sigtuna in Schweden, und fühlte, wie die Angst von mir wich. Beim Abitur, anderthalb Jahre zuvor, hatte ich, der schlechte Schüler, mehr geschwitzt. Hier, bei der Gruppe 47, wäre ein Scheitern keine Schande gewesen, ich hatte mich schüchtern, aber einigermaßen furchtlos unter den Literaten bewegt. Nun war der Initiationsritus überstanden, ich gehörte dazu, ein wenig. Das Schreiben war nicht umsonst gewesen, der Eigensinn wurde belohnt, das Leben, das spürte ich, schien einen Sinn zu bekommen, mit einundzwanzig Jahren in den literarischen Himmel katapultiert.
Aus dem man jederzeit wieder fallen kann. Das wusste ich, das hatte man ständig vor Augen, ich sah ja, wie es anderen ging, die Pech hatten, die missverstanden oder zu hart angegangen wurden. Oder die zu mutlos schrieben oder zu angestrengt. Niemals ausruhen auf winzigem Erfolg, bloß nicht überheblich werden, verstoßen, fallen gelassen wird man schnell.
Ich hatte Glück, fast zu viel Glück. Hatte mit Klaus Wagenbach einen Verleger gefunden, der nicht nur einen Gedichtband für den Herbst des folgenden Jahres versprochen, sondern mich auch Hans Werner Richter empfohlen hatte. Zum Zweiten das Glück, dass es wegen der Reise nach Schweden Absagen gegeben hatte und Richter mich als Ersatzmann im letzten Moment dazugeladen hatte. Und drittens das Glück, am Morgen gelesen zu haben, als noch niemand das scharfe kritische Besteck auspacken mochte und, vom langen Zuhören belästigt, unwirsch und ungerecht zu poltern anfing.
In diesen Tagen kam eine vierte beglückende Erfahrung hinzu: Bei den Diskussionen über die gelesenen Texte zu erleben, wie produktiv und anregend die literarische Meinungsbildung sich entfalten kann. Von den Kritikern, von der Symphonie der unterschiedlichen Argumente eines Jens oder Mayer, Kaiser, Baumgart oder Reich-Ranicki, Raddatz oder Höllerer und vielleicht noch mehr vom Sensorium eines Grass, Weiss, Enzensberger, Fried, Lettau für handwerkliche Fragen ließ sich eines lernen: Intelligente Leute können, ja müssen aus guten Gründen sehr verschiedene Meinungen über literarische Texte haben – und je feuriger sie sich widersprechen, desto besser, Eitelkeit hin oder her.
Höllerer und Baumgart merkte man etwas Zögerndes an, als wollten sie die Vorläufigkeit ihrer Meinungen betonen, Jens glänzte mit eleganten, gebildeten Abschweifungen, Kaiser mit gedrechselter Nuancierungskunst, Mayer mit messerharter Direktheit, Raddatz mit melancholischem, fein dosiertem Pathos, Reich-Ranicki mit flinker Ja-Nein-Pose – kein Wunder, dass der, der am schnellsten seine Urteile fällte und am gröbsten und am wenigsten literarisch argumentierte, Jahrzehnte später der berühmteste wurde. Nie behielt einer Recht, Urteile entwickelten sich im Widerspruch, im inspirierenden Ergänzen, im Wettstreit der Argumente. Jeder von Kritikern Gebeutelte fand wenigstens einen eloquenten Verteidiger, auch die Mehrheit konnte Unrecht haben. Beim Beurteilen literarischer Texte gab es keine Beschlüsse, keine Abstimmungen, kein abschließendes Fazit. Bei permanenter Scherz-, Schimpf-, Streit- und Debattierlust hatten Rechthaber keine Chance. Jedem Teilnehmer blieb überlassen, was er mit den angebotenen Meinungen anfangen wollte – das war das erfrischend Demokratische an den Beurteilungsprozeduren der Gruppe 47 an ihren guten Tagen.
Spätestens jetzt, im September 1964, war der Weg klar: hin zu den Büchern.
In Sigtuna 1964 mit Peter Bichsel und Peter Rühmkorf.
Gerettet durch das Schreiben, aufgestiegen vom verschüchterten Knaben zum studentischen Dichterling, geschmeichelt von ersten Erfolgen und flüchtiger Anerkennung, eingebildet wegen ein paar gelungener Zeilen, hatte ich gar keine andere Wahl als: ein Literaturidealist zu werden. Einer, der an die Literatur glaubt, an ihren Nutzen für Herz und Verstand, an Literatur als unendlichen Speicher von Erfahrung und Erinnerung, als ein allzeit verfügbares Lebensmittel zur Erheiterung, Horizonterweiterung und Stärkung des Ichs. Ein Literatursüchtiger, der eine Droge allen andern vorzieht: die schriftliche, die geformte, die erhellende, die poetische Sprache.
Als Berufswunsch hatte der Abiturient angegeben: Redakteur, Lektor. Nicht Deutschlehrer oder Germanist an der Universität, nicht Bibliothekar oder Archivar, nicht Drehbuchautor – und nicht Schriftsteller, obwohl ich für diese Rolle übte. Nichts Sicheres und nichts Utopisches. Ich wollte nebenher Gedichte schreiben und hauptsächlich Mittler sein, bei einer guten Zeitung oder in einem anständigen Funkhaus. Oder der Mittler zwischen Autoren und Lesern in einem Verlag. Wählerisch sein dürfen, kritisch sein müssen, Ja oder Nein sagen, mitentscheiden. Handwerkszeug: Sprache. Leise, aber mit Leidenschaft hin zur höchsten Kunst, zur Literatur. Hinter dem Berufsziel steckte auch ein moderat missionarisch-pädagogischer Wunsch: Die Bücher und das Gedichteschreiben hatten mir geholfen, also wollte ich dazu beitragen, dass auch andere sich an Büchern, an der Literatur weiterentwickelten – so altruistisch durfte in den sechziger Jahren noch gedacht werden.
Nach der Sigtuna-Erfahrung traute ich mir alles, fast alles zu auf dem großen Arbeitsfeld der Sprachbehandler und -verwandler, in den Werkstätten des literarischen Betriebs, die sich nach und nach öffneten. Ich nutzte jede Gelegenheit, die sich ergab im westlichen Berlin Mitte der sechziger Jahre. Manches vermittelte Wagenbach, der mich gern als seinen jungen Autor vorzeigte, während ich mich als Schweiger, Schüchterner, Stotterer genierte. In größeren Gruppen, in Seminaren oder in der Nähe von bedeutenden, wichtigen Leuten sagte ich nichts, in kleinen Gruppen der Freunde wenig. Ich schwieg, und wie allen Schweigern war mir mein Schweigen peinlich. Während ich hinter der Stummheit nur meine Ängste und Dummheiten sah, wollten andere darin eine eigenwillige Klugheit und Überlegenheit entdecken, ich ließ sie in diesem Irrglauben, musste aber hin und wieder Texte vorlegen, die diese schmeichelhafte Meinung nährten. Da ich in der mündlichen Rede nichts, aber auch gar nichts zu bieten hatte, musste ich alle Kräfte auf das Schriftliche werfen, mit lyrischen, kritischen oder polemischen Zeilen bemerkbar bleiben. Es gab nur ein Mittel gegen Minderwertigkeitsgefühle: schreiben und das Geschriebene veröffentlichen.
Kaum war der Gedichtband «Kerbholz» in Satz gegeben, wagte ich mich ans Prosaschreiben, wusste aber zuerst nur den Ort der Handlung, Butzbach, nicht viel mehr. Wagenbach druckte trotzdem vier Seiten in seinem ersten Verlagsalmanach, ich las bei der nächsten Tagung der Gruppe 47 aus dieser Prosa, auch das ging recht gut ab. Das Angebot von Ernst Schnabel, W.H.Audens «Night Mail», der heute als erster Rap-Text der Welt gilt, für das Dritte Fernsehprogramm zu übertragen, schlug ich trotz meines dürren Schulenglischs und fehlender Übersetzererfahrung nicht aus – das unglaubliche Honorar von siebenhundert DM vertrieb die Skrupel. Bald druckten drei Zeitungen meine Kritiken. Ich half dem Verleger hin und wieder mit einer Beurteilung, schrieb essayistische Referate wie alle emsigen Studenten. Ich las und las wie alle Enthusiasten. Alte Romane, neuste Gedichte, wie sie mir zuflogen, Philosophen, die von Professoren empfohlen oder von der Mode befohlen waren. Wenn noch Zeit war, schrieb ich längere Briefe, drehte für literarische Sendungen das Radio an oder hörte den Freunden in der Kneipe beim Streit über Bücher und Autoren zu und steuerte hin und wieder eine Bemerkung bei. Oder ich fuhr zu Ostberliner Dichtern, bei denen die Gespräche oft spannender, persönlicher waren. Viele Abende im Kino oder im Theater, doch um die Theater- und Filmleute machte ich einen Bogen, ein typischer Einzelgänger, der bei den Dialog-, Team- oder Kollektivkünsten verloren gewesen wäre. Ich zog die freiste, die extremindividuelle Disziplin vor, Literatur.
Prosa im Pullover, Gruppe-47-Lesung Pulvermühle 1967.
Solchen literarischen Aktivismus teilte ich mit vielen in den mittleren sechziger Jahren, aber meine Rastlosigkeit war immer auch das Kontrastprogramm zum Schweigen, ein Behauptungskampf mit der stillen Hoffnung, irgendwann trotz aller Ängste und Dummheit mich selbst finden, akzeptieren und respektieren zu können. Kein leichtes Unterfangen auf dem Trampolin der Ironie und eines fröhlichen Skeptizismus: So wichtig wie die Selbstfindung war die Kunst, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen.
1965 führte ich einige Monate Tagebuch, nur in Stichworten. Auffällig die pausenlose literarische Beschäftigung – wenn man von den Bierrunden, Spaziergängen, Fahrschule und erfolglosen Liebesversuchen absieht. Zwischendrin Vorlesungen und Seminare an der FU und der TU, Mittelhochdeutsch und Lautverschiebungen mussten gepaukt werden, und nicht nur Hans Mayer verlangte in seinem Seminar über die klassische Literaturkritik viel Lektüre. Auf halbstündige Wutanfälle des Professors, etwa weil niemand den Beginn der Freundschaft Goethe– Schiller genau datieren konnte, war man nicht erpicht. Nebenbei nahm ich den gespreizten Jugendstil Stefan Georges genüsslich aufs Korn, deckte die Ambivalenzen eines Kritikers wie Ludwig Tieck auf, verschlang Bücher von Joyce, Kleist, Djuna Barnes, Lenz, Peter Weiss, Jean Paul, Arno Schmidt, Lawrence Durrell, Laurence Sterne und rezensierte zeitgenössische Lyriker. Alles wie beiläufig, ohne Plan und Programm sowieso, alles spielerische Versuche, möglichst abseits von den Trampelpfaden der Nacheiferer von Kafka, Brecht oder Grass, abseits von den Germanisten-Pilgerstraßen Goethe, Rilke oder Thomas Mann eigene Schleichwege zu literarischen Paradiesen zu finden.
Und die Politik? Im Bundestagswahlkampf 1965 schien die SPD zum ersten Mal die Chance zu haben, die CDU zu schlagen, Willy Brandt oder Ludwig Erhard als Kanzler, das war die Frage. Zum ersten Mal engagierten sich Schriftsteller für eine Partei, nicht nur Günter Grass, nicht nur mehrere Autoren der Gruppe 47 mit rororo-aktuell-Büchern. Ungefähr ein Dutzend jüngerer Autoren saß in einem «Berliner Wahlkontor der SPD» und versuchte, Teile aus dem Programm der Partei in schmissiges, in besseres, in Werbedeutsch zu übersetzen. Klaus Roehler verteilte die Aufgaben, Klaus Wagenbach zahlte den Lohn aus, zehn Mark pro Stunde. Bernward Vesper und ich begannen, das Projekt Volksversicherung mit sprachlichen Funken attraktiv zu machen, am Ende kamen dann Sätze zustande wie «Die Rente ist kein Schmerzensgeld für das Alter», die von den SPD-Kandidaten in ihre Wahlreden eingestreut werden sollten. Mit Nicolas Born und Hans Christoph Buch überlegten wir, ob die SPD nicht patriotischer auftreten sollte. «Unser Sport steht im Abseits» formulierte ich zum Thema Sport und Gesundheit, Roehler war mit solchen und ähnlichen Sätzen der Schmal-Demagogie sehr zufrieden. Für den Schatten-Wirtschaftsminister Schiller durfte ich mich im Redenschreiben üben (am Ende ging ein Satz durch die Presse: «Was Adenauer nicht lernt, lernt Erhard nimmermehr»), dann das Deutschland-Manifest der Partei überarbeiten, mit Gudrun Ensslin Zeitungsausschnitte auswerten, mit Vesper und Piwitt und Herburger Anti-CDU-Sprüche dichten, mit Born, Haufs, Fichte Fußballsätze auf die Politik ummünzen, mit Marianne Eichholz spotten, dass das Wahlkontor eine höhere Komik habe: «Wählen ist gut. SPD wählen ist besser.»
Daneben Bellows «Herzog» und Biermann lesen («gut, gut, bis auf allzu penetrante Sozialismen»), um zwei Frauen werben, Prosa vorantreiben, Nono hören, Fahrschulprüfungen absolvieren, sich gegen die SPD-Panik und den Grass-Horror der Großeltern wehren und die Mutter wegen Willy Brandt beruhigen, ein langes Gedicht gegen die langen Gedichte schreiben, Tucholsky studieren, Buster Keaton sehen, den von ihrer Lektüre begeisterten Freunden Buch und Kurbjuhn zuhören, Peter Hamm mit Gedichten, Alfred Kolleritsch in Graz mit Prosa beliefern, mit dem ältesten Freund ständig über die Weltlage debattieren, Frieds «Warngedichte» für die «Welt der Literatur» besprechen, Gerardo Diego für die «Weltwoche», im Forum-Theater Queneaus «Stilübungen» sehen, Freunde in Ostberlin besuchen, ein passendes gebrauchtes Auto finden, den Verleger bei Laune halten, dem während dieser Wochen der Freund und Autor Johannes Bobrowski in Ostberlin starb.
Alles geschah eher beiläufig, ohne sogenannten Stress, ohne Karrierestreben, die Möglichkeiten ergaben sich – oder auch nicht. Bei allem Ehrgeiz waren die politischen und literarischen Tätigkeiten immer von moderatem Unernst begleitet. Es regierte das Spielerische, beim SPD-Engagement genauso wie bei Queneau – unsere Wahlsprüche verfertigten und lasen wir auch als Parodien auf Wahlsprüche. Die Parodie war unauffällig eingebaut in die politischen Formulierungen, im Grunde praktizierten die Berliner Dichter und Jungdichter, ohne es zu wissen, die romantische Ironie: Wer durchblicken lässt, dass die Welt doch ein wenig komplizierter ist als das, was man gerade sagt, relativiert und dementiert sich auf heitere Weise selbst.
Ich wage sogar die Behauptung: Leitkultur im Berlin der vorachtundsechziger Zeit war das Lachen. Viele der literatursüchtigen Leute waren auch Lachsüchtige. Enzensberger etwa, der jeden seiner intelligenten Einwürfe mit Lachen würzte, seine Thesen stets ironisch abfederte und seine Gedichte einer Poetik des Vergnügens verdanken wollte. Man denke an Uwe Johnsons Trockenwitz, an Grassens «Wer lacht hier, hat gelacht», an die Lachkanone Günter Bruno Fuchs und die Kreuzberger Boheme, an Wolfgang Neuss und Wolf Biermann – und zwischen all denen bewegte sich der rastlose Jungdichter. Am meisten aber profitierte ich von den «Lachsäcken» Günter Kunert, Karl Mickel, Kurt Bartsch hinter der Mauer und meinen beiden wichtigsten westlichen Lehr- und Lachmeistern Klaus Wagenbach und Walter Höllerer.
Berlin 1965, U-Bahnhof Innsbrucker Platz.
Einen Startvorteil hatte ich: sehr genau zu wissen, was ich nicht wollte, wogegen ich war. Gegen fertige Begriffe, Floskeln, Sprüche, gegen Dogmen, Ideologie, starre Übereinkünfte, normierte Tradition. Ich setzte auf das, was ich als ideale Sprache verstand: die fragende, die infragestellende, die nachdenkliche, die originelle, die witzige, die widersprüchliche, die literarische Sprache. «Sprache ist, wo sie da ist, für mich das Engagement selbst, weil sie kontern muss, die bestehende Sprache kontern muss», sagte Ilse Aichinger in jener Zeit. Da mir als Kind schon die Religion als Ideologie begegnet war, ahnte ich sehr deutlich, lange bevor ich das mit dürftigem Verstand begriff: dass die literarische Sprache der beste Schutz gegen Ideologie war. Selbst Nietzsche mit seinem protestantischen Pathos schien mir durch und durch Ideologe. Wirklich subversiv war nicht die Philosophie, nicht die Theorie, sondern die Poesie.
Für «eine bessere Welt» steigt der Verleger über den Bauzaun
Es war an einem Novemberabend 1965 gegen 21Uhr, ich saß am Schreibtisch, als jemand an die Fensterscheibe klopfte. Das war noch nie passiert, ich erschrak. Die Einzimmerwohnung mit einem schmalen Küchenvorraum, der auch als Waschraum diente, lag im Erdgeschoss, das Fenster ging zum Hinterhof, wo sich die Toilette befand. Es konnte nur ein Bewohner des Hinterhauses sein, irgendein Notfall. Draußen in der Dunkelheit stand, freundlich feixend wie so oft, Klaus Wagenbach, mein Verleger. Ich ließ ihn eintreten, er musste erzählen, wie er es geschafft hatte, bis an dies Fenster vorzudringen. Die Haustür war, wie damals üblich, ab 20Uhr verschlossen, Klingeln gab es nur für die besseren Wohnungen, nicht für meine, die ehemalige Hausmeisterwohnung, und ein Telefon hatte ich noch nicht. Spontanbesuche waren nach 20Uhr nicht möglich. Wagenbach hatte sich davon nicht abschrecken lassen, war auf das Baugelände der Nebenstraße gegangen, dort über einen Bauzaun gestiegen und hatte dann, sich durch einen maroden Drahtzaun zwängend, den Hinterhof erreicht – und das alles, um mir ein Manuskript zu bringen und mich um sofortige Lektüre und Beurteilung zu bitten. Es war ein Notfall, ein literarischer.
Jakov Lind, damals oft mit Grass verglichen, hatte wenige Tage zuvor bei der Tagung der Gruppe 47 am Wannsee mit einem Auszug aus dem Roman «Eine bessere Welt» Furore gemacht und hätte beinah den Preis der Gruppe bekommen, die Mehrheit war für Peter Bichsel. Lind war mit seinem Verlag, Luchterhand, unzufrieden und hatte das Manuskript Wagenbach angeboten, der im Frühjahr und Herbst gerade seine ersten elf Titel publiziert hatte. Lind hatte den Verleger gedrängt, binnen vierundzwanzig Stunden Ja oder Nein zu sagen, da er zurück nach London müsse, wo der Wiener Emigrant seit Jahren lebte. Er sei noch unentschieden, sagte Wagenbach, er zögere, ich möge bitte lesen und um zwölf Uhr mittags bei ihm vorbeikommen und ein Votum abgeben. Ich brachte Wagenbach zur Haustür, räumte die Schreibmaschine vom Schreibtisch, bereitete einen Nescafé und begann zu lesen.
Nicht zum ersten Mal fühlte ich mich als Leser, als Lektor ernst genommen, aber dies war keine Anfängerarbeit, jetzt kam es auf meine Stimme an. Wagenbach hatte Dutzende literarischer Freunde in Berlin, jeder hätte ihn mindestens so gut beraten wie ich, aber er hatte kein Hindernis gescheut, nicht einmal Bauzäune, Drahtzäune und finstere Hinterhöfe, um das Manuskript ausgerechnet mir anzuvertrauen.
Gewiss, wir waren schon eingespielt, ich hatte ihm als Hilfslektor zugearbeitet, als er Lektor im S.Fischer Verlag in Frankfurt gewesen war und ich das erste Semester hinter mir hatte, im Sommer 1963.Im Hochhaus an der Konstabler Wache stapelten sich die ungelesenen Manuskripte, die Stapel sollten abgetragen werden, und für diese Arbeit hatte Wagenbach mich engagiert, von dem er ein halbes Jahr zuvor zwei Gedichte für die Anthologie zeitgenössischer Lyrik, «Das Atelier 2», angenommen hatte. Ich las, was «unverlangt» eingesandt worden war, und schickte das meiste mit einem Formbrief zurück. Bei den nicht ganz so schlechten Texten formulierte ich zwei Ablehnungssätze, die Wagenbach unterschrieb, und die wenigen diskutablen Manuskripte legte ich ihm vor, sagte meine Meinung dazu, in das eine oder andere schaute er hinein, vier oder fünf las er und lehnte sie selber ab. So schafften wir es in acht Wochen immerhin, die Stapel A bis D oder E abzubauen, den dringlich mahnenden Autoren ihre Arbeiten zurückzuschicken. Natürlich machte ich den Anfängerfehler, mich zu lange mit manchen gutgemeinten, aber schlecht geschriebenen Texten aufzuhalten oder dort, wo ich gelungene Ansätze zwischen missglückten Konzepten oder Formulierungen zu entdecken meinte, den Autoren mit kurzen Argumenten zu antworten. Ich suchte die Qualität, das literarisch Überzeugende auch da, wo es sich erst entwickelte oder wo es verschüttet war – so lange war es noch nicht her, dass ich, als Achtzehnjähriger, selber eine Reihe von Ablehnungsbriefen für meine Gedichte bekommen hatte und sehr wohl zu unterscheiden wusste zwischen Lektoren, die Formbriefe schickten, und denen, die für mich ermutigende Formulierungen, Schwächen und Stärken skizzierend, gefunden hatten, darunter Elisabeth Borchers und Günther Neske. Ich wollte nicht nur ein scharfsinniger, sondern auch ein guter Lektor sein, nicht nur ein Ablehner, auch ein Ermutiger und Förderer. Neinsagen ist auch in dieser Branche keine Kunst, ich wollte, wenn es ginge, Entdecker sein.
Aber woher wusste ich überhaupt, was «gut» war und was «schlecht»? Woher nahm ich, ein paar Monate nach dem Abitur, zwanzig Jahre alt, die Kriterien oder das, was ich für Kriterien hielt? Woher die Sicherheit, einen Text gut oder weniger gut oder schlecht zu nennen? Was machte den sonst so braven, schüchternen jungen Mann so frech und wagemutig, anderleuts Texte in Richtung Papierkorb oder in Richtung Bücherhimmel zu winken?
Ohne die kräftigen Reste spätpubertärer Überheblichkeit, ohne die Jünglingsfrechheit, ständig alles um einen herum zu beurteilen und verurteilen, nur um sich nicht ständig selbst verurteilen zu müssen, ohne diese banale Notwendigkeit der abgrenzenden Selbstbehauptung hätte ich die Lektorentätigkeit nicht ausüben können. Lesen, lesen, lesen, natürlich waren es die Bücher, die schulten. 1963, im S.Fischer-Hochhaus, orientierte ich mich vor allem an der zeitgenössischen deutschen Literatur. In der Lyrik an Enzensberger und Eich, Bachmann und Rühmkorf, Celan und Krolow: was gut war, musste besser oder sehr anders sein als die Gedichte dieser Autoren. In der Prosa an Koeppen oder Johnson, Grass oder Gaiser, Hans Bender oder Arno Schmidt: man musste schon besser oder deutlich anders sein als diese Autoren, um zu bestehen vor dem Gericht, das ich war. Gnadenlos war ich mit denen, die den Rilke-Ton oder den Hesse-Ton nachahmten, und das tat die Mehrheit der Lyrikschreiber. Nicht besser erging es den Autoren, die zu viel Borchert oder Camus gelesen hatten. Die Jahre unter dem Diktat der Bibelsprache und der Trostformeln waren nicht umsonst gewesen: Pathos, Phrasen, Klischees aufzuspüren und als verdächtig, minderwertig beiseitezuwischen, war meine Leidenschaft.
Der strenge, sortierende Blick stieß jedoch hin und wieder auf irritierend uneindeutige Texte, bei denen mühsam herausgefunden werden musste, wo die Qualitäten lagen, wo die Schwächen. Wagenbach versuchte mir die Skrupel zu nehmen: Wenn ein Text nur halb gut sei, wenn er einen nicht voll und ganz überzeuge, dann habe er in einem Verlag nichts zu suchen, jedenfalls nicht im Buchprogramm. Kleine Schwächen, Kürzungen ja, einigen Redigieraufwand brauche selbst Grass, aber der Verlag sei keine öffentlichrechtliche Anstalt, kein Dienstleistungsunternehmen für faire und begründete Bewertung und Beratung zehntausender Schriftsteller und Möchtegernschriftsteller. Diese Einstellung lernte ich von Wagenbach, doch den Ehrgeiz, auch im Unfertigen oder Ungelenken die Begabung und das noch nicht voll entwickelte Können aufzuspüren, habe ich nicht aufgegeben, weder in den späteren Lektorenjahren (in den Siebzigern) noch bei den viel späteren Entdeckungsreisen (in den Achtzigern und Neunzigern) durch die meterhohen Stapel von Manuskripten, die für den Döblin-Preis eingereicht worden waren: immer auf der Suche nach behutsamer, sicher gesetzter Metaphorik auch in der Prosa, nach klaren, geschmeidig gebauten Sätzen mit möglichst viel Spannung zwischen den Punkten und vibrierenden, fein rhythmisierten Sprachmelodien. «Handlung» ist Nebensache.
Die Tätigkeit als Lektoratsassistent in Frankfurt hatte acht Wochen gedauert. Nun, zwei Jahre später, im November 1965, war die Situation eine ganz andere. Klaus Wagenbach hatte seinen eigenen Verlag, ich war der erste junge Autor, dessen Manuskript er angenommen hatte. Wenn ich zu ihm in den Verlag in die Jenaer Straße kam, bat er oft um eine Meinung zu einem Gedicht oder Kurztext, über den er gerade zu befinden hatte. Aber jetzt lag ein Manuskript auf dem Tisch, das den jungen Verlag auf eine harte Probe stellte. Der Roman sprengte das bis dahin übliche Format der Quarthefte, hätte als Doppelband erscheinen müssen, schon das ein Risiko für sich. Außerdem stand die Freundschaft Wagenbach– Grass auf dem Spiel (Grass und Lind mochten sich nicht – der gleiche Schnurrbart, auch im drastisch-eleganten Stil gab es Verwandtes, das konnte nicht gut gehen). All das kümmerte mich nicht, hatte mich nicht zu kümmern, als ich in dieser Nacht zu lesen begann. Schon nach wenigen Seiten festigte sich das Urteil: ein sperriges, verrücktes, schwer verständliches, schlecht verkäufliches Buch, also ein klares Ja. Ich las bis fünf Uhr, schlief vier Stunden, gab mein Gutachten gegen Mittag im Verlag mündlich, und im Frühjahr 1966 erschien der Roman «Eine bessere Welt».
Die Parodie auf Ordnungswahn und Weltverbesserer, der groteske Kampf zwischen verfeindeten Brüdern, die makabre Sorte jüdischen Witzes kam bei den Kritikern und Lesern überhaupt nicht an, zwei Jahre vor 1968.Kein Buch des jungen Verlages wurde so verschmäht und verrissen wie dieses. Erst die amerikanische Übersetzung und eine Bearbeitung als Theaterstück brachten den Erfolg. Die «New York Times» stellte Lind in eine Reihe mit Kafka und Beckett – ganz falsch konnten wir einsamen Befürworter aus Berlin-Wilmersdorf also nicht gelegen haben.
Das Krabbeln des Verlegers über den Bauzaun, das gemeinsame Ja zu Linds verrückten Weltverbesserern hatte jedenfalls Folgen, ungeachtet der Prügel der Literaturkritik. Die Lust am literarischen Werten und Urteilen war gewachsen, das Ziel Lektor näher gerückt. Der Verleger gab mir hin und wieder ein Manuskript mit der Bitte um ein Votum, überließ mir das Lektorieren von Peter Schneiders erstem Buch («Ansprachen») und versprach, dass ich nach Abschluss der Promotion als sein erster literarischer Lektor anfangen könne, halbtags, mit Putzfrauengehalt, versteht sich. So geschah es, im Sommer 1970, drei harte Jahre als Lektor im Wagenbach-Kollektiv, schließlich fünf im Rotbuch Verlag. Für meinen Literaturidealismus, für die Lust, beim Machen von Büchern mitzumachen, und für die bescheidene Rolle als kritischer Anwalt der Autoren und Anwalt der Literatur gab es sogar eine flotte politische Rechtfertigung, mit mehr oder weniger großen Portionen Unernst vorgetragen: eine bessere Welt wird es nur mit Hilfe besserer Bücher geben.
Warum ich kein Kritiker wurde
Zu dem zweifelhaften Glück, kein Kritiker werden zu müssen, hat mir ein Buch verholfen, das ich als Kritiker verrissen habe. Ein Buch oder vielmehr sein Autor, Erich Fried. Zwischen 1964 und 1967 verfasste ich an die zwanzig Rezensionen für die «Welt der Literatur», das «Spandauer Volksblatt», die «Weltwoche», meistens kritisches, deutliches Lob, dazu ein paar saftige Verrisse. Zuerst hatten die Zeilenhonorare gelockt, doch mehr und mehr spürte ich, dass das schönste Honorar die Befriedigung der Eitelkeit war. Mit Kritiken war es am leichtesten, sich gedruckt und beachtet zu sehen, viel leichter jedenfalls als mit Gedichten oder der mühsamen Verfertigung anderer literarischer Texte. Der Kritiker mit seiner kleinen Macht, den Daumen nach oben oder nach unten zu drehen, wurde gehört, verflucht oder geschätzt, Aufmerksamkeit war ihm sicher. Am leichtesten war es, sich hin und wieder das diebische Vergnügen eines Verrisses zu gönnen.
Einer davon traf den Prosaband «Kinder und Narren» des damals noch nicht sehr bekannten Lyrikers Erich Fried – berühmt wurde er erst mit den Gedichten «und vietnam und». Die Kritik erschien im März 1966 in der Schweizer «Weltwoche». («Frieds Fiasko») und wies Fried mit durchaus soliden Argumenten und entlarvenden Zitaten, aber in rüdem Ton zurecht, er solle bei seinem Leisten, bei der Lyrik bleiben, Prosa könne er nicht.
Nun stelle man sich einen Bus voll mit Autoren und Kritikern vor, im April 1966 auf dem New Jersey Turnpike, die Teilnehmer der Tagung der Gruppe 47 werden von New York nach Princeton gefahren. Es gab nicht genug Sitzplätze, sechs oder acht der Jüngsten standen im hinteren Teil des Busses und hielten sich an der Gepäckablage fest, einer davon ich. In der Mitte sitzend Erich Fried. Beim Einsteigen hatte ich darauf geachtet, möglichst nicht in sein Blickfeld zu geraten. Schon im Hotel, beim Empfang im Algonquin, hatte ich seine Nähe gemieden, ihm nur kurz die Hand gegeben. Aus seinem Verhalten konnte ich nicht schließen, ob er die Kritik, die drei Wochen zuvor erschienen war, kannte. Ich wusste nicht, ob die Rezension von der Zeitung schon an den Verlag geschickt und von da zügig an den Autor nach England weitergeleitet oder, um ihn zu schonen oder um weitere Besprechungen zu sammeln, erst einmal zurückgehalten worden war. Seine Miene hatte mir nicht verraten, ob er von dem Verriss bereits gehört hatte oder völlig ahnungslos war.
Ich sah seinen mächtigen Hinterkopf in den mittleren Reihen, und es beschlich mich auf dem New Jersey Turnpike, zwischen all diesen wortmächtigen und erfahrenen Leuten, die Furcht, einer persönlichen Begegnung, einer direkten Konfrontation nicht gewachsen zu sein. In der Gruppe war es nicht ungewöhnlich, dass einer den andern in den Zeitungen angriff oder verriss, genau das machte diesen lockeren Haufen so produktiv und unberechenbar. Polemiken mit kräftigen Argumenten waren gefragt und erwünscht, Corpsgeist dagegen nicht.
Ein Verrat war es also nicht, was ich da verfasst hatte, eher ein Ausweis meiner Unabhängigkeit. Ich fürchtete mich vor etwas anderem, vor einem Disput mit Fried, obwohl der zu den freundlichen und unarroganten Autoren gehörte. Ich sah keinen Grund, etwas zurückzunehmen, meine Argumente schienen mir stichhaltig, aber ich scheute einen heftigen Wortwechsel, einen Streit über das Buch, ich war sicher, nicht schlagfertig genug zu sein, rasch in die Defensive zu geraten, mich in mündlicher Rede vor dem Autor zu blamieren und der Unfähigkeit zum literarischen Urteilen überführt zu werden. Am Schreibtisch war ich stärker.
Das Literaturgericht tagt: Hans Mayer, Peter Weiss, Walter Höllerer, Inge Jens, Marcel Reich-Ranicki, Klaus Wagenbach, Dieter E.Zimmer (v. l.), Princeton 1966.
Als hätte Fried meine Angst vor Blamage, Strafe oder Rache gespürt, drehte er sich plötzlich um. Er hatte einen Fensterplatz auf der linken Seite, er drehte seinen großen Kopf noch weiter um, bis er mir geradewegs ins Gesicht sehen konnte. Keinen anderen als mich hatte der Blick gesucht. Zwei oder drei Sekunden wurde ich fixiert, ich wich nicht aus, obwohl ich spürte, dass er der Stärkere war. Ein Augenduell, das ich nicht verlieren wollte. Ich drehte mich nicht weg, feige wollte ich nicht sein. Ich nickte dem Älteren zu, deutete einen Gruß an. Nun war klar, dass er die Kritik gelesen und dass sie ihn getroffen hatte. Immerhin, er sagte nichts, im fahrenden Bus, bei der Entfernung hätte er schon schreien müssen, fürs Erste bestand keine Gefahr, der Streit konnte vertagt werden. Ich hatte viel Respekt vor dem Mann mit den großen Augen. Ich wusste, er war als Jugendlicher emigiriert, hatte sich in England durchgeschlagen, im Krieg und im Nachkrieg, und hatte bedeutende Gedichte geschrieben, dafür achtete ich ihn. Aber gerade wegen dieses Respekts, sagte ich mir, wird man schreiben dürfen und wird auch ein sehr junger Rezensent schreiben dürfen, wo er die Schwächen sieht, und darum wich ich dem Blick nicht aus.
Zwei oder drei Sekunden, die Augen hinter der schwarzen Brille ließen nicht locker, sie wollten noch mehr sagen. Nichts Feindliches, nichts Strafendes, ich bemerkte etwas Schlimmeres, das mich viel tiefer traf. Ich sah diesen Augen an, dass sie mich durchschauten, sie durchschauten in diesen Sekunden den ängstlichen, ehrgeizigen Jüngling, der ich war. Sie durchschauten, so kommt es mir heute vor, wenn ich diesen vor bald fünfzig Jahren gespeicherten Blick abrufe, warum meine stille und keineswegs kämpferische Natur es nötig hatte, Verrisse zu schreiben, sich auf dem Papier auszutoben mit fixen Urteilen und aus der Literatur von anderen Sätze der Verachtung zu destillieren und so die eigene Seele mit Überlegenheitsgefühlen zu füttern.
Dieser Blick hatte mehr mit dem Adressaten zu tun als mit seinem Absender. Der Ältere hätte gute Gründe gehabt, mich zu hassen, den Schnösel. Aber er schien fast Mitleid mit mir zu haben. Er kannte meine Gedichte, er hielt mich für begabt, aber das hieß gar nichts, begabt waren alle, jedenfalls alle in diesem Bus. In Frieds großen Augen meinte ich zu lesen, wie mir erst nach und nach klar wurde, dass er mich einfach für unreif und damit für inkompetent und literarisch nicht für satisfaktionsfähig hielt. Da kam ein blasser deutscher Student daher, der gerade ein paar Gedichte ausgestreut hatte, und meinte, ihm, dem doppelt so alten Emigranten, in einer Schweizer Zeitung die Leviten über das Prosaschreiben lesen zu müssen! Meine Anmaßung schien er mit amüsiertem Befremden zu betrachten und erstaunlicherweise sogar mit Milde.
Als Fried sich wieder umgedreht hatte, wieder in Fahrtrichtung blickte und das Gespräch mit seinem Sitznachbarn fortsetzte, stellte sich bei mir ein schales Gefühl ein, das ich erst nach und nach zu fassen vermochte. Nicht wegen der möglichen Fragwürdigkeit meiner Argumente oder Kriterien, nicht wegen meines allzu forschen, draufgängerischen Rezensionsstils und auch nicht, weil ich einen einst verfolgten Juden angegriffen hatte, sah ich mich irritiert und beschämt, nein, weil Fried, statt mit einer Replik, mit einem Blick, statt mit seinem Finger, mit seinen Augen auf mich gezeigt hatte, so dass mir nichts anderes übrig geblieben war als mich zu fragen: Wer bin ich denn, ein Urteil zu fällen? Ein Urteil über Fried, ein Urteil über sein Prosabuch, Urteile über andere Autoren, andere Bücher, über wen oder was auch immer. Wer bist du denn?
Die Frage traf, die Frage saß, und da war es völlig unerheblich, dass alle hier im Bus ständig Urteile abgaben, dass ohne Urteile und schroffe Abfertigungen, ohne das Pro und Contra der Wertungen keine künstlerischen Entwicklungen möglich waren und dass literarische Urteile im Gegensatz zu juristischen nur relative und keine definitiven sind. Die Frage Wer bist du denn, ein Urteil zu fällen? traf mich deshalb mit einer solchen Wucht, weil es plötzlich um mich ging, allein um mich. Fried hatte mir mitgeteilt, so verstehe ich heute diesen unvergesslichen Blick, dass ich, der Schnösel, es nötig hatte, Verrisse zu schreiben. Nicht das Buch, welches auch immer, war einer scharfen Kritik würdig, sondern das Ego des Kritikers.
An den folgenden Lesetagen wunderte ich mich mehr denn je, wie die Kritiker der ersten Reihe scheinbar hemmungslos und ohne Skrupel ihrem skrupulösen Handwerk nachgingen. Ich staunte wieder über das Wissen und die analytischen Fähigkeiten jedes einzelnen und hätte gern ein Zehntel der Schlagfertigkeit und Eloquenz des einen oder anderen gehabt, ein Zehntel der Anspielungskunst und des Arsenals von Argumenten. In ihrer Nähe kam ich mir nur dumm und ungebildet vor, der Schüchterne wollte nicht noch mehr eingeschüchtert werden. Ich beneidete sie nicht, die mächtigen Männer mit der richterlichen Gewalt und der extrovertierten Klugheit. Keiner von ihnen, schätzte ich, hätte sich von der Frage irritieren lassen, die ich in Frieds Blick gelesen hatte, Wer bist denn du, ein Urteil zu fällen? Ich war unendlich weit von ihnen entfernt und wollte es bleiben. Die Versuchung, als Kritiker sich durchsetzen zu wollen, stellte sich nach dieser Szene im Bus nicht mehr ein.
Von allen literarischen Beschäftigungen, behaupte ich seitdem, wenn ich zu Pauschalsätzen gedrängt werde, ist die des Rezensierens die leichteste. Viel schwerer ist es schon, unter fünfhundert oder tausend Manuskripten das eine zu entdecken, das den Buchdruck wert ist und den vollen Einsatz eines Lektors, eines Verlages. Noch schwerer, ein solches Buch zustande zu kriegen. Bewerten, Sortieren, Kritisieren, das ist ein ehrbares und notwendiges Handwerk, es wird zuweilen ein wenig überschätzt.
Der Schweiger von Princeton
Im Flugzeug hatten die Zweifel angefangen. Noch nie hatte mich ein eigener Text so unsicher, so nervös gemacht. Mal prüfte ich die Zeilen und war beruhigt, mal blühten die Bedenken, und je näher New York kam, desto schlechter fand ich die drei Seiten, die ein Gedicht sein sollten. Ich wusste nicht einmal, ob es eher ein Kommentar war oder ein Gedicht, ein ironischer Kommentar zu einem Vorfall Anfang Februar dieses Jahres 1966.Berliner Studenten hatten gewagt, was sonst nur amerikanische Studenten wagten, sie hatten, mit Erlaubnis der Polizei, die Straßen der Innenstadt betreten, um gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam zu protestieren. Danach war vor dem Amerikahaus die Flagge der USA ein paar Minuten lang auf Halbmast gezogen worden, vier Eier waren an die Hauswand geflogen, und diese Vorgänge hatten zuerst die Berliner Zeitungen, dann die Berliner Politiker in höchste Empörung versetzt.
Ich hatte am Rand gestanden, hatte alles beobachtet und das Groteske dieser Stunde erfassen und festhalten wollen, gegen alle Widerstände. Es war riskant, sich von aktuellen Streitfragen zum Schreiben verlocken zu lassen. Über «Tagespolitik» zu schreiben, galt als unfein. Sich über die Nebenwirkungen eines Kriegs lustig zu machen, der von unseren Freunden und Beschützern irgendwo in unbekannten Fernen geführt wurde, gehörte sich nicht. Ich hatte viel Überwindung gebraucht, damit anzufangen. So war mein bisher längstes Gedicht entstanden mit langen Zeilen, die viel zu wenig poetisch geraten waren, fand ich, im isländischen Flugzeug über dem kanadischen Eismeer.