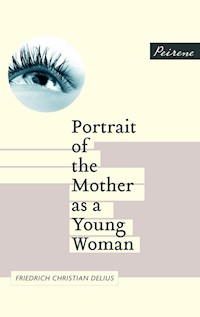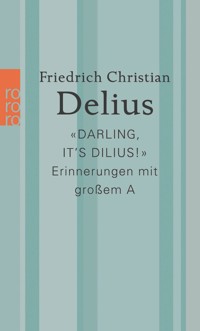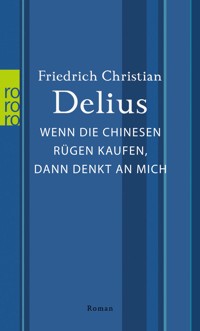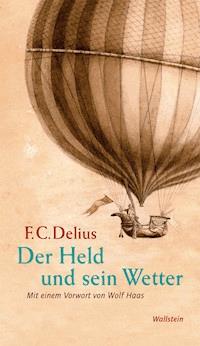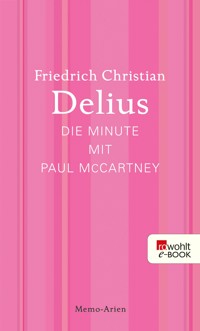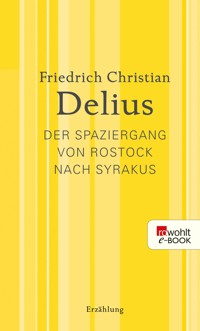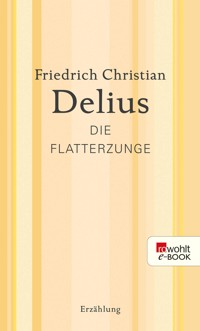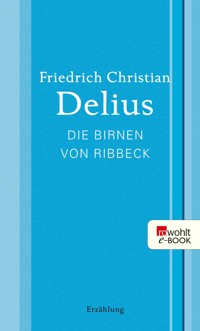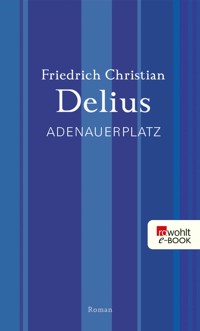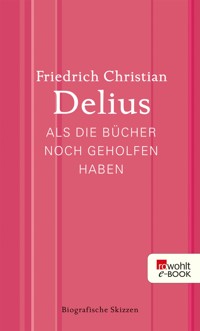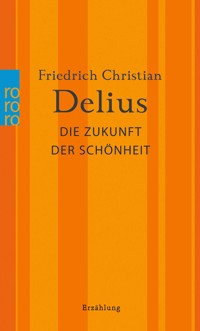
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Große musikalische Erzählkunst. Friedrich Christian Delius über den Aufbruchsgeist einer Epoche Am 1. Mai 1966 gerät ein junger Deutscher aus der hessischen Provinz in einen New Yorker Jazzclub, es spielt der Saxophonist Albert Ayler. Befremdet, beleidigt, beschwingt von der unerhörtesten Musik jener Zeit, beginnt der junge Mann, das ganze unheilvolle Durcheinander der Gegenwart aus diesen Tönen herauszuhören, den Mord an Kennedy, den Vietnamkrieg, den Börsenlärm, den Kampf der Schwarzen, die Studentenproteste. Je mehr er sich einlässt auf die wilde Musik, desto näher kommt der angehende Dichter sich selbst, bis zum verdrängten Schmerz eines Vaterkonflikts, der von einem anderen Jazzkonzert ausgelöst wurde, und zu den peinlichen, pubertären Anfängen seines Schreibens. Gebannt von Aylers Improvisationsräuschen, begreift der junge Mann in einem hellsichtigen Assoziationstaumel die revolutionäre Energie, die in Wachheit und Wut steckt. Diese Musik lässt ihn körperlich fühlen, wie Zerstören und Zersetzen der Beginn alles Schönen sein kann und die Kunst das Rettende wird. Eine autobiographische Erzählung von Friedrich Christian Delius, die den Aufbruchsgeist einer ganzen Epoche beschwört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Friedrich Christian Delius
Die Zukunft der Schönheit
Erzählung
Über dieses Buch
Große musikalische Erzählkunst. Friedrich Christian Delius über den Aufbruchsgeist einer Epoche
Am 1. Mai 1966 gerät ein junger Deutscher aus der hessischen Provinz in einen New Yorker Jazzclub, es spielt der Saxophonist Albert Ayler. Befremdet, beleidigt, beschwingt von der unerhörtesten Musik jener Zeit, beginnt der junge Mann, das ganze unheilvolle Durcheinander der Gegenwart aus diesen Tönen herauszuhören, den Mord an Kennedy, den Vietnamkrieg, den Börsenlärm, den Kampf der Schwarzen, die Studentenproteste. Je mehr er sich einlässt auf die wilde Musik, desto näher kommt der angehende Dichter sich selbst, bis zum verdrängten Schmerz eines Vaterkonflikts, der von einem anderen Jazzkonzert ausgelöst wurde, und zu den peinlichen, pubertären Anfängen seines Schreibens. Gebannt von Aylers Improvisationsräuschen, begreift der junge Mann in einem hellsichtigen Assoziationstaumel die revolutionäre Energie, die in Wachheit und Wut steckt. Diese Musik lässt ihn körperlich fühlen, wie Zerstören und Zersetzen der Beginn alles Schönen sein kann und die Kunst das Rettende wird.
Eine autobiographische Erzählung von Friedrich Christian Delius, die den Aufbruchsgeist einer ganzen Epoche beschwört.
Vita
Friedrich Christian Delius, geboren 1943 in Rom, gestorben 2022 in Berlin, wuchs in Hessen auf und lebte seit 1963 in Berlin. Zuletzt erschienen der Roman «Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich» (2019) und der Erzählungsband «Die sieben Sprachen des Schweigens» (2021). Delius wurde unter anderem mit dem Fontane-Preis, dem Joseph-Breitbach-Preis und dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Im Rowohlt Taschenbuch Verlag erschienen seine Bücher als Werkausgabe.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung any.way, Walter Hellmann
Coverabbildung (ohne)
ISBN 978-3-644-10063-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Marcel Beyer, Hans Christoph Buch, Eberhard Delius, Hanspeter Krüger
Und die Musik hielt keinen Augenblick still, die Musik kannte kein Nein.
(Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften)
Das Taxi hatte länger gebraucht als erwartet bis in die abgelegene, finstere Ecke der unteren Lower East Side an der 3. Straße, wo zwischen Backsteinwänden und Feuerleitern der Eingang zu Slugs’ Saloon nicht schwer zu finden war. In dem Augenblick, als wir den Saal betraten, wurden die Lichter ausgeschaltet, legten die Musiker los mit kreischenden, klagenden, schrillen Tönen, nur die schwachen Bühnenscheinwerfer halfen uns, in dem nicht sehr großen Kneipenraum den letzten oder vorletzten freien Tisch in den hinteren Reihen anzusteuern, während die Ohren beschossen wurden von Getröte, Gezirpe, Gehämmer, Gejaule, als sollten wir mit dieser Folge von Dissonanzen gleich abgeschreckt, des Saales verwiesen und wieder zurück Richtung Exit getrieben werden –
Das musst du jetzt aushalten, das wirst du aushalten, sagte ich mir, als wir uns gesetzt hatten, die beiden Freunde und ich, der ihnen gefolgt war, mach gute Miene, lehn dich zurück und hör einfach zu oder hör weg, das hältst du jetzt aus. Fünf Musiker auf der schmalen Bühne, einer mit Saxophon, einer mit Trompete, einer am Schlagzeug, ein Bassist und ein Geiger, fünf Männer prügelten mit ihren Instrumenten auf meine Hörnerven ein, und ich dachte nur, lehn dich zurück und hör einfach zu oder hör weg –
Musik war das nicht, aber was sollte das sein, wenn es keine Katzenmusik war, das naheliegende Wort, das einem Laien und einfallsarmen Zuhörer wie mir schon bei den ersten Takten in den Kopf gerutscht war, eine böse und trotzdem treffende, kaum zu bestreitende Bezeichnung für das Zirkusgetöse, die verstörenden und schmeichelnden Töne, die schrille Verweigerung von Harmonien und Melodien, für den Schock, den ich fühlte, und die Schockwellen, die sich weiter steigerten. Ich sah, wahrscheinlich mit fragenden und, wie ich hoffte, nicht allzu schülerhaft hilfesuchenden Augen, auf die beiden Freunde neben mir, die mich ermutigten mit zustimmendem Grinsen zu diesem Schallüberfall und mit lechzender Aufmerksamkeit, fast schon bereit zum ersten rhythmischen Wippen der Köpfe, die Freunde hatten mich gewarnt –
Ob das noch Musik sei, ob da oder da der Jazz aufhöre oder ganz neu anfange, ob das richtige Musik sei, ob es richtigen Jazz überhaupt gebe und geben dürfe, hatten die beiden Experten beim Frühstück am vorletzten Tag unserer newyorkischen Reise diskutiert, der Autor Christoph, der diesen verrückten oder genialen Albert Ayler schon mal in Kopenhagen gehört hatte, und der Redakteur Peter, der beim Sender Freies Berlin irgendwie auch mit Jazz zu tun hatte. An dem Gespräch hatte ich mich nicht beteiligt, hätte mich gar nicht beteiligen können, das Wort Free Jazz sagte mir wenig, der Name Ayler sagte mir nichts, das Lokal Slugs’ Saloon galt meinen Fachleuten als Geheimtipp in verrufener Gegend, und während sie bei Grapefruitsaft und schwarzem Kaffee, bei Rührei mit Speck sich in immer größere Begeisterung und Vorfreude auf das Konzert geredet hatten, war meine Entscheidung gefallen, der Aufforderung der beiden zu folgen und mitzufahren am Abend, mehr von Abwechslungslust gelockt als von gezielter Neugier auf diese Sorte Jazz –
Nach einer Woche der Besichtigungen, U-Bahn-Touren, nach stundenlangen Läufen in Manhattan, mal allein, mal zu zweit oder zu dritt, war ich erschöpft von der Wucht der Eindrücke, der Lebendigkeit der Bilder, von den Kontrasten zwischen Schaufensterglanz, Schäbigkeit und vibrierendem Optimismus, erschöpft vom permanenten Wechsel zwischen der Härte, die einem an den Straßenecken ins Gesicht schlug, und der Freundlichkeit der Leute, die sich von der Berliner Bissigkeit so wohltuend abhob. Fürs Erste hatte ich genug von Wolkenkratzerfernblicken, Museen, Kauftempeln, angeblich gefährlichen Straßen in Harlem und Kaschemmen in SoHo, und diesen letzten Abend vor dem Abflug wollte ich nicht in einem Kino oder in einer Bar am Times Square vertrödeln. Also lieber ein halbherziges Interesse an der mir unbekannten, verrufenen Underground-Musik vortäuschen und dem Rat der Freunde folgen, die sich auch im Hotel Paris einquartiert hatten: Komm mit, so schnell bist du nicht wieder in New York, so schnell wird man Ayler nicht mehr hören können, schon gar nicht in Berlin –
Wir bestellten Bier, ich gab mir Mühe, lässig und aufmerksam auszusehen und das Gehör einzustimmen, die Ohren zu öffnen und an diese Musik zu gewöhnen. Der bärtige Mann mit dem riesigen Saxophon in der Mitte musste der berüchtigte, der unter Kennern berühmte Ayler sein, der uns mit schreienden, stechend hohen Tönen, mit nie gehörtem dissonantem Sound begrüßte und überfiel, schreckte und abschreckte schon mit dem ersten Stück. Ayler mit kariertem Jackett, Krawatte und weißem Hemd bewegte sein erstaunliches Saxophon, Tenor Sax, wie Christoph mich belehrt hatte, heftig hin und her und auf und ab und dirigierte die Band mit dem im Bühnenlicht blitzenden Instrument und spuckte befremdliche Töne in alle Richtungen. Die ganze Band, alle etwa zehn Jahre älter als wir, hätte ich mir bei geschlossenen Augen als eine Gruppe von Kindern vorstellen können, die mit Tröten, Topfdeckeln, Kochlöffeln, Rasseln, mit Mundharmonikas und Kämmen vor dem Mund und mit einer alten, verstimmten Geige auf sich aufmerksam machte –
Düster der Saal und schmal, schmucklose Wände, ältere Einrichtung, hinter uns der Tresen, nur wenige weiße Gesichter hinter den Rauchschwaden zu entdecken, wir gehörten zur Minderheit, hier saß man unter Kennern, achtzig Leute ungefähr, fast alle ließen eine Zigarette glimmen. Hier musst du den Kenner spielen und auch im Halbdunkel deinem Gesicht nicht anmerken lassen, wie schwer dir das Zuhören fällt, sagte ich mir, du hältst das aus, du bist nur ein Anfänger, dem etwas Neues geboten wird, lehn dich zurück, du musst heute nicht vom Dreimeterbrett springen, keine Lateinprüfung nachholen, du stehst heute nicht auf der Bühne –
Noch immer nicht hatte ich verstanden, wie frei ich in diesen amerikanischen Tagen war: nicht auf einer Bühne sitzend, nicht vor hundert klugen Leuten auf dem sogenannten elektrischen Stuhl, dem Vorlesestuhl der Gruppe der berühmten Schriftsteller, auf dem ich zweimal die Probe bestanden hatte und deshalb zum dritten Mal eingeladen war, sogar bis in die USA. Ein neuer Auftritt, den ich mehr gefürchtet als erhofft hatte, war mir erspart geblieben wegen des großen Andrangs der anderen auf diesen gefährlichen Stuhl, ich war noch einmal davongekommen, man hatte nicht geprüft, was ich konnte, man duldete mich auch so. Danach die hitzigen Debatten über The Author in the Affluent Society, dann drängelten die Autoren mitten hinein in die literarische Wohlstandsgesellschaft, zu den Partys, zur Konversation über die misslungene Tagung, in ihre Dichter-Eitelkeiten, bis alles verebbte in anstrengenden Sätzen mit Emigranten oder mit Allen Ginsberg im Kreis seiner Jünger, der jeden Abend irgendwo auftauchte und berauscht in irgendwelchen Küchenecken zu Boden sank. Ich war am Rande dabei gewesen, fand vieles komisch, vieles peinlich und hatte genug von all dem Ernst und Getue dieser Tage, von den Paradiesvögeln und dem Getratsche über den Österreicher, der sich auf dem Empire State Building vor Fernsehkameras als neuer Kafka ausgerufen hatte. Jetzt kam mir das Getröte und Getrommel nur recht, am letzten Abend vor dem Rückflug das wilde, verschreckende Saxophon –
Ich konnte mich zurücklehnen, durchatmen, brauchte seit einer Woche keine Angst mehr zu haben, vor nichts und niemandem Angst, schon gar nicht vor dieser aufgeregten, aufdringlichen Musik, ich brauchte nur ruhig zu sitzen und auf mich trommeln und tröten zu lassen, was da wollte, und die Ohren aufzusperren, so weit es nur ging. Sie zuzuhalten wäre normal gewesen, wenn man sie schon nicht entlasten konnte wie am Radio mit einem Druck auf die Austaste, gegen solche Reflexe wusste ich mich zu wehren, hier unter Kennern und vor den Freunden galt die Devise: Keine Schonung bitte, wir sind schließlich in New York, da haben Schwächlinge nichts zu suchen, da wird nicht gekniffen –
Das also sollte die freieste Spielart des Improvisierens sein, frei hieß freie Fahrt für jede Sorte Geräusch, frei unter dem Dirigat eines rebellischen Saxophonisten. Das war das Unerhörte, das war der Jazz, den ich nicht kannte, der weiter ging als die Avantgarde, als John Coltrane und Miles Davis, der weiter ging als Monk und tausend Meilen weiter als der gute alte Louis Armstrong. Auch bei denen hatten die Zuhörer, vor Jahren, vor Jahrzehnten, nach der ersten Empörung und Ablehnung sich gewöhnen und einhören und dem Reflex widerstehen müssen, die Hände auf die Ohren zu drücken –