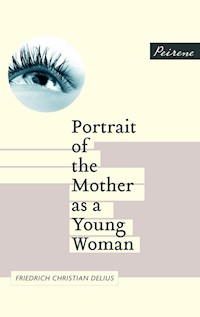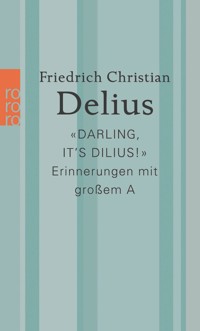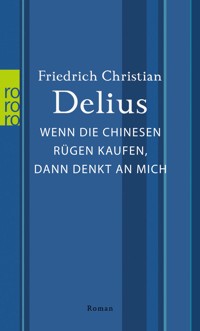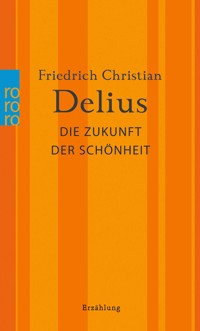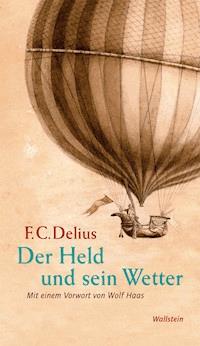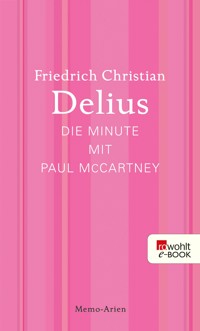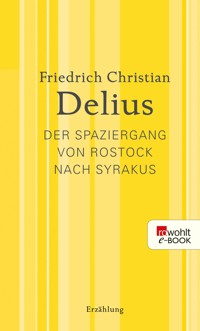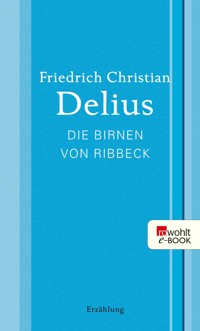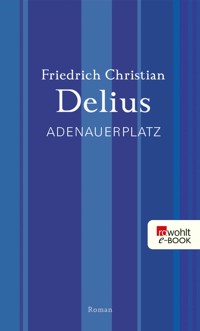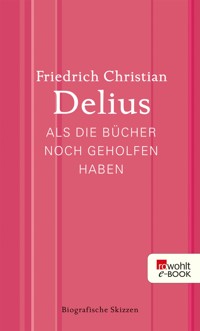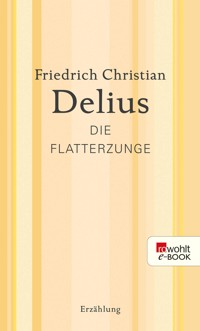
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Delius: Werkausgabe in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
Ein gestandener Musiker verliert für ein paar Sekunden die Beherrschung – und alles ändert sich. Er verliert seine Arbeit, seine Freunde, seine Freundin. Seine Tat ist so banal wie ungeheuerlich: In einer Hotelbar in Tel Aviv hat er einen Getränkebeleg mit Adolf Hitler unterschrieben. Friedrich Christian Delius greift einen Vorfall auf, der 1997 durch die Presse ging, und fragt: Was führt einen, der kein Antisemit ist, zu solch einer Entgleisung? Ein spannendes, leicht verrücktes Tagebuch über Musik und Liebe, Berlin und Tel Aviv, deutsche Komplexe und italienische Arien, über Amokläufer und Blechbläser – ein politisches Rätsel mit einem überraschenden Finale.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Friedrich Christian Delius
Die Flatterzunge
Erzählung
Über dieses Buch
Ein gestandener Musiker verliert für ein paar Sekunden die Beherrschung – und alles ändert sich. Er verliert seine Arbeit, seine Freunde, seine Freundin. Seine Tat ist so banal wie ungeheuerlich: In einer Hotelbar in Tel Aviv hat er einen Getränkebeleg mit Adolf Hitler unterschrieben. Friedrich Christian Delius greift einen Vorfall auf, der 1997 durch die Presse ging, und fragt: Was führt einen, der kein Antisemit ist, zu solch einer Entgleisung? Ein spannendes, leicht verrücktes Tagebuch über Musik und Liebe, Berlin und Tel Aviv, deutsche Komplexe und italienische Arien, über Amokläufer und Blechbläser – ein politisches Rätsel mit einem überraschenden Finale.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Februar 2015
Copyright © 1999 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung C. Günther/W. Hellmann
(Umschlagabbildung: Staatliches Institut für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz; K. Petersen)
ISBN 978-3-644-03581-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
I
II
III
Editorische Notiz
Rezensionen
Friedrich Christian Delius
I
Was mir am meisten fehlt, ist der Beifall. Was mir fehlt, sind die eine oder zwei Sekunden Pause nach dem letzten Akkord, der explosive Stillstand, in dem sich alles Gehörte bündelt und bricht, ein schwarzes Loch, ein weißes Loch der Stille, in dem die Stimmen und Figuren, die Töne und Bilder der Oper gebündelt sind und gleichzeitig verschwinden. Aber schon rühren die ungeduldigen Zuhörer die Arme und zerschlagen diesen wunderbaren, viel zu kurzen Augenblick. Dann klatschen mehr als tausend, zweitausend Hände aufeinander, ein neuer Sog entsteht, und der Beifall rauscht los, fällt hoch von den Rängen und nah vom Parkett hinab, in heftigen, in warmen, in stürmischen Wellen, und ich beginne auch diesen Lohn zu genießen.
Nein, einer wie ich in der vorletzten Reihe des Grabens ist nicht so töricht zu glauben, dass auch nur ein Mensch im Saal da oben an ihn denkt. Aller Applaus gilt den Sängerinnen, den Sängern, dem Regisseur, dem Dirigenten, dem Chor, den Meistern der Bühne, Kostüme und Maske und zuletzt dem Orchester und ganz zuletzt den Blechbläsern. Trotzdem hole ich mir jeden Abend meinen Anteil, schließe die Augen und moduliere die Kaskaden des Beifalls nach meinen Phantasien, mal eine angenehme Dusche, mal ein warmer Mairegen, mal das Abklingen eines Orgasmus. (Übertreibe ich, Herr Richter? Kann sein. Sie werden sich daran gewöhnen müssen.)
Über unseren Köpfen die Sängerinnen und Sänger, eben noch ermattet, vergiftet oder erdolcht, verbeugen sich, fassen sich bei den Händen, hüpfen in die Kulissen und springen wieder zurück und lenken alle Aufmerksamkeit auf sich. Im Zentrum aller Blicke die tiefen Dekolletés der Sängerinnen, und die Leute im Parkett und auf den Rängen hauen sich die Hände wund, als dürften sie endlich selbst ihren Auftritt feiern: Applauso fortissimo, tutti. Schlag um Schlag, Vorhang um Vorhang wird die Spannung abgetragen, die wir Takt für Takt aufgebaut haben, auch wir mit den Instrumenten. Ein Teil dieser Ernte gehört mir, und es hat mir nie gereicht, wenn der Dirigent den Wink zum Aufstehen gibt, damit wir mit drei Sekunden Anerkennung abgespeist nach Hause gehen können.
Jeden Abend besiegeln wir mit den Zuhörern und Zuschauern, ob sie Kenner oder Banausen sind oder zu den vielen möglichen Kreuzungen aus Kennern und Banausen zählen, einen Pakt: Wir spielen auf, und sie dürfen mit ihrem Beitrag, dem Klatschen, das luftige Reich der Musik verkleinern, verwischen, vernichten. Unter dem Vorwand der Bewunderung und der Dankbarkeit für gute Leistung schieben sie mit den Kanonaden ihres Beifalls die erschöpften, strahlenden Sänger in die Kulissen und uns Musiker in den Graben zurück. So finden sie allmählich ihr Gleichgewicht wieder und kehren, verzückt, bewegt, vielleicht noch mitgenommen vom Finale, oft zögernd, ob sie nach all den Harmonien der realen Welt schon wieder trauen dürfen, in den Alltag des Gebens und Nehmens zurück, treppab Richtung Garderobe.
Ich lasse das Wasser aus dem Zug und nehme das Mundstück ab. Wenn der Abend gut war, bin ich glücklich, dabei gewesen zu sein, und der Beifall bleibt mir stärker im Ohr als die letzten paar Töne, die ich zu spielen hatte. Endlich habe ich meine Dosis, die mich hebt und trägt.
Ich hatte sie. Das ist das Schlimmste, was mir fehlt. Jetzt weiß ich, was das heißt: Entzug. Lebenslänglich ohne Beifall, das halt ich nicht aus.
Ist ein Mann in’ Brunnen g’fallen, hab ihn hören plumpsen. Wär er nicht hineingefallen, wär er nicht ertrunken. Mit diesem Kinderliedchen beginnt die Karriere des Posaunenspielers, er übt die Positionen 1 6 4 3 1 1 1 1 und so weiter. Das erste Lied, das nach den einfachen Ton- und Zungenübungen gespielt werden soll. Damals, in der Pubertät, habe ich nicht aufgehört, über den Text, über diesen Konjunktiv nachzugrübeln: wär er nicht, wär er nicht …
Fristlos entlassen. Die Klage auf Wiedereinstellung ins Orchester liegt bei Gericht. Drei, vier Monate soll es dauern bis zum Prozesstermin. «Schreiben Sie alles auf, was Ihnen zu Ihrer Verteidigung einfällt, alles, was mit Ihrer Person zu tun hat und Ihrem Werdegang», hat Dr. Möller gesagt, «lieber zu viel als zu wenig. Wir gehen das dann zwei Wochen vor dem Termin durch und machen einen Extrakt, und wenn es gut ist, werd ich alles tun, damit Sie ausführlich zu Wort kommen.»
Vorher will der Anwalt nichts lesen. Kann mir Zeit lassen.
Ich gebe alles zu, Herr Richter, ich habe alles falsch gemacht, ich bin schuldig. Mein ganzes Leben ein Idiot gewesen. Auch mit den Frauen ist immer alles schiefgelaufen, fast immer. Ich habe es mir im falschen Orchester bequem gemacht, vielleicht sogar das falsche Instrument gewählt.
Ja, lassen Sie mich mit dem Einfachsten anfangen, mit diesem Ding aus Messing, das mir zu einem Körperteil geworden ist, ohne das mein Kreislauf, mein Nervensystem und alles, was meine Energien pulsieren lässt, nicht funktionieren würde.
Die Posaune ist mir zugefallen, als der Musiklehrer Kyritz meine Stimmbruchstimme nicht mehr im Chor brauchen konnte und mich in das Schulorchester dirigierte. Die Posaune war frei, niemand wollte die Posaune. Ich gehorchte Kyritz, wie ich immer gehorcht habe, fast immer. Ich übte, wie man die Luft aus dem Zwerchfell in die Mundhöhle holt und mit locker schwingenden Lippen in Einheiten von Achteln, Vierteln und Halben – und (am liebsten, am bequemsten, ich geb auch das zu) in ganzen Noten – ins Mundstück, ins Blech bläst, mit der rechten Hand im gleichen Takt den Zug hinauf- und hinunterzieht und auf saubere, pünktliche Töne hofft.
Es ist keine Kleinigkeit, wenn ich das hier für den Laien, der unsere Kunst sehr zu unterschätzen pflegt, einflechten darf, allein mit dem Atem, den Lippenmuskeln und dem Stoßen und Wegziehen der Zunge saubere Töne zu erzeugen. Außerdem ständig die Position des Zugs zu wechseln, was dreimal schwerer ist, als auf ein Ventil zu drücken. Nach wenigen Übungsstunden scheuchte mich Kyritz in den Evangelischen Posaunenchor. Im Schulorchester war nicht viel zu tun, aber an Chorälen war kein Mangel. Ich blies einfach mit, ließ anfangs die hohen und schnellen Töne und die mit mehr als zwei bs und zwei Kreuzen einfach aus und spielte schleppend vom Blatt, was Alfred Kyritz und das Kirchenjahr verlangten.
Natürlich hätte ich mich lieber an der Trompete gesehen. Die Trompeter waren Stars, sogar in einer hessischen Kleinstadt. Die Trompete war einfacher zu spielen, mit der Trompete konnte man träumen von einer Karriere im Jazz. Bei einer Klassenfahrt hatte ich Louis Armstrong gesehen, in Hamburg auf der Straße vor seinem Hotel, und begeistert geschrien: «Satchmo!» Da hatte er in meine Richtung gewinkt und freundlich gegrinst, und ich noch einmal seinen Namen gerufen. Von Louis Armstrong bin ich, das versuchte ich mir jahrelang einzubilden, zum Trompeter geweiht worden, nicht zum Posaunisten.
Aber die Trompete war nicht frei. Weder im Posaunenchor noch im Schulorchester. Zu drei Weihnachtsfesten und drei Geburtstagen wünschte ich mir eine Trompete oder Geld für eine Trompete, aber erklären Sie einem beinamputierten Finanzbeamten einmal, dass Sie für eine Trompete dreihundert, vierhundert Mark ausgeben wollen (damals, um 1960), wenn Sie eine Posaune geliehen, also umsonst haben können. Vielleicht hab ich schon das falsch angefasst, mit der wütenden Überheblichkeit eines Siebzehnjährigen!
Ich gab auf, ich passte mich an und wurde Posaunist. Viel hab ich mir nicht eingebildet auf das Lob für meine Soli – im Lokalblatt, in der «Korbacher Zeitung», neben den Berichten über Taubenzüchter und Feuerwehrbälle. Aber ich wollte solche Sätze eines Tages in einer Hamburger oder Frankfurter Zeitung lesen. Kyritz sagte: «Sie schaffen das!»
Auf der Hochschule lernte ich erst einmal, dass ich ein Polsterzungeninstrument vor mir habe und kein Blechblasinstrument. Das war schon mal ein Aufstieg. Polsterzungenbläser, das hört sich gut an, darum galten wir als gute Küsser. Immer noch lockte mich Louis Armstrong ins Reich der Trompeten, aber mein Lehrer bestach mich mit Lob.
Gewiss, ich hätte noch umsteigen können, Oboe, Fagott, Klarinette, aber die wollten alle spielen, das waren die Mode-Instrumente. Ich seh meine Jahrgänge noch vor mir, schöne Mädchen küssten die Mundstücke ihrer Klarinetten und Oboen, ehrgeizige Jungen lutschten am Fagott, die Flöten waren den Pickligen vorbehalten, und wer ans Blech ging, zog auch hier die Trompete vor oder das Horn. Also blieb ich der Posaune treu.
Dachte ich damals schon wie ein Beamter? Hätte ich mich für das Saxophon, für eine ungewisse Zukunft entscheiden sollen? Ja, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Gut sein, perfekt sein. Mich nicht wie mein Alter nach Pfennigen bücken. Bleib bei deinem Leisten, blase fleißig ein paar Semester, dann kriegst du deinen festen Sitzplatz in einem Orchester und irgendwann deine Solozulage. Zum Ausgleich spielte ich ein bisschen Jazz, aber den Traum, ein deutscher J.J. Johnson zu werden, gab ich schnell auf. Schon an Albert Mangelsdorff, das wusste ich, würde ich nicht vorbeikommen, der würde in Europa immer die Nummer eins bleiben.
Entschuldigen Sie bitte, wenn ich zu ausführlich werde und hier mit Namen von berühmten Musikern aufwarte. Aber wie soll man mein Verbrechen verstehen und beurteilen, wenn man die Kette meiner Niederlagen und Aufstiege nicht kennt?
Nein, ich will kein Mitleid und keine mildernden Umstände. Zum Jammern bin ich nicht geboren. Ich bin selber schuld, aber ich will wenigstens einmal erklären warum. Geben Sie mir mehr Zeit als die Journalisten, mehr als drei Minuten!
Aus meiner Rolle komm ich sowieso nicht raus: der Teufel von Berlin, der Hund von Tel Aviv.
Die Täterpersönlichkeit, bitt schön.
Herr Richter, werden Sie mir überhaupt zuhören? Oder übe ich ganz umsonst meine Selbstverteidigung? Dürfen Sie mir zuhören? Sie schuften am Fließband des Arbeitsgerichts, eine Stunde Verhandlung pro Fall höchstens, dann steht der nächste Gekündigte vor der Tür. Eine Stunde, da bleiben vielleicht fünf Minuten Redezeit für mich, dann werden Sie mir das Wort abschneiden – auf die freundliche Tour, denn ein Unmensch wollen Sie nicht sein, wenn Sie schon einen Unmenschen vor sich haben.
Sicher, man wird mir keine Gelegenheit zur großen Rede geben. Aber ich will auf jedes Argument, auf jede Frage vorbereitet sein.
Deshalb alles aufschreiben, nichts auslassen. Deshalb mach ich mir weiter Notizen. Oder spreche weiter auf die Kassette und tipp das ab. Ich hab keinen Psychiater, ich kann mir keinen leisten. Ich will mich hören, will endlich einmal hören, was ich zu meinem Fall zu sagen habe. Ich bin es nicht gewohnt, immerzu von mir zu reden. Aber es gefällt mir. So schnell geht das, wenn man keinen Dirigenten mehr vor der Nase hat morgens mittags abends, rausgeschmissen aus dem Orchester, aus den Dienstplänen, verbannt aus der Gruppe, der Bläsertruppe, Feind der Gemeinschaft.
Ich. Ich habe. Ich habe keine einfachen Deutungen für mein Verbrechen. Meine Gegner haben eine einzige Erklärung: Nazi. Meine Verteidiger auch nur eine: Alkohol. Alle suchen sie eine Formel, sie werden sich nie einigen. Ich muss mich mit mir selber einigen. Also sage ich, Herr Richter, es gibt hundert Gründe. Oder, um es weniger posaunenhaft zu sagen, es gibt ein Dutzend Gründe für meine Tat. Lassen Sie zu, dass ich wenigstens fünf oder sechs auftische?
Am meisten bedaure ich, den Ausflug nach Jericho verpasst zu haben. Ruhige Tage, hatte unser Betreuer gesagt, keine extremen Spannungen, keine Attentate die letzten Wochen, also können wir es wagen, wer will mit im klimatisierten Bus durch die Judäische Wüste nach Jericho hinunter, Qumran, am Toten Meer entlang, Ein Gedi, Massada? Ich sofort dabei, die vierzig Plätze waren schnell vergeben. Ja, ich wollte Jericho sehen, die älteste Stadt der Welt, zehntausend Jahre alt, jetzt ein armseliges Städtchen, von Arafats Leuten kontrolliert, und als Beispiel hingestellt für den Anfang eines Palästinenserstaates, 250 Meter unter dem Meeresspiegel, da musste man hin, falls es nicht zu gefährlich war. Ich bin kein politischer Mensch, zugegeben, und in Wahrheit lockte mich die Stadt nur, weil sie das heimliche Mekka aller Posaunisten und Trompeter ist.
Aus dem Reiseführer wusste ich, dass die Ruinen des alten Jericho nördlich der heutigen Stadt zu besichtigen sind. Dort hätte ich mir die Steinquader der dicken Mauern und Türme in die Luft über die Ruinen gezaubert, wie ich sie kenne aus der Bilderbibel von Schnorr von Carolsfeld und noch heute vor Augen habe beim Stichwort Jericho. Ich hätte mein Dienstinstrument nicht mit in die Wüste genommen (mein eigenes, mein gutes Stück hatte ich sowieso in Berlin gelassen). Ich hätte auf einer imaginären Posaune, hörbar nur für mich, die stärksten, die frechsten Töne geblasen, schräg, schneidend, schlaazend wie im Free Jazz: Zungenstöße wie Rammstöße gegen die Steine, Phrasen wie Zündschnüre, die Takte wie Sprengsätze. Ich hätte mich einmal richtig ausgespielt, einmal unter der Wüstensonne die Flatterzunge toben lassen, hätte gesungen, geschmatzt, geplaudert, gehupt, alles gegeben im fruchtbaren Jordantal – diese Oase soll ja das Paradies gewesen sein. Vielleicht hätte ich so lange gespielt, bis mich die Kollegen in den Bus gezerrt hätten, «Pass auf, Hannes, steh nicht so lange in der Sonne!»
Die Wüste, ich wollte viel Wüste sehen, Steinlandschaften, Schluchten, Geröll, karge Erde, Fleischfarben zwischen Gelb und Rot und Ocker und Weiß und Gelbgrau mit den Tageszeiten changierend, all das einsaugen mit der Stille dazu. In den Bergen östlich von Jericho starb Moses, in den Bergen westlich hat Jesus vierzig Tage seinen großen Auftritt vorbereitet. Und ich in der Mitte, ein Posaunist in Jericho, im Brutkasten der Welt.
Ja, der Größenwahn. (Aber so laufen die Gedanken, wenn sie mal laufen: geradeaus.) Ja, ein Idiot mehr, 250 Meter unterm Meeresspiegel. Überall in dieser Gegend hausten Spinner, Propheten, Mönche, Einsiedler und ließen sich von den Steinen, der Sonne und der Stille peinigen, lauter Solisten, da wäre ich mit meiner unsichtbaren Posaune gar nicht aufgefallen.
Nach dem Solo vor den Mauern von Jericho die Stille. Stille, aus der die Musik lebt. Stille, die in Berlin nie wieder zu hören sein wird, weit weg von allem Kampfgeschrei, weit weg von dem Rieseln der schlappen Töne aus den Lautsprechern überall. Die Wüste lügt nicht, die Wüste belügt einen nicht, hier hätte die Musik wieder ganz von vorne anfangen können, hier hätte ich, hier könnte ich – und so weiter die Zukunftsmusik, so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt.
Die beiden ersten Abende «Liebestrank» waren absolviert, ich hatte schon die 40 Dollar bezahlt und war sogar bereit, früh um 6 Uhr aufzustehen. Dann mein großer Coup, über den wir hier verhandeln. Die Oper schickt mich nach Hause, damit ich nicht noch mehr Schaden anrichte, damit alles nach entschlossenem Handeln aussieht und einer die Rolle des Bösewichts hat und nicht weiter stört bei der Versöhnung. Hätten sie mich lieber in die Wüste geschickt!
Die 40 Dollar für den Jericho-Trip hab ich bis heute nicht zurückbekommen. Lese jetzt Reiseführer und Merian-Hefte, um zu wissen, was ich alles versäumt habe. Können Sie ermessen, Herr Richter, was dieser Ausfall für mich bedeutet?
Nein. Ist auch egal. Ich rechne nicht mehr damit, verstanden zu werden. Einmal Verbrecher, immer Verbrecher, selbst wenn man nur einen harmlosen Kellner attackiert hat. Nicht mal attackiert, irritiert. Das reicht! Wer das getan hat, was ich getan habe, wird sowieso missverstanden. Jede menschliche Regung – da sieht man, wie heimtückisch diese Bestie ist. Jeder kleine Wunsch – da haben wir den Größenwahnsinnigen. Jede Nuance eines Satzes, die als böse gedeutet werden kann – schon wieder ein Beweis für seine niedrige Gesinnung. Ich kann sagen, was ich will, es wird mir nicht helfen. Also kann ich alles sagen. Böse bin ich sowieso.
Eine Gegendarstellung, trotzdem. Weil die Gerüchte aus dem Orchester nicht verstummen.