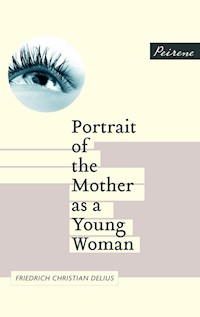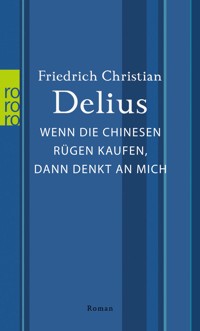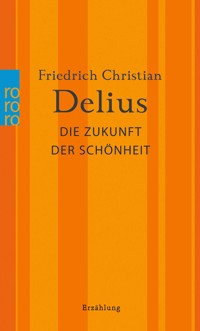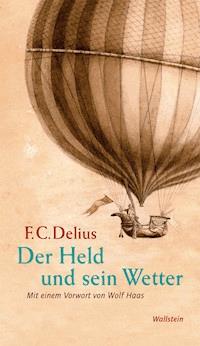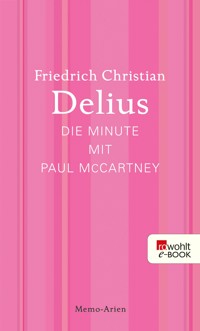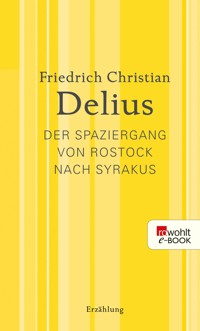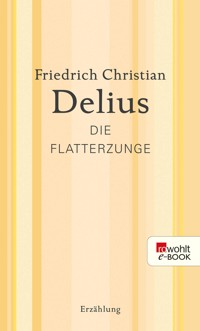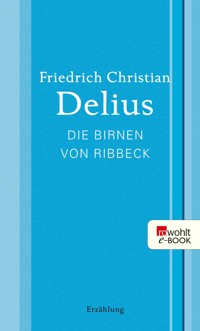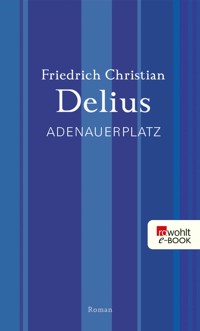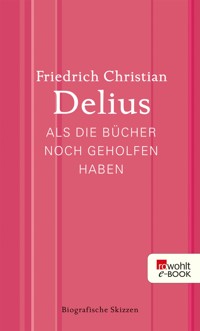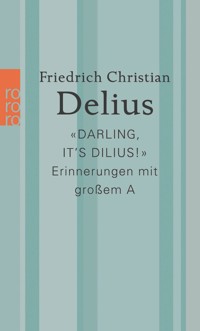
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Büchner-Preisträger Friedrich Christian Delius, verstorben im vergangenen Frühjahr, wäre im Februar 2023 achtzig Jahre alt geworden. Bis zuletzt schrieb er und näherte sich seinem Leben in einer Autobiographie, wie man sie noch nicht kennt: in gut dreihundert Stichworten, die mit A beginnen, spielerisch, gedankenscharf und poetisch. Von «Abbey Road» und «Abendrot» über «Adorf» und «Adorno», «Akte» der Stasi und «Aktien» von Siemens, acht «Altkanzler», «Abstand», «Anstand», «Aufstand» bis zu «Arroganz» und «Azzurro» schildert Delius in konzentrierten Texten, was ihm aus all den bewegten und begegnungsreichen Jahrzehnten wirklich wichtig ist. Einprägsame Porträts von Zeitgenossen und Künstlern wechseln sich ab mit Erlebnissen mit Politikern wie Willy Brandt oder Gegnern wie Hermann Josef Abs; lang gereifte Gedanken über Musik und Literatur finden sich ebenso wie flirrende Beobachtungen aus Berlin, New York oder Rom, der Geburts- und Lebensstadt, in die F. C. Delius immer wieder zurückkehrte; dazwischen traumschöne Erinnerungen an die Jugend, an Landschaften, an ein erstes kindliches Verliebtsein. Eine ganz besondere, persönliche Chronik, die nicht nur acht Jahrzehnte deutscher Geistes- und Gesellschaftsgeschichte festhält, sondern stets aufs Größere zielt – auf das Leben. Hier blickt man durch die Augen eines bedeutenden Autors auf die Welt; hier wird das Erinnern selbst zur Kunst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Friedrich Christian Delius
«Darling, it’s Dilius!»
Erinnerungen mit großem A
Über dieses Buch
Der Büchner-Preisträger Friedrich Christian Delius, verstorben im vergangenen Frühjahr, wäre im Februar 2023 achtzig Jahre alt geworden. Bis zuletzt schrieb er und näherte sich seinem Leben in einer Autobiographie, wie man sie noch nicht kennt: in gut dreihundert Stichworten, die mit A beginnen, spielerisch, gedankenscharf und poetisch. Von «Abbey Road» und «Abendrot» über «Adorf» und «Adorno», «Akte» der Stasi und «Aktien» von Siemens, acht «Altkanzler», «Abstand», «Anstand», «Aufstand» bis zu «Arroganz» und «Azzurro» schildert Delius in konzentrierten Texten, was ihm aus all den bewegten und begegnungsreichen Jahrzehnten wirklich wichtig ist. Einprägsame Porträts von Zeitgenossen und Künstlern wechseln sich ab mit Erlebnissen mit Politikern wie Willy Brandt oder Gegnern wie Hermann Josef Abs; lang gereifte Gedanken über Musik und Literatur finden sich ebenso wie flirrende Beobachtungen aus Berlin, New York oder Rom, der Geburts- und Lebensstadt, in die F. C. Delius immer wieder zurückkehrte; dazwischen traumschöne Erinnerungen an die Jugend, an Landschaften, an ein erstes kindliches Verliebtsein.
Eine ganz besondere, persönliche Chronik, die nicht nur acht Jahrzehnte deutscher Geistes- und Gesellschaftsgeschichte festhält, sondern stets aufs Größere zielt – auf das Leben. Hier blickt man durch die Augen eines bedeutenden Autors auf die Welt; hier wird das Erinnern selbst zur Kunst.
Vita
Friedrich Christian Delius, geboren 1943 in Rom, gestorben 2022 in Berlin, wuchs in Hessen auf und lebte seit 1963 in Berlin. Zuletzt erschienen der Roman «Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich» (2019) und der Erzählungsband «Die sieben Sprachen des Schweigens» (2021). Delius wurde unter anderem mit dem Fontane-Preis, dem Joseph-Breitbach-Preis und dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Seine Werkausgabe im Rowohlt Taschenbuch Verlag umfasst derzeit zweiundzwanzig Bände.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Foto des Autors im Anhang: Reinhard Hummel
Covergestaltung any.way, Walter Hellmann
ISBN 978-3-644-01458-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Ulla, Mara, Charlotte und Eberhard
«Keiner entwirft einen bestimmten Lebensplan; wir legen ihn uns stückchenweise zurecht. (…) Wir bestehen alle aus Stücken; und diese sind so uneinheitlich zusammengefügt, dass jeder einzelne Bestandteil, zu jeder Zeit wieder anders, seine Rolle für sich spielt.»
Montaigne (nach Claude Simon, Jardin des Plantes)
«Leben! Leben! Leben!, ruft der Vogel, als hätte er uns gehört und als wüsste er genau, was uns umtreibt bei unserer lästigen naseweisen Gewohnheit, drinnen und draußen Fragen zu stellen und umherzuschauen.»
Virginia Woolf, Orlando
«Und es genügt auch nicht, dass man Erinnerungen hat. Man muss sie vergessen können, wenn es viele sind, und man muss die große Geduld haben, zu warten, dass sie wiederkommen. Denn die Erinnerungen selbst sind es noch nicht.»
Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge
Am Anfang aller Autobiographien
Fast alle Autobiographien kranken an ihrer inneren Zielgewissheit, selbst wenn sie Umwege, Abgründe, Irrtümer fleißig benennen. Die Vorstellung, dass sich ein Leben rundet, dass mehr oder weniger rote Fäden die Strecke langer Jahre markieren, dass sich Kreise schließen, Nebenpfade und Abstürze als segensreich erweisen, ist zu naheliegend, um die Selbstbiographen nicht zu verführen, ihrem Leben möglichst viel Sinn, Plausibilität, Allgemeinbedeutung und Zielwasser zuzuschreiben. Auch deshalb verfassen fast nur die erfolgreichen oder sich für erfolgreich haltenden Menschen ihre Erinnerungen. Dabei können, ausnahmsweise, sogar hervorragende Bücher entstehen.
Aber zu diesem Genre gehören Begradigungen, Vereinfachungen, Beschönigungen, Selbstüberschätzungen – genau das Gegenteil dessen, was Aufgabe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist. Das ist für László Földényi «das große Paradox des Genres: Die Biographie stellt etwas als fassbar dar, was unfassbar ist, als selbstverständlich, was alles andere als das ist.» Deshalb scheuen die meisten Autoren das Memoirenschreiben völlig zu Recht.
Wer viel schreibt, wäre töricht, das ganze eigene Leben in einem Buch darstellen zu wollen. Wer schreibt, weiß auch, dass kein menschliches Leben – wer hat das gesagt? – plausibel ist. Es verläuft nicht linear, die Linien sind krumm. Erinnerungen, rückwärts gedacht, können schnell nostalgisch werden – nach vorn gedacht aber produktiv sein. Das eigene Leben kann viel, fast jede Menge Material hergeben, für eine Autobiographie wäre es verschwendet. Schriftsteller haben bessere literarische Mittel, mit biographischem Material umzugehen. Sie verstehen es, aus wenigen Details ganze Romane zu zaubern, als Erzähler einzelne Episoden oder Erinnerungen aus dem Gedächtnis zu holen, sie können diese anderen Personen zuschreiben, anders gewichten, mit Phantasie anreichern und sie so intensiv darstellen, wie es in Lebensschilderungen nicht möglich ist. Sie können Erinnerungspartikel so formen und in sprachliche Kunstwerke verwandeln, dass das Autobiographische nicht mehr im Vordergrund steht. Auch ich habe das versucht, unter anderem in Büchern wie «Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde», «Amerikahaus» oder «Die Zukunft der Schönheit».
Was mich jetzt reizt, die berechtigten Einwände gegen Autobiographien zu ignorieren und eine kleine, vergleichsweise neuartige Variante dieser Form anzufassen, entspricht einem ganz anderen formalen, spielerischen Ansatz: ein Selbstporträt aus Collagen. In fast achtzig Lebensjahren, davon sechzig in den mittleren und äußeren Kreisen des literarischen Betriebs, haben mich so viele Ereignisse und Begegnungen geprägt, so viele politische Veränderungen von den freundlichen Besatzern der USA, dem 17. Juni 1953 und Mauerbau bis zum Trump-Zeitalter und Ukrainekrieg, so viele literarische Entwicklungen von der Gruppe 47 bis zur Youtube-Lesung, so einige Lieb- und Freundschaften, ein paar haltbare Gedanken und Überzeugungen, dass hier eine Fülle von Beobachtungen, Erlebnissen, Analysen, Anstößen, Irrtümern, Anekdoten, Porträts aus dem Fundus der Vergangenheit geholt werden könnte. Diese sollen jedoch nicht in einen gefälligen Lebenslauf münden, sondern Bruchstücke bleiben. Statt der Fülle möchte ich lieber Fragmente liefern – und es schadet nicht, dabei an Goethe zu denken: «Literatur ist das Fragment der Fragmente; das Wenigste dessen, was geschah und gesprochen worden, ward geschrieben, vom Geschriebenen ist das Wenigste übrig geblieben.»
Bei der Entwicklung dieses Projekts hat mich jedoch nicht Goethe angestiftet, sondern Georges Perec mit seinem Roman «Das Leben. Gebrauchsanweisung»: die Bewohner eines Pariser Hauses in ihren Räumen, das Netz ihrer Beziehungen und Nicht-Beziehungen über die Zeiten, in tausend Fragmenten. Auch Fragmente brauchen eine Ordnung, Perec wählte für sein großes Puzzle mathematische Muster. Für mein viel simpleres Projekt wäre eine chronologische Ordnung möglich, eine thematische, eine fraktale, eine verzwirbelt algorithmische oder eine primitive alphabetische Ordnung. Ich ziehe die letztere vor, weil sie angenehm neutral und wunderbar zufällig ist.
Aber auch diese spezielle Autobiographie soll ein Fragment bleiben. Denn den ganzen maximalen Lebensstoff von A bis Z auszubreiten – so viel Wahnsinn plus Größenwahnsinn kann ich nicht bieten (abgesehen von der Lebenszeit, die mir dafür nicht zur Verfügung stehen wird). Da scheint es mir klüger zu sagen: A reicht doch! Ein Buch mit den Stichworten nur in A. Ein geordneter Haufen Fragmente mit A zeigt auch, dass das längst nicht alles ist, was der Autor mitzuteilen hätte. Dies Buch hat also viel mehr Lücken als Seiten. Das Leben besteht noch aus vielen Geschichten und Einzelheiten, die unter E oder L, M oder S zu finden wären. Es könnte theoretisch fünfundzwanzig weitere Bücher dieser Art geben, von B bis Z – die der lesenden Menschheit, ich schwöre es, erspart bleiben werden.
Natürlich ist es bedauerlich, so viele für mich wichtige Menschen, Begegnungen, Entscheidungen, Horizonterweiterungen nicht würdigen zu können, nur weil sie nicht das A-Privileg haben. Auch für mich ist dieser Verzicht schmerzlich. Aber das muss sein – auch weil der Gedanke an Vollständigkeit grauenhaft unliterarisch ist.
Hier also der Zufallsgenerator des Anfangsbuchstabens A für eine «Selberlebensbeschreibung» (Jean Paul), die aus Hunderten von Fragmenten ein Mosaik zusammenfügt. Mit dem Mut zur Lücke oder vielmehr zu vielen Lücken wird versucht, den Ernst einer Autobiographie und die Fragen nach ihren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten heiter zu unterlaufen. Selbstgefälligkeit, Icherei, Angeberei, Namedropping, Beschönigungen sind natürlich auch hier nicht zu vermeiden. Dafür bitte ich um Nahsicht und Nachsicht. Durchweg gilt die Parole: Nimm dich nicht so wichtig, Junge! – auch dann, wenn ich sie mal nicht zu befolgen scheine.
F.C. D., Mai 2022
Erinnerungen mit großem A
A
Blutgruppe A, Rhesus-positiv.
A4-Papier
Hunderttausend Blatt besten DIN-A4-Papiers, achtzig Gramm, weiß, die große Palette einer Papierfabrik stand 1987 eines Tages vor der Haustür. Ein Geschenk, das Honorar für ein paar Zeilen zum Thema Papier. Leonie Ossowski, die Schriftstellerin, mit der ich von 1986 bis 2003 im Kuratorium des Literaturhauses Berlin arbeitete, hatte mich gefragt, ob ich nicht einen kleinen Text für den Kalender einer Papierfabrik schreiben wolle, sie dürfe vier oder fünf Autoren aussuchen, das Honorar bestehe aus hunderttausend Blatt Papier. Viel zu viel, dachte ich, als ich die Palette sah. Das reicht fürs Leben, eine irritierende Vorstellung. Mit Mühe passten die zwanzig schweren Kartons mit je zehn Packen à fünfhundert Blatt in den Keller. Anfangs verschenkte ich einige Packen an Freunde und die nähere und weitere Familie, aber achtzig Prozent etwa verbrauchte ich selbst, vorwiegend als Druckerpapier. Es folgten die Jahre der drei Erzählungen «Die Birnen von Ribbeck», «Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde» und «Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus», in denen ich viel ausdruckte. Dann Umzüge, nach Rom zum Beispiel musste man kein Papier tragen. So waren erst 2018 die letzten Blätter dran. Selbst wenn ich jetzt zum Dank den Namen der spendablen Firma hier nennen wollte, ich könnte es nicht, weil ich ihn tatsächlich vergessen habe, offenbar im lang anhaltenden Schlaraffenlandgefühl, einen unerschöpflichen Vorrat an Schreibpapier auf den Tisch fliegen lassen zu können.
Aare
Als schlechter Schwimmer bewundere ich meinen Freund aus Bern, den Dichter Jürgen Theobaldy, auch dafür, dass er, ein Jahr jünger als ich, noch heute sommers fast täglich in der wilden und seiner Ansicht nach gar nicht wilden Aare schwimmt. Oder sich treiben lässt mit der Strömung, er, der beim Schreiben stets jede Strömung mied. Mit keinem Freund korrespondierte ich so ausdauernd, so viel, so lange, so offen, auch mit offener gegenseitiger Kritik. Unser Briefwechsel über mittlerweile sechs Jahrzehnte könnte zwei Biographien ergänzen, fast ersetzen. Die Idee, irgendwann einmal die ganzen Briefe und Mails drucken zu lassen, finde ich keinesfalls abwegig. Man könnte dann auch meine Würdigung seines Schwimmens in der Aare besser verstehen. Gedruckt, in der SZ, 13. Oktober 2018, ist allein eine Postkarte Theobaldys aus London, in der er von seinen Gängen und Gesprächen mit Rolf Dieter Brinkmann berichtet – datiert an Brinkmanns Todestag, 23. April 1975. Kurz nachdem die Karte im Briefkasten war, wurde Brinkmann, vor Theos Augen, von einem Taxi totgefahren, wenige Tage vor Erscheinen von «Westwärts 1 & 2» und vier Jahre vor «Rom, Blicke».
Unser Austausch begann, als ich Theo 1974 von Rowohlt, wo er den viel beachteten Gedichtband «Blaue Flecken» veröffentlichte, zum Rotbuch Verlag abwarb, wo wir dann die Gedichte «Zweiter Klasse» und den Roman «Sonntags Kino» herausbrachten. 1978 zog ich in die Niederlande, und kurz vor meiner Rückkehr nach Berlin 1984 zog er in die Schweiz – beste Voraussetzungen für einen intensiven Briefwechsel.
Theobaldy hat «auch deshalb zu schreiben begonnen, weil er nie und nirgends im Mittelpunkt stehen wollte, schon gar nicht dort, wo ihn die Unzulänglichkeit, ja Vergeblichkeit des eigenen Schreibens, das immer auch ein Zustand ist, vielleicht mehr quälte als dieser Zustand selber». Bis heute lese und liebe ich seine Gedichte, die in immer kleineren Verlagen in immer kleineren Auflagen erscheinen. Zum Beispiel die Zeilen über die Aare: «Der Himmel ist undurchschaubar, / obwohl sein Blau meinem Blick nichts verwehrt. / Und der Fluss strömt fort und fort / in seinem unersinnbaren Grün. / Werden die Schleusen geöffnet, / wird die Aare wieder kalt sein wie im Mai, / als noch einmal Schmelzwasser von den Bergen kam. // Wenn wir lange genug still sind, / beginnen wir zu spüren, / dass die Stille unsere Gedanken wärmt.» (Der Kopf im Nacken)
Aasgeier
Als es in den USA um die Abschaffung der Sklaverei ging, im Bürgerkrieg, den die Nordstaaten mit viel Glück gewannen, kamen auf dem Schlachtfeld von Gettysburg, wo im Juli 1863 fünfzigtausend Soldaten starben, Aasgeier aus dem ganzen Land zusammen. Sie lieben diese Gegend bis heute. Ebenso wir Touristen im Jahr 2000. Wir – die amerikanischen Freunde und ich – bildeten uns ein, diese Geier zu verstehen. So viel unterscheidet uns nun auch nicht von ihnen.
Abbacchio Al Forno
Da wird der Halbrömer zum Römer: Lammkeule auf Kartoffelbett, Rosmarin, basta, die römische Art.
Abbado, Claudio
In gehobener Gesellschaft dankt der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker für eine Ehrung und preist Berlin: Es gebe keinen anderen Ort auf der Welt mit so viel Neuem, so viel Neugier, so viel Veränderung. Was sonst zur Werbephrase geronnen ist, sagt der Italiener mit solch einer Wärme und Klarheit, dass selbst ich Altberliner, gerade aus Rom gekommen, das weder auf Neues noch auf Veränderung aus ist und keine Neugier kennt, gerührt bin und mich, was selten geschieht, bestätigt fühle in meinem kleinen Lokalpatriotenstolz. Vielleicht wirken Abbados Worte auch deshalb so stark, weil der Dirigent die ganze sprachlose Autorität der großen Komponisten hinter sich weiß. Spricht Abbado, sprechen aus seiner Stimme auch Beethoven e tutti quanti.
Abbey Road
Alle pilgerten (später) zur Londoner Abbey Road, in unserer Londoner Zeit in den Sechzigern trafen Freund Rainer Nitsche und ich Paul McCartney lieber im Regent’s Park. Manchmal hätte ich gern den Angeber gespielt, der lässig behauptet: Im Bookshop unseres Freundes Hugo Kensho in High Hampstead, wo 1966 und 1967 außer uns auch die Beatles und die Rolling Stones verkehrten und sich mit Underground-Literatur eindeckten, da sahen wir uns natürlich öfter. Das wäre geschwindelt, obwohl es zwei-, dreimal fast zu einer solchen Begegnung gekommen wäre. Das einzige historische Treffen fand im Regent’s Park statt und ist in der «Minute mit Paul McCartney» in sechsundsechzig Variationen überliefert.
Abderiten
In jungen Jahren diesen ziemlich alten Roman von Christoph Martin Wieland zu lesen, hat durchaus geholfen, mit Provinzialismus, Borniertheit, Schildbürgerei, Bürokratismus der besonderen deutschen Art und anderen politischen Narrheiten in Kleinstädten oder Hauptstädten souveräner und gelassener umzugehen. Und Humor zu trainieren. Hundert Seiten «Der Prozess um des Esels Schatten» – und man begreift etwas so Unbegreifliches wie die Tücken im Justizwesen deutlich besser.
Abend
Pappeln im Kopfstand und Pferde wälzen sich
Eh die Sonne geht zeigt sie in den Weingläsern uns
Da springt die Stille aus dem Gras und bleibt still
Wenn weithin Lastwagen rauschen und Schiffe überholen
Motoren sich bäumen unter chromatischen Wolken
Das steinefressende Gras wird lichter und schwarz
In welche friedliche Ecke sind wir geraten wir
Und keine Spur von Verachtung zwischen uns
Auf diesem Fleck gemieteten Niemandslands nur leichter
Wind und keine Grausamkeit in der näheren Luft
(In Beek bij Nijmegen mit Blick auf die Polderlandschaft geschriebenes Liebesgedicht von 1979, an dem heute vor allem die Wörter Verachtung und Grausamkeit irritieren.)
Abendland
Aufgewachsen in einer Zeit, als Politiker ihr Publikum und sich selbst gern am Begriff vom christlichen Abendland wärmten, habe ich erst spät gelernt, was Gustav Seibt bündig formuliert hat: Das christliche Abendland ist ein Märchen, das christlich-jüdische auch, es gab von 500 bis etwa 1500 nur ein christlich-jüdisch-muslimisches Abendland, ein unendlich vielfältiges Zusammenwirken dieser Kulturen auf allen wissenschaftlichen und philosophischen Gebieten. Warum, so die naive Frage, spricht sich das nicht herum bis zu den Abendland-Schwätzern? Auch diese simple historische Tatsache nicht? Warum nennt heute niemand die angeblichen Verteidiger des «christlichen Abendlandes» in Dresden, im Bundestag und anderswo: Märchenerzähler? Oder weniger höflich: Abendlandleugner!
Abendlied, Deutsches
Ich wüsste gern was sich da abspielt
Ich wüsste gern welche Befehle die Augen
an meinen unerforschten Magen weitergeben
wenn schon wieder Uniformen auftauchen
wenn vor oder hinter und neben uns diese Stimme anlegt:
Stehn bleiben! Ausweise bitte! Fahren Sie mal rechts ran!
Ich wüsste gern warum
dieser sonst so vernünftige Herzmuskel sich so nervös anstellt
wenn wir
die schnellen Hin- und Zurückreisenden mit wenig Gepäck
die verdächtig wenig zu verlieren haben
gestoppt werden an Grenzen und Kreuzungen Brücken
gestoppt unterm Sternbild der Fische
gestoppt am Übergang von einem Betonland ins andere
und in der Hitze festgehalten von verlassenen Zöllnern
gestoppt unter den Buchen an der Autobahn
gestoppt in kitschig grünen Gedanken
mitten in Landschaften die wir gerne durchfahren mit hundertvierzig gestoppt …
Abendrot
Günter Kunert, der Dichter, Kalauerkönig und DDR-Verächter, wünschte sich, vor allem in seiner Ostberliner Zeit, aber auch später in Kaisborstel bei Itzehoe, Ansichtskarten mit Abendrot und Sonnenuntergängen aus aller Welt. Ich reiste nicht oft, Italien, Nordeuropa, mehrfach in die USA, je einmal bis Japan, Mexiko, Südafrika. Rund drei Dutzend Karten mit dem immer ähnlichen Abendrot vor wechselnden Kulissen und der nach alter Weise tönenden roten Sonne sowie Anzüglichkeiten über das Wetter dürften von der Grenzpostzensur geprüft und in Kunerts Briefkästen in Berlin-Treptow und Berlin-Buch und später ungeprüft in Kaisborstel gelandet sein. Sechsundsechzig Jahre angenehme Bekanntschaft, die in Freundschaft überging.
Aber
Keine andere Konjunktion, schätze ich, taucht so oft in meinen Rohtexten und Manuskripten auf und wird so oft gestrichen in den folgenden Fassungen wie der Gegensatz- und Widerspruchsausdruck Aber. Aber es bleiben noch genügend übrig.
Aberglaube
«Nicht minder schädlich ist der sozialdemokratische Automatismus an sich, als Aberglaube an eine Welt, die von selber gut wird.» Aus Ernst Blochs «Prinzip Hoffnung». 1967 notiert. Und ich weiß immer noch nicht, ob der Satz stimmt. Ist es wirklich ein Automatismus oder nicht doch ein Pragmatismus? Ist es wirklich ein Aberglaube, also ein Glaube? Oder nicht doch ein nüchterner menschlicher Tatendrang, die Welt, wo es möglich ist, Schritt für Schritt zu verbessern, oder Verbesserungen zu versuchen, und das nicht nur für sich selbst? Obwohl mir die fatale Gleichgültigkeit etlicher SPD-Leute gegenüber Dissidenten und erzdemokratischen Rebellen verhasst ist, bin ich wahrscheinlich doch zu sozialdemokratisch, um diese Fragen eindeutig zu beantworten. – Dazu der Gedanke von Daniel Cohn-Bendit, 1994: «Den Rechten ist das Leid der Welt gleichgültig. Sie sind Egoisten. Den Linken ist dies Leid nicht gleichgültig.» Die Frage, ob auch die Linken Egoisten sind, ließ Cohn-Bendit offen. Ich würde hinzufügen: Die liberalen Linken, die meisten Sozialdemokraten eingeschlossen, sind in aller Regel die kleineren und weniger gemeingefährlichen Egoisten.
Abfalltonne
Der Tag der Befreiung 2022 (> ALLERLÄNGSTER MITTAGSSCHLAF) sei auch der Tag des Strohhutwechsels. Der alte aus Ecuador, Geschenk von Peter Groscurth, Montreux, kann in Ehren in der Abfalltonne landen. Der neue Borsalino, zur Hochzeit 2003 in Rom gekauft, also vor neunzehn Jahren, soll jetzt auf dem Kopf bis zur Zerschlissenheit das Gehirn ein wenig vor der Sonne schützen. Schiene viel Sonne aufs Grab, nähme ich ihn gern als Beigabe mit.
Abholen
«Wenn sie mich abholen», sagte Stephan Hermlin im August 1968 in seinem VW Karmann-Ghia zu meinem Bruder Eberhard, «ich hab noch ein Gewehr zu Hause, davon werde ich Gebrauch machen.» Er meinte mit «sie» die Russen, die ihn 1945 befreit hatten.
Abhörtürme
Die Abhörtürme auf dem Berliner Teufelsberg, ich hatte sie vom Schreibtisch aus 1984 bis 1995 im Blick und habe oft in ihre Richtung gesprochen: Ihr hört die Sowjets ab, die DDR, okay, ihr hört auch mich ab, das ist nicht okay. Aber ich durchschaue euch! Seit 2005 geht der Blick wieder zu ihnen. Jetzt sind sie abgewrackt und zu traurigen Filmkulissen geworden, und ich verkneife mir Triumphgefühle. Die Geschichte hat zugeschlagen.
Abish, Cecile und Walter
«Darling, it’s Dilius!», hörte ich Cecile Abish in den Raum rufen, laut und fröhlich. Ich wartete am Telefon in New York, um mit Walter Abish und seiner Frau einen Besuch zu verabreden, beide hatten mich in Berlin ermuntert, bei der nächsten Reise in die USA bei ihnen aufzutauchen. Nun lauschte ich der Melodie dieser Silben hinterher, dem Wohlklang des ungewöhnlichen, nur beim Komponisten Frederick Delius gewohnten I am Anfang meines Namens, dem heiteren, rhythmischen Stabreim: Darling, it’s Dilius! Fast alle Amerikaner und Briten sprachen meinen Nachnamen so aus, aber so fröhlich und melodisch wie von Ceciles starker Stimme hatte ich ihn noch nicht gehört. Der Ausruf genügte, mich willkommen zu fühlen nicht nur bei den Abishs, auch in New York im April 1992.
Mit Walter Abish, in Wien geborener Emigrant, der wegen seiner Bücher «Alphabetical Africa» und «How German Is It» als sprachwitziger, experimenteller Autor galt, hatte ich mich in Berlin, als er 1987 Gast des DAAD-Künstlerprogramms war, ein wenig angefreundet. Mit der schwarzen Klappe über dem linken Auge war er überall aufgefallen, der liebenswürdigste Pirat, der mir begegnet ist. Worüber wir dann einige Tage später sprachen, weiß ich nicht mehr. Vielleicht verdanke ich neben Georges Perecs «Leben» auch Abishs «Alphabetical Africa» die Anregung, Autobiographisches in alphabetische Pseudoordnung zu bringen und damit der Falle der Vereinfachungen, Begradigungen und Beschönigungen zu entkommen. Er war radikaler: Das erste Kapitel in «Alphabetical Africa» enthält nur Wörter, die mit A beginnen, das zweite nimmt B-Wörter hinzu, das dritte C-Wörter und so weiter bis Z – und rückwärts, bis am Ende wieder ein Kapitel nur aus A-Wörtern steht. Wie auch immer, Ceciles drei Worte bleiben bis heute im Ohr: «Darling, it’s Dilius!»
Abitur
1963 an der > ALTEN LANDESSCHULE in Korbach. Im altsprachlichen Zweig waren wir nur zu elft in der Klasse und blamierten uns trotzdem mit schlechten Noten. Aber darauf kam es damals nicht an, der schlechte «Schnitt» zählte nicht, man konnte damit fast alles studieren. Griechisch mangelhaft, Latein ausreichend, Mathematik ausreichend, Physik ausreichend und so weiter, Sozialkunde befriedigend, in Religion hatte ich ein Gut erreicht und in Deutsch ein Sehr Gut. Ich wollte nur das Zeugnis und ab nach Berlin. Dann die üblichen, damals trotz Alkohol ziemlich braven Abiturfeiern, überraschend war, dass eine Mitschülerin aus der Parallelklasse, die ich nie beachtet hatte, mich mit Küssen überfiel und sich danach nie wieder blicken ließ. Sie wurde später eine der bekanntesten Galeristinnen in Düsseldorf. Sie hätte keine Chance gehabt, meine Liebe galt längst einer Gedichte und Briefe schreibenden Schülerin in Mülheim an der Ruhr. Die sogar zum Abiturball nach Korbach kommen durfte, in Begleitung ihrer Mutter. Eine andere Geschichte, so schön wie traurig, aber ohne großes A.
Abraham-Isaak
«Ich war Isaak», beginnt eine Passage in der Erzählung «Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde», in der die Frage aufkommt, ob der eigene Vater auch eine Art Abraham ist, der beweisen muss, Gott mehr zu lieben als den Sohn, und bereit sein muss, diesen zu opfern. Eine Frage, viel zu unerhört und unaussprechlich für einen Elfjährigen, der sie zwar nicht wörtlich nimmt, aber als drohende Metapher mit sich schleppt. Eine Frage, die erst der Fünfzigjährige in einer Erzählung zur Sprache bringen kann. Und dank glücklicher Mithilfe israelischer Autoren als Sechzigjähriger vorläufig und als Siebenundsiebzigjähriger endgültig in «Die Jerusalemer Krawatte» beantwortet und bilanziert:
«Später, im Bett, blieb ich lange wach und versuchte zu erfassen, was da geschehen war: die Urszene der großen Religionen, die ebenso brutale wie fromme Legende, die hier ihren Ort der Handlung hatte, den archaischen Mythos oder, deutlicher gesagt, die dramatischste aller Vater-Sohn-Geschichten, die hier, ein paar Steinwürfe von meinem noblen Apartment entfernt, vor dreitausend Jahren entstanden sein soll und hier lokalisiert wurde –
Die Legende eines Mordes, der, in letzter Sekunde verhindert, gar nicht stattgefunden hat und gerade darum so wirkmächtig war, von Juden, Christen und Muslimen in den Mittelpunkt ihrer Theologien gestellt, mit allen möglichen Dogmen und Deutungen des Gehorsams befeuert, in endlosen theologischen Scharaden des Glaubens, Befehlens und Gehorchens durchgespielt und weitergegeben worden war, dreitausend Jahre lang –
Die durch so viele Köpfe, durch so viele Vorlesungssäle und Hallen, Synagogen, Kirchen, Moscheen, durch so viele heilige Schriften, Bücher und Breviere gewandert war bis in den Kopf meines Vaters, der sie an mich weitergegeben, in mich eingepflanzt hatte –
Diese zum Klischee erstarrte Geschichte, die ich nicht nur im Kopf hatte, die im Körper, im Blut kreiste, die durch mich, durch meine Phantasien, meine Hände und meinen Computer gegangen war und die ich auf meine naive Weise umgedeutet hatte –
Diese Geschichte, an der sich Maler bis hin zu Rembrandt und Caravaggio versucht hatten, diese Geschichte, die allen gehörte und von vielen vereinnahmt und ausgedeutet war, hatte ich auf meine Weise aufs Papier gebracht und zurückgetragen an den vermuteten Ort ihrer Entstehung und hier wirken lassen dank Chaims stimmstarker Hilfe –
Und die Menschen hier, ja, so pathetisch dachte ich, ausgerechnet die jüdischen Zuhörer, die rund um den Tempelberg lebten, denen Abraham und Isaak unendlich mehr bedeuten mussten als mir, ausgerechnet sie hatten sie mir abgenommen mit ihrem Beifall und hatten mir zu verstehen gegeben: die Gefahr ist vorbei, du brauchst keine Angst mehr vor deinem Vater zu haben, dein Bild von ihm stimmt nicht mehr, du musst ihn nicht mehr zum Bösen stilisieren, du bist gerettet, die Kindheit ist endgültig vorbei –»
Abraham, Paul
Roman, ungeschrieben: Beim schmissigen, wuchtigen, witzigen «Ball im Savoy» von Paul Abraham in der Komischen Oper bleiben in all dem Operettenspaß zwei Dinge im Kopf. Wenige Wochen nach der Uraufführung Ende Dezember 1932 im Großen Schauspielhaus in Berlin kamen die Nazi-Barbaren und machten sofort Schluss mit solchen Späßen, setzten die Operette ab und vertrieben auch Abraham. Sein Exil in den USA verläuft glücklos, 1946 steht er auf der Madison Avenue in New York und dirigiert den Verkehr, als wären Autos, Fußgänger sein Orchester. Die Polizei holt ihn ab, bringt ihn in eine Anstalt, in der er über Jahre weiter verkümmert. Der Roman müsste die Stunde oder halbe Stunde erfassen, die der Dirigent auf der Madison Avenue steht und die Autos dirigiert, Innenperspektive und Außenperspektive in schnellen Schnitten – bis die Polizei kommt.
Abramczyk, Leo
Einer der sogenannten Stolpersteine vor unserem Haus erinnert an Leo Abramczyk, ermordet 1942 in Łódź. Bei der Recherche zu unserem einstigen Hausbewohner kommt heraus, dass es nach seiner Deportation eine längere Korrespondenz gab über knapp sechs Reichsmark, die Abramczyk der Gasag noch schuldete. Der Nachbar, der die Akten studierte, hat nicht nachgezählt, wie viel Porto die Gasag ausgab, um diese sechs Mark von den SS-Behörden in Berlin und Polen einzutreiben. Was am Ende nicht gelang.
Abreisskalender
Agit-Prop, das war die klassische Abkürzung für marxistische Agitation und Propaganda für Künstler, die, mehr oder weniger im Auftrag, direkt und plakativ, also «verständlich» für die gute Sache oder gegen die Klassenfeinde dichteten, zeichneten, musizierten. Um 1968 wurde das nicht selten von mir erwartet, ich habe das fast immer abgelehnt. Oft mit dem herrlich selbstbewussten Satz von Walter Benjamin: «Ein Autor, der die Schriftsteller nichts lehrt, lehrt niemanden.»
Einmal jedoch war ich mit Eifer dabei, es war eine Idee, die 1967 entweder aus der studentischen Kampagne «Enteignet Springer» oder vom Künstler Arwed Gorella kam, der eine Axel-Springer-Popanz-Figur-Collage gefertigt hatte (> AXEL). Nun suchte man einen Texter dafür, ich fand mich bereit. Es wurde ein «Springer-Abreißkalender 1968». Auf einem Kartonblatt das Collagenbild, quer darüber zwölf Streifen perforiert zum späteren Abreißen, unten der markige Vierzeiler «Hier steht Springer, seht ihn an: / Kopf bis Fuß, ein ganzer Mann. / Steht sehr frech und sehr bequem, / Denn er steht auf dem System.» Auf einem zweiten Blatt dahinter war für jeden Monat ein Vierzeiler zu lesen. Bei jedem Monatsbeginn war ein Streifen abzutrennen, der einen neuen Doppelreim zum Lesen freigab, unten beginnend mit Januar und Februar, beispielsweise so: «In dem Monat Februar / Zittert unser Zeitungs-Zar, / Friern ihm beide Waden an, / Daß er nicht mehr stehen kann.» Oder August: «Schnallt ihm das Verdienstkreuz ab! / Atmen muß er, Luft wird knapp. / Welches BILD macht sich die WELT, / Wenn er ganz zusammenfällt?» – bis der Popanz am Ende des Jahres fast vollständig abgerissen und der Dezember zu lesen war: «Wenn das alte Jahr vorbei, / Ist der Springer sorgenfrei. / Fast enteignet, sehr geschockt, / Hat sich’s selber eingebrockt.»
Der Kalender wurde zugunsten der Kampagne verkauft, fünfhundert oder tausend Stück, es war kein Renner. Meine Ironie, gegen den Sofortismus der Studentenbewegung die Fast-Enteignung erst für Dezember zu erhoffen, verpuffte völlig. 1968 kam allmählich die neue Ideologie spektakulärer Gewalt auf. Schon im Februar brachte der Filmstudent Holger Meins, später RAF-Mitglied, mit einem fünf Minuten langen Bombenbastler-Filmchen die ganze Anti-Springer-Kampagne zu Fall, prominente Unterstützer sprangen ab, der Elan verpuffte. RAF rettet Springer, hätte «Bild» titeln können. Wer hat sich’s da «selber eingebrockt»?
Abriss
Nicht die Barbaren, die Römer waren die Ersten, die Rom abgerissen haben. Lange vor den fremden Völkern des Nordens, den Päpsten, den Erosionen der Jahrhunderte. Seit Cäsar wurden nach und nach alle Bauten aus republikanischer Zeit abgerissen. Die Ruinen und Reste, die wir heute sehen, vom Forum angefangen, stammen aus den Kaiser-Zeiten seit Augustus und seinen Nachfolgern, Prunk- und Protzbauten. Die bescheidenere Architektur der republikanischen Zeit, das bessere alte Rom findet man nur noch im Verborgenen, zum Beispiel auf der Tiberinsel, unter dem Krankenhaus mit dem schönen Namen Fatebenefratelli, im Keller die Fundamente eines Jupitertempels. Römer gegen Römer, ohne die innerrömischen Kämpfe bis heute versteht man Rom schlecht.
Abs, Hermann Josef
Hermann Josef Abs, lange Chef der Deutschen Bank, 1966 Mitglied in dreiunddreißig Aufsichtsräten großer Firmen, fand im Jahr 1972, nur noch mit sechzehn Aufsichtsratsposten ausgestattet, die Zeit, gegen mich zu klagen – und er hatte nicht unrecht damit. In der satirischen Festschrift «Unsere Siemens-Welt» hatte ich im Kapitel «Unsere Führungskräfte» auch die Verdienste des Siemens-Aufsichtsrats Abs auf einer Seite gewürdigt. Wichtige Quelle war das Buch «Der Bankier und die Macht» von Eberhard Czichon, der Abs’ Rolle in der Nazizeit ausführlich recherchiert und dargestellt, in mehreren Punkten aber schlampig gearbeitet oder falsche Schlüsse gezogen hatte. Gegen solche falschen Tatsachenbehauptungen hatten Abs und die Deutsche Bank kurz vor dem Erscheinen meines Buches erfolgreich geklagt. Als Siemens und Abs im Herbst 1972 eine einstweilige Verfügung gegen «Unsere Siemens-Welt» beantragten, haben wir zwei kurze Zitate über Abs, die ich von Czichon übernommen hatte und die sich als nicht korrekt erwiesen hatten, geschwärzt beziehungsweise umformuliert. Damit war der juristischen Wahrheit Ehre getan. Nun waren wir Abs und die Bank los. Der fünfjährige Kampf des Siemens-Konzerns gegen Buch, Verlag und Autor war aufreibend genug, aber das ist eine andere Geschichte. Weil Czichon so schlecht gearbeitet und seinen Prozess schmählich verloren hatte, blieb der Großteil der nicht beanstandeten Fakten über die enge Kooperation von Abs und seiner Bank mit den Nationalsozialisten und ihrer Wirtschaftspolitik viel zu lange unbeachtet, ja tabuisiert, bis heute hat sich da wenig gebessert.
Anfang 1977 hatte ich in der «Frankfurter Rundschau» die Gelegenheit zur Revanche mit der Rezension eines Buches von Abs, «Lebensfragen der Wirtschaft». Doch ich ironisierte ihn lieber: «Alle lieben Abs. Unternehmer und Manager (…), Politiker (…), drei Generationen von Bankkaufleuten (…). Und auch die Linke liebt ihren Abs: als Inkarnation des bundesdeutschen Kapitalismus und lebendes Beispiel für die Tradition einer Wirtschaftsform, in der ein Hermann J. Abs die Wirtschaftspolitik Hitlers als auch Adenauers maßgeblich beeinflussen konnte – und das nicht nur als König der Aufsichtsräte.» Dann beschrieb ich die Komik, die lustigen Widersprüche zwischen Sonntagssprache und Alltagspraxis des Managerfürsten Abs. Es war eine kleine, vielleicht zu milde Revanche an einem Mann, der verhindern wollte, dass die «Siemens-Welt» auf den Markt kommt. Und den, nicht zu vergessen, die Amerikaner einst als Kriegsverbrecher anklagen wollten.
Absacker mit Bundespräsident
Einladungen zum sogenannten «Absacker» (schon dies grauenvolle Wort!) nach einem angenehmen Abend schlage ich meistens aus, aber nach einem lockeren, persönlichen Essen mit Johannes und Christina Rau 2004 in einer römischen Trattoria sagten wir nicht Nein. In der Bar des Hotel de Russie wird der Präsident politisch und erregt sich über die deutsche Industrie, den BDI, der in seinem Jahresbericht alles in Deutschland schlechtmacht, Regierung, Verwaltung, Gewerkschaften, die sonstigen Verhältnisse. Im englischen Bericht dagegen, für Investoren geschrieben, werde Deutschland in höchsten Tönen gepriesen, Regierung, Verwaltung, Gewerkschaften, die sonstigen Verhältnisse. Auch «Newsweek» habe gerade wieder verglichen: Nach Produktivität, Steuern, Kosten, Lebensqualität liege Deutschland an zweiter Stelle, nach den USA. Er habe das ans Bundespresseamt weitergegeben mit der Bitte: Macht was draus. Drei Monate habe man nichts getan, dann eine schlappe Erklärung abgelassen. Die Beamten! Rau erzählt immer neue Beispiele für die Absurditäten der deutschen Beamtenwelt. Lange reden wir Deutschen in einer italienischen Luxusbar von der Neigung der Deutschen, sich selbst und ihr Land ständig schlechtzureden.
Absage 1
In acht Jahren als Lektor für Literatur (drei bei Klaus Wagenbach, fünf im Rotbuch Verlag) kamen an jedem Posttag circa drei neue Manuskripte auf den Tisch. Leicht ist auszurechnen, wie viele Absagen und Ablehnungen nötig waren, um nicht unter den Stapeln von Gedichten, Erzählungen und Romanen zu ersticken, meist reichte ein getippter Kurzbrief, mit fertigen Formulierungen. Die wenigen besseren, aber doch nicht oder noch nicht drucktauglichen Texte erforderten längere Lektüren, Überlegungen, Briefe. Die sehr seltenen guten oft schwierige Diskussionen. Ein brutales Geschäft und nicht immer gerecht. Es wäre nicht auszuhalten gewesen, wenn man nicht die meiste Zeit mit den wenigen rundum überzeugenden und dann Stammautoren des Verlags hätte konstruktiv arbeiten können.
Lange Zeit habe ich gefürchtet, dass irgendwann mal jemand mit einem Absagebrief von mir wedelt und mich anklagt: Diese geniale Autorin, diesen tollen Autor, die spätere Büchnerpreisträgerin X hast du übersehen! Bislang hat man mich verschont. Auf der anderen Seite gab es auch vielversprechende, ungewöhnliche Literaten wie den sehr jungen Jörg Fauser, den ich zu uns einlud, dem wir zu links schienen und der uns eine Absage erteilte.
Absage 2
Im Frühjahr 1983, am Anfang der Schreibphase des Romans > ADENAUERPLATZ, wurde ich zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb nach Klagenfurt eingeladen. Ich hatte noch keinen vorzeigbaren Text, es war ein schlechter Zeitpunkt. Ich sagte zu, trotz starker Bedenken gegen die Regeln dieser Show – und kurz vor Beginn wieder ab.
Warum solltest du, fragte sich der abgebrühte Autor, nicht auch unter diesen Vorzeichen versuchen, Geld und Ehre einzuheimsen? So besah ich die Kapitel des Romans, an dem ich seit einiger Zeit arbeitete, und prüfte, was für eine Kurzlesung vor Publikum und Schnellrichtern tauglich wäre. Plötzlich ertappte ich mich bei dem Gedanken: Dies Kapitel ist zwar gut, jenes aber dürfte der Jury besser gefallen, einigen Kritikern wird eher diese Passage zusagen, anderen die andere. Es herrschten in Klagenfurt damals die einstigen Kritikerfürsten der Gruppe 47: Walter Jens, Joachim Kaiser, Marcel Reich-Ranicki und andere. Da hatten sie mich so weit! Da spekulierte ich bereits beim Schreib- und Denkprozess mit Beifall und Einwänden! Die Arbeit an den unfertigen Stellen war mir verdorben. Der Gedanke an Klagenfurt wurde immer unappetitlicher. Und weitergedacht: Da nur ein Dutzend Seiten beurteilt werden und nicht ein ganzes Buch, müsstest du zum Opportunisten gegenüber deinem Produkt werden. Da du, wie alle, nicht nach Klagenfurt fahren würdest, um literarische Kritik zu hören, sondern um den eigenen Marktwert testen zu lassen, würdest du am Ende zum Spekulanten deiner selbst. So ist diese Veranstaltung, so gut sie gemeint sein mag, auch ein Angriff auf das Kapital, über das Schriftsteller verfügen, die Unbestechlichkeit. Folglich: Absage.
Abschied von Willy
«Brandt, es ist aus. Wir machen nicht mehr mit …», so beginnt das Gedicht «Abschied von Willy», im Dezember 1966 zuerst in der «Zeit» publiziert. Die Enttäuschung über den hochgeschätzten, verehrten Brandt und seine SPD, die gerade eine Große Koalition mit der CDU unter dem Ex-Nazi Kiesinger verabredet hatte, war bei mir und einigen anderen Jungautoren besonders groß, weil wir im Wahlkampf 1965 im «Wahlkontor deutscher Schriftsteller» mit Worten und Argumenten eifrig für Willy Brandt, Gustav Heinemann, Karl Schiller, Helmut Schmidt geworben und gegen die CDU polemisiert hatten. Ich war gerade für ein Jahr in das vergleichsweise idyllische London gezogen (> ABBEY ROAD, > ARROGANZ), konnte, als die Große Koalition beschlossen wurde, darüber nur mit Freund Rainer sprechen. Telefonieren war sehr teuer, so fiel mir als Antwort diese Art Rilke-Parodie ein, die teilweise etwas großmäulig geraten ist:
Wer jetzt nicht zweifelt, zweifelt niemals mehr.
Was jetzt versaut ist, wird es lange bleiben.
Von Feigheit, Dummheit lässt sich nichts mehr schreiben.
Kein Witz kommt auf. Verzweiflung nur und Spott, die treiben
Uns zurück, wohin ich gar nicht will,
Verflixt noch mal, ich stecke im Idyll.
Abschlussball
Nach einer Lesung in Reutlingen, 2016, trat eine ältere Dame mit Stock näher, ließ sich «Die Liebesgeschichtenerzählerin» signieren und zeigte mir eine blaue Doppelkarte vom Tanzstunden-Abschlussball der Tanzschule Müller in Korbach vom 10. Januar 1960. Tänze und Tanzpartner waren handschriftlich auf der Karte verzeichnet. Ihr Name kam mir unbekannt vor. Aber daneben stand meiner, also der Beweis: Wir hatten zusammen Rumba getanzt. Dann fiel es mir ein, ich war sogar ihr Tischherr gewesen, widerwillig, da meine Wunschpartnerinnen schon vergeben waren. Auf die Rückseite der Karte hatten etliche aus dem Tanzjahrgang ihre Unterschrift gesetzt, die anderen Namen waren mir geläufig. Meine Unterschrift auffällig angeberisch schwungvoll langgezogen, vielleicht meine erste Signatur. Die Dame lächelte, steckte die Karte wieder ein, wollte offenbar nicht über alte Zeiten plaudern, nahm ihr Buch und hinkte davon. Ein schlechter Tänzer war ich nicht, erst recht nicht beim Rock ’n’ Roll. Aber nur mit den Mädchen, denen ich imponieren wollte.
Abseits
RB Leipzig – Union Berlin 2:1
Sehe kaum noch Fußballspiele. Dies war ein großes Pokalspiel. Die nichtsächsischen Sachsen gewinnen knapp dank einer äußerst umstrittenen Elfmeterentscheidung und einer ebenso zweifelhaften Freistoßentscheidung gegen die nichtberlinischen Berliner. Das schöne, offensive Spiel beider Mannschaften lässt sogar mich das Ergebnis vergessen.
Abstand
Schlüsselwort der Zeiten der Coronapandemie 2020ff. und Schlüsselwort des Gedichts «Selbstporträt mit Luftbrücke» von 1993, in dem es heißt:
Zu neunundneunzig Prozent ein Schimpanse
streif ich durchs Gelände des restlichen Prozents,
durchs Gehölz der Gene vorwärts wohin und
immer den Schritt weiter, der dann zu weit geht: Abstand!
Abt
In Colorado, USA, lebt auf einem Berg in einem buddhistischen Kloster ein deutscher Abt, erzählt mir 2019 die Autorin L., der nur oder am liebsten Delius-Bücher liest. Sie kenne ihn seit dem Studium, er sei damals buddhistischer Mönch geworden, dann in die USA gegangen, sie habe regelmäßig Kontakt. Ich kann das nicht recht glauben und sage: «Aber Ihre Bücher liest er doch sicher auch.» «Ja, aber bei Ihren fiebert er.» Ein Abt, der auf Bergeshöhen in Colorado beim Lesen fiebert – wenn es ihn gibt, dann sei er auf diesem Wege herzlich gegrüßt!
Accademia di Santa Cecilia
Fleißig wurde geübt in der römischen Musikhochschule, im Conservatorio von Santa Cecilia, ständig hörte man Gesang, Hörner, Posaunen, Klarinetten, Violinen, Celli, die Töne und Melodien aus der Nachbarschaft begleiteten die drei Monate in der Via Vittoria 2001 und die zwei Monate 2002. Ich arbeitete in der Wohnung der Übersetzerin Iris Schnebel-Kaschnitz und des Komponisten Dieter Schnebel vormittags an «Mein Jahr als Mörder» (> ANNELIESE) und nachmittags am Libretto der Oper «Prospero» von Luca Lombardi (> ARIEL). Drei oder vier Jahre zuvor hatte ich auf die Frage einer Zeitung, welchen meiner Wünsche ich gerne noch erfüllt sähe, geantwortet: «Verliebt in einer Hütte am Waldrand an einem Opernlibretto arbeiten.» Bald danach hatte völlig unverhofft Lombardi die Arbeit am Libretto angeboten, dann hatte ich mich verliebt, und aus der Hütte war für kurze Zeit eine Wohnung mit großer Terrasse über Rom geworden, dazu die Waldlandschaft der Dächer. Als Zugabe die vielstimmigen, unberechenbaren Klänge aus den Räumen der Heiligen, der Göttin der Musik.
Accademia Tedesca Villa Massimo
Ohne Heinrich Böll und Fritz J. Raddatz wäre mein Leben anders verlaufen. Die beiden sollen 1970 in der Jury für die Villa-Massimo-Stipendiaten Hermann Peter Piwitt und mich durchgesetzt haben, wie ich Jahrzehnte später hörte. Ich war gerade Lektor mit halber Stelle bei Klaus Wagenbach geworden und völlig überrascht von diesem Angebot, das meine Pläne durchkreuzte – damals bewarb man sich noch nicht. Es war eine hohe Auszeichnung, erst recht für einen Passrömer: ein Jahr in einem Atelier in meiner Geburtsstadt plus tausend Mark im Monat. Von Oktober 1971 bis August 1972 ließ ich mich von Wagenbach beurlauben. Aber ohne ein Projekt wollte ich in Rom nicht herumhängen und entwickelte die Idee einer satirischen Festschrift für einen Konzern. Es wurde Siemens – und viel mehr Arbeit, als mir lieb war. Ein Buch, das Folgen hatte (> ABS, > AUSCHWITZ) und das ich als Halbtagslektor unmöglich hätte schreiben können, jedenfalls nicht pünktlich zum hundertfünfundzwanzigjährigen Gründungsjubiläum im Oktober 1972. Schließlich hätten ohne den zehnmonatigen Aufenthalt in Rom auch meine Italienneugier und Italienliebe nicht ein so festes Fundament gefunden. Immer wieder kehrte ich als Besucher nach Rom und hin und wieder auf die Massimo-Insel (> ARNHOLD) zurück.
Darum bekam auch die Villa Massimo für eine Festschrift, 2009, eine Seite über den Kies auf den Wegen: Was wäre die Villa Massimo ohne ihre Wege, die Wege ohne den Kies, der Kies ohne seine Helligkeit, was wäre der Kies, wenn er stumm wäre? Ein Mensch auf den Wegen der Villa genügt, schon fängt der Kies zu sprechen an. Jeder Bewohner, Besucher oder Beschäftigte, der vor die Tür geht und ein Stück läuft, teilt, ob er will oder nicht, den Nachbarn mit: Hallo, hier komme ich! Hört ihr, wie die Kiesel unter meinen Schritten jubeln? So sorgt der Kies für zwei Gemeinschaften, die sich ständig neu zusammensetzen, die geräuschverursachenden Kieswegbenutzer und die neugierigen Deuter dieser Geräusche.
Denn die Kieselsteine sind Verräter, ja, auf diskrete Weise geschwätzig: Wer kommt, wer geht, allein oder zu zweit oder zu dritt, mit einem Fahrzeug oder zu Fuß, mit welchem Schuhwerk, mit Kindern, mit behutsamen oder raschen Schritten, das verraten die kleinen Steine und machen Meldung. Wie sie aneinandergerieben werden, wie sie knirschen, wie sie von Schuhsohlen oder Autoreifen traktiert und verschoben werden, so sprechen sie mit im allgemeinen, im unaufhörlichen Gewisper der Künstler, der Verwalter, der Gäste: Habt ihr schon gehört? Wer kommt da? Allein? Oder mit wem?
Der Wind in den Bäumen macht Pausen, der Verkehrslärm ebbt ab in der Nacht, nur auf den Kies kann man sich immer verlassen. Seine Sprache antwortet unseren Bewegungen, rund um die Uhr.
Achim 1–3
Achim Blüher, Villa-Massimo-Direktor, wie er seine Mortadella in der Rosetta (italienisches Brötchen mit viel Hohlraum) oder den Geschmack der Fleischfarce der Olive ascolane preist, den Anisetta, den Anislikör des Caffè Meletti in Ascoli Piceno, und so fort.
Achim Sartorius, Dichter, wie er 1992 die heruntergekommenen Strandvillen von Heiligendamm mustert, die Péter Nádas im «Buch der Erinnerung» beschrieben hat, und wie er am Rande des Sommerfestes einer besseren Gesellschaft, die heitere Schar der Gäste betrachtend, leise zu mir sagt: «Eigentlich bin ich ja doch ein Misanthrop.»