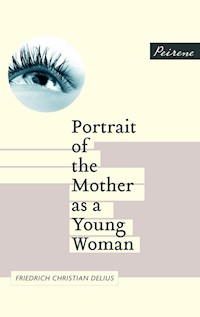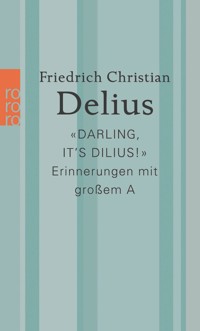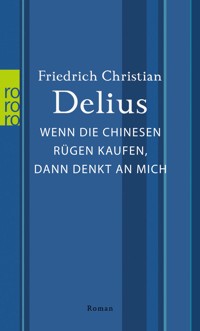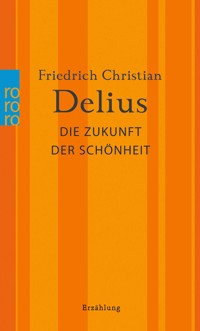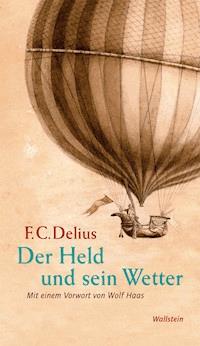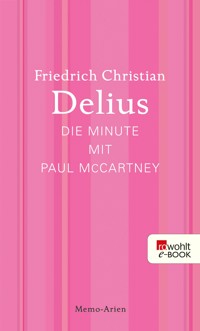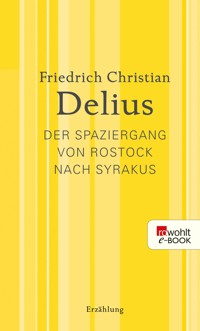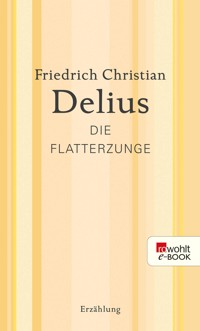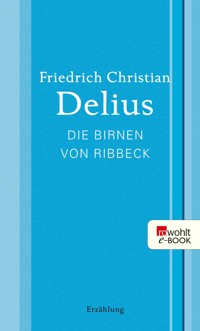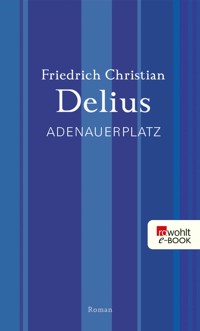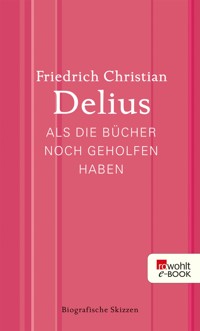9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Gang mit Imre Kertész durch Jena. Ein befreiendes Erlebnis in Jerusalem. Eine Rückkehr aus dem Jenseits eines dreiwöchigen Komas. Drei elementare autobiographische Erfahrungen verdichtet Friedrich Christian Delius zu einem großen Text über das Widerspiel von Schweigen und Sprechen, wobei er das Schweigen als Ausgangspunkt und Angelpunkt allen Sprechens und Meinens würdigt. Delius erzählt von der Vielfalt und den Vorzügen des Schweigens ebenso anschaulich wie von Gesprächen, Missverständnissen und Überraschungen zwischen Schillers Gartenhaus und dem «Schwarzen Bären» in Jena, dem Tempelberg und den Krawatten in Jerusalem und den wilden Halluzinationen durch das eigene Seelengestrüpp während eines langen Delirs auf der Intensivstation. Ein Alterswerk, ein Buch der Erinnerung, so tiefgründig wie heiter, und zugleich ein konzentriertes Selbstporträt. Selten hat F. C. Delius so viel preisgegeben, und selten werden so viele Fragen an das Leben, die ein jeder hat, so spielerisch elegant beantwortet – in Worten, die nicht gesprochen wurden, nun aber geschrieben stehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Friedrich Christian Delius
Die sieben Sprachen des Schweigens
Über dieses Buch
Ein Gang mit Imre Kertész durch Jena. Ein befreiendes Erlebnis in Jerusalem. Eine Rückkehr aus dem Jenseits eines dreiwöchigen Komas. Drei elementare autobiographische Erfahrungen verdichtet Friedrich Christian Delius zu einem großen Text über das Widerspiel von Schweigen und Sprechen, wobei er das Schweigen als Ausgangspunkt und Angelpunkt allen Sprechens und Meinens würdigt. Delius erzählt von der Vielfalt und den Vorzügen des Schweigens ebenso anschaulich wie von Gesprächen, Missverständnissen und Überraschungen zwischen Schillers Gartenhaus und dem «Schwarzen Bären» in Jena, dem Tempelberg und den Krawatten in Jerusalem und den wilden Halluzinationen durch das eigene Seelengestrüpp während eines langen «Delirs» auf der Intensivstation.
Ein Alterswerk, ein Buch der Erinnerung, so tiefgründig wie heiter, und zugleich ein konzentriertes Selbstporträt. Selten hat F.C. Delius so viel preisgegeben, und selten werden so viele Fragen an das Leben, die ein jeder hat, so spielerisch elegant beantwortet – in Worten, die nicht gesprochen wurden, nun aber geschrieben stehen.
Vita
Friedrich Christian Delius, geboren 1943 in Rom, gestorben 2022 in Berlin, wuchs in Hessen auf und lebte seit 1963 in Berlin. Zuletzt erschienen der Roman «Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich» (2019) und der Erzählungsband «Die sieben Sprachen des Schweigens» (2021). Delius wurde unter anderem mit dem Fontane-Preis, dem Joseph-Breitbach-Preis und dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Im Rowohlt Taschenbuch Verlag erschienen seine Bücher als Werkausgabe.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt,
nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Boris Novak
ISBN 978-3-644-00933-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Die Jerusalemer Krawatte
Eines Tages wäre die Geschichte der Jerusalemer Krawatte zu erzählen –
Eines Tages, das mag in ein paar Jahren sein oder Monaten oder irgendwann, wenn die Kräfte reichen, mit der Härte der Genauigkeit auf eines meiner schwierigsten Jahre zu blicken und gleichzeitig die Befreiung zu beschreiben, die ich dem alten Abraham und seinem Sohn Isaak verdanke und die mit einem ostereierbunten Stoffstreifen verknotet ist –
Vielleicht kein besonders schönes Stück, zu schmal, zu bunt, zu offensichtlich selbstgemacht, aber das Äußere ist nicht der Grund, weshalb ich, ohnehin kein leidenschaftlicher Schlipsträger, diese Krawatte nur selten um den Hemdkragen binde, auch nicht, weil die Batikmode eine Mode von vorgestern ist und ich ungern der Geschmacksverirrung bezichtigt werde –
Was mich hindert, sie bei Partys oder Empfängen oder größeren Tischrunden anzuziehen und mit den knalligen Farben unter dem Kinn aufzufallen, sind die leicht verstörten Blicke: Was hast du denn da an?, die ich früher, oft ohne laut gefragt zu sein, im milden Angeberton halb beantwortet, halb entschuldigt habe mit den Worten: eine Jerusalemer Krawatte –
Was schnell zu Konversationsgeplänkel über das Wie und Warum geführt und mich in die Verlegenheit gebracht hat, abwägen zu müssen, wie weit ich den Fragestellern mit Selbstauskünften, ja mit einem Reigen von Selbstauskünften entgegenkommen sollte –
Die, wenn ich einigermaßen bei der Wahrheit bliebe, bis auf die Höhen des Tempelbergs in Jerusalem, in hessische Dorfkirchen und zu einigen Quetschungen des Lebens, wie der alte Weimarer sagt, führen müssten, zu Selbstbespiegelungen und Bohrungen in die eigene Tiefenseele, was in einem Partygetümmel, bei einem kleinen Gesprächsgeplänkel über Form und Farbe einer Krawatte völlig übertrieben oder aufdringlich wäre –
Ich müsste noch weiter ausholen und sogar von meiner Schreibarbeit sprechen, und das ausgerechnet als einer, der Erzählungen von Schriftstellern, die von Schriftstellern erzählen, fast immer für überflüssig gehalten und vermieden hat, auch hier warteten zu viele Peinlichkeiten und Hindernisse –
Dabei gibt es keinen Grund, diese Krawatte zu verstecken oder nichts über sie zu erzählen, immer wieder drängt die zurückgehaltene und für mein Leben so zentrale Geschichte hervor, immer wieder wünsche ich mir die nötige Gelassenheit für einen Bericht, und der Vorsatz, hin und wieder von einigen biographischen Belustigungen zu erzählen, wird ohne dies schmale, bunte Stück Stoff nur schlecht gelingen –
Nach so vielen Andeutungen hier also ein paar Stichworte, die zur kürzestmöglichen Version der Geschichte der Jerusalemer Krawatte gehören sollten –
Einladungen, mit einem eigenen Buch auf Reisen zu gehen und daraus gegen Honorar zu lesen, sich vom geneigten Publikum ermuntern und in zuweilen anstrengende Gespräche verwickeln zu lassen, habe ich in den achtziger und neunziger Jahren nur ausnahmsweise annehmen können, für einen Familienvater, der möglichst viel Rücksicht zu nehmen versuchte auf das Wohlergehen zweier Schulkinder und der angetrauten Professorin, waren die Reisemöglichkeiten beschränkt –
Jeder Weg aus Berlin hinaus war sorgfältig abzuwägen und zu besprechen und oft zu verwerfen, doch als der Briefträger im Frühsommer 1994 eine Einladung nach Israel brachte, zu einem israelisch-deutschen Schriftstellertreffen nach Jerusalem, verlangte die innere Stimme gleich, alles zu tun, um mit einer Zusage zu antworten –
Obwohl ich gerade im Frühjahr sechs Wochen an einer amerikanischen Universität gewesen war und damit das Familienbudget aufgebessert hatte und obwohl ich mit dem eben erschienenen Buch «Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde» da und dort unterwegs war, schien mir eine dritte größere Unternehmung in diesem Jahr, Israel im November, unverzichtbar, eine Woche nur, zehn Tage, dieser Wunsch traf auf keinen Widerstand im Familienrat, die Töchter waren inzwischen elf und fünfzehn Jahre –
Vieles drängte mich, die Einladung anzunehmen, ich war nie in Israel gewesen, es war höchste Zeit, einmal in das Bibelland, Überlebendenland, Rettungsland, Kämpferland, Konfliktland, Aufbauland, Gottesland zu fahren, in das Prüfungsland für jeden Deutschen, der sich mit der Shoah, mit den Tätern, mit den einschlägigen Schuldfragen beschäftigte, und in das Christenland, das auch der diffusen Neugier eines christlich geprägten Agnostikers einiges zu bieten hatte –
Die Einladung kam von Schriftstellern aus Israel und Deutschland, die zuvor in Freiburg ein Treffen von Autoren aus beiden Ländern organisiert hatten, danach ein ähnliches in Berlin, nun sollten die Gespräche in Jerusalem, in der großzügigen Künstlerherberge und Tagungsstätte Mishkenot Sha’ananim, fortgesetzt werden, und ich durfte mich freuen, dass die Kollegen sogar einen wie mich dabeihaben wollten, von dem bekannt war, dass er sich nicht eben häufig in mündlicher Rede hervortut –
Ich sagte also zu und wurde gebeten, zwei kürzere Texte einzureichen, damit sie übersetzt, im Programmbuch gedruckt und bei einer Lesung in Tel Aviv oder Jerusalem präsentiert werden konnten, ich wählte zwei Passagen aus dem gerade erschienenen «Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde», darunter den Abschnitt «Ich war Isaak» –
Dreieinhalb Seiten, sehr private, sehr intime Nöte eines Elfjährigen mit einem Vater, den sich das Kind als übermächtigen Abraham mit Messer und Mordbereitschaft vorstellt, mordbereit aus absolutem, nicht angezweifeltem Gottesgehorsam, der stärker ist als die Liebe zum Sohn, dessen Schrecken keine Rolle spielt bei Moses im Alten Testament –
Ein monologischer Langsatz, kreisend um die Bibelstelle, die mich schon als Kind in der Kinderbibel mit den wuchtigen Figuren des Schnorr von Carolsfeld irritiert hatte, die Opferszene, eine zentrale Metapher der Religionen, übertragen auf einen hessischen Dorfpfarrer und seinen verschreckten Erstgeborenen, verdichtet als kindliche Beschwerde über einen Gott, der seinen treuen Dienern solche Mordbereitschaft, Täuschungen und Konflikte abverlangt –
Diese kurze Variation eines bekannten Textes aus der Bibel war zu verstehen, ohne den Zusammenhang und den dramaturgischen Ablauf des Buches zu kennen, wo sie zwischen dem feierlichen Sonntagsmittagessen der Familie und einer Szene über die Angst des Jungen vor der nicht zu stoppenden Übermacht der ungarischen Fußballer platziert war, sie könnte, weil sie aus dem Buch Moses stammte, die Israelis neugierig machen, überlegte ich, oder provozieren, vielleicht würde man den Text auch als langweilig und zu brav im Sinne jüdisch-christlicher Gemeinsamkeitsrituale empfinden oder als zu radikal, das war egal, die dreieinhalb Seiten waren keine schlechte Eintrittskarte zu dieser Tagung –
Von den Vorbereitungen und vorbereitenden Lektüren, der Reise, den intensiven Kontrollen, dem Flug, der Ankunft, den Kollegen, der Fahrt über die Autobahn hinauf nach Jerusalem, von den üblichen Reiseimpressionen muss hier nicht erzählt werden, alles keine neuen oder nennenswerten Ereignisse –
Außer der Überraschung im Flugzeug, als ich im Einreisepapier den Vornamen des Vaters einzutragen hatte, nicht aber den der Mutter, klar, natürlich wollten die Israelis wissen, ob da noch ein Verbrecher aufzuspüren wäre oder ich aus einer nazikriminellen Familie komme, völlig in Ordnung –
Und doch irritierend, den Namen eines vor über dreißig Jahren Gestorbenen hinzuschreiben und zu denken: Was tun sie, oder was tun sie mit mir, wenn er mehr als ein normaler Wehrmachtsverbrecher war, der in Frankreich, in Russland, in Nordafrika als einfacher Soldat irgendwie durchkam und nicht in der Partei war, nach allem, was ich wusste –
Ich verstand die Frage nach dem Vornamen, aber sie störte mich, störte mich auf, da hatte ich mir ein Leben lang Mühe gegeben, mich vom Vater zu distanzieren, und nun begleitete er, schon so lange tot, mich nicht nur als Abraham im Buchtext, sondern auch mit seiner ganzen Vornamenexistenz und seiner, soweit ich wusste, widerwillig ertragenen Wehrmachtsmitmacherei auf dem Flug über das Mittelmeer nach Israel, in das Mutterland dreier Religionen, und reiste unsichtbar mit in das Land der Bibel, seiner Bibel, eine Reise, von der er nicht einmal zu träumen gewagt hätte –
Den Gedanken, Abraham hinzuschreiben, hatte ich nicht, obwohl ich als Isaak einreiste, mit der Isaak-Geschichte im Gepäck, und als ich auf dem israelischen Formular seinen Namen in meinen Großbuchstaben sah, kam es mir wie ein kleiner Verrat vor, als hätte ich ihn seinen Richtern ausgeliefert –
Später dachte ich, man wollte die deutschen Besucher mit der Frage nach dem Vater ein bisschen erschrecken, vielleicht in ein Labyrinth fruchtloser Überlegungen schicken: Wer bin ich?, oder man wollte uns schon mal daran gewöhnen, dass man als Deutscher, sobald man israelischen Boden betritt, ständig mit Blicken und Fragen gemustert wird: Auch dieser Tourist ein Kind von Verbrechern, was haben die getan, die ihn zeugten?, sieht man es ihm an, sieht man es ihm nicht an? –
All die Fragen waren vergessen, als wir am warmen Novemberabend in der komfortablen «Herberge der Unbekümmerten» in Jerusalem angekommen waren, als ich das israelisch-deutsche Lesebuch mit unseren zwanzig Texten und Biographien durchblätterte und aus dem Apartment sprachlos staunend das Panorama, die Mauern, die Vibrationen der Stadt auf mich wirken ließ –
Dann saßen wir, zwanzig Autoren aus beiden Ländern, vormittags in einem dunklen, kühlen Saal mit Fenstern zur Altstadt hinüber, zehn Frauen, zehn Männer, die stillen Menschen des geschriebenen Wortes an einem Konferenztisch wie ernsthafte Entscheidungsträger aus der Politik oder der Wirtschaft, wir hatten nichts zu entscheiden, nicht einmal auf unserem Feld der Sprache, wollten nichts entscheiden, auch nicht mit Meinungen trommeln, wir wollten nicht einmal eine Resolution verabschieden, wir waren nur mit der Absicht des Zuhörens gekommen –
Ein Kongress der Seismographen, ohne Aktentaschen, ohne Mikrophone, und mit dem Vorsatz, keine Sprüche zu machen und nicht zu viel Ernst aufzubieten, obwohl man mitten auf einem Kampfplatz saß, dem Kampfplatz mit den Palästinensern, dem Kampfplatz dreier Religionen, dem Kampfplatz der Welterlöser, Dogmatiker und Geiferer aller Sorten gegen Unglauben, Freigeist und Humor, nahe dem angeblichen Kampfplatz Davids gegen Goliath und dem realen Kampfplatz an der westlichen Stadtmauer –
Draußen, hinter den Fenstern, sah man die hellen Steine dieser Stadtmauer leuchten, dahinter die Altstadt, ich dachte an den hier nicht geladenen Autor K., der mir in Berlin erzählt hatte, wie er 1948 genau vor diesen Mauern nah am Jaffator und auf dem Gelände, auf dem nun die Tagungsherberge stand und wo wir die Beine ausstreckten und Kaffee schlürften, mit dem Gewehr für Israel und um sein Leben gekämpft hatte –
Auf diesem Kampfplatz sollten wir über Frieden reden, Traumata, Risse, Erschütterungen, es waren Mitte der neunziger Jahre ausnahmsweise einmal nicht die Zeiten des Krieges, eines Vorkriegs oder Nachkriegs, es waren die Zeiten, in denen Rabin und Peres den Friedensprozess vorantrieben –
Man hörte häufig das Wort Verständigung, Diplomaten waren emsig unterwegs, es herrschte, bei aller Skepsis, eine vorsichtige Hoffnung auf eine Zweistaatenlösung, an einem der Tage belebten zwei palästinensische Autoren aus Ramallah, für die man bis zum letzten Moment um die Einreisepapiere hatte kämpfen müssen, mit der Nüchternheit ihrer Beiträge die Diskussion, mit ihrem bitteren, höflichen Ton, und es gefiel mir, wie einig sie mit ihren jüdischen Freunden waren –
Hinter den Fenstern sah ich die einst so umkämpfte, die jahrhundertealte westliche Stadtmauer mit ihren hellen Steinquadern und Zinnen unter blassem Novemberhimmel in ihrem unerschütterlichen Geschichtsstolz, ich hatte die Berliner Mauer fallen sehen, aus der Zweistaatenlösung war eine Einstaatenlösung geworden, aber das sagte nichts für Jerusalem, nichts war vergleichbar, historische Situationen schon gar nicht –
Als einfacher Beobachter vor den Strudeln der Geschichte hatte ich bei der ersten Stadtführung nicht mehr als ein paar Einzelheiten aufgesogen, fühlte ich mich angenehm überfordert und nicht kompetent für irgendwelche nützlichen Überlegungen zu dieser oder jener politischen Lage und Lösung, da sagte ich lieber gar nichts, ich durfte hier zuhören und schweigen –
Ich beobachtete die Kollegen, stimmte fast allen ihren Beiträgen und Kommentaren zu, den verschiedenen Temperamenten, den politischen und poetischen Haltungen der Israelis, und konnte weiterdenken sogar bei den Sätzen von uns deutschen Gästen, es sprachen der herzensfreundliche M., der vielredende Chronist V., die blitzgescheite M., der Sprachgenauigkeitsfanatiker Sch., die kluge Fragestellerin K., der Ironiegroßmeister E., die ruhige Sch., die fordernde G., der melancholische Lyriker B. –
Und wunderte mich wieder, wie ich in diese Runde gekommen war, was meine Rolle hier sein sollte, ich war der Stillste und beobachtete, wie alle versuchten, redselig zu sein und locker, politische Formeln und Klischees zu vermeiden und das Freundschaftliche ihrer Gedanken und Überzeugungen zu betonen –
Jeder, vermutete ich, schien sich vorgenommen zu haben, nicht als Botschafter seines Landes aufzutreten, sondern für sich zu sprechen, nur für sich, und so gehörte es zum guten Ton, auf bescheidene Weise Ich zu sagen, und auch ich nahm mir vor, so persönlich wie möglich zu argumentieren, wenn mein Beitrag fällig war –
Aber ich, wer war ich denn in diesem November 1994, in verzweifelter Lage als scheiternder Retter einer scheiternden Ehe, im Selbstvertrauen heftig wankend und so in die Defensive geraten, dass es doppelt absurd und arrogant gewesen wäre, als Autor über den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zu sprechen, solange ich nicht einmal Mittel wusste, den Frieden in der eigenen Wohnung herzustellen –
Ich hörte zu und war zufrieden, dass viele in dieser Runde etwas beizutragen hatten zu den Fragen des Abbaus von Spannungen und Vorurteilen zwischen Israelis und Deutschen, Israelis und Palästinensern, Palästinensern und Deutschen und vor allem zwischen Deutschen und Deutschen, ich konnte nur etwas zu den Konflikten zwischen den Deutschen sagen und zum wilder gewordenen Westen –
Und schwieg ansonsten, weil mir nicht einmal mit einem einzigen Menschen, den ich gut zu kennen meinte, mit der Frau, die ich geliebt hatte und immer noch zu lieben versuchte, weil nicht einmal mit ihr der Abbau von Spannungen und festgeprägten Urteilen gelang und ich mich vielmehr einer Verachtung ausgesetzt fühlte, die nichts mit mir zu tun hatte und aus heilloser Selbstverachtung gespeist war –
In meinem sogenannten Privatleben gab es immer weniger Aussicht auf Verständigung, Versöhnung, Stabilität, da wäre es der reinste Schwindel gewesen, vor den Jerusalemer Kulissen, nur weil das hier erwartet wurde, von Verständigung, Versöhnung und Stabilität zu sprechen –
Doch in dieser Runde hatte ich nicht den Mut zu gestehen, die Ordnung meiner Herzensangelegenheiten liege mir gerade näher als die Friedensordnung im Nahen Osten, die ich ebenso wünschte mit Herz und Verstand, und für eine elegant witzige Volte solch einer Aussage fehlte mir die Form, darum blieb ich still und schwieg, wollte nicht schwindeln, konnte nicht schwindeln, und blieb noch mehr als sonst in meiner gewohnten Rolle als Zuhörer, Zuschauer und Schweiger vom Dienst –
Bis am vierten Jerusalemer Morgen Chaim B. auf mich zukam, in eine Ecke zog und sagte, er sei von den Veranstaltern gebeten worden, mich bei dem geplanten Leseabend vorzustellen und meinen Text auf Hebräisch vorzulesen, er müsse gestehen, er habe erst jetzt, in der Nacht, sich darauf vorbereitet, das Tagungsbuch mit unseren Texten gelesen, mein Beitrag «Ich war Isaak» habe ihn so beeindruckt, dass er die ganze Nacht kaum geschlafen habe, er müsse unbedingt mit mir darüber reden –
Er sprach wie stets mit einem liebenswürdigen Lächeln im Gesicht, ich hatte ihn in den Tagen zuvor am großen Tisch wie in Gesprächen am Rande als besonders freundlich, zurückhaltend, aufmerksam erlebt, ungefähr mein Alter, ein guter Zuhörer und ein guter, leiser Debattierer, der auf jedes einzelne Wort achtete, Wörter abschmeckte und abwog, Mehrdeutigkeiten, mythische Ursprünge, biblische Zusammenhänge erklärte –
Ich mochte ihn, weil er stets von der Sprache her argumentierte, Fabeln, Geschichten, Anekdoten waren ihm Anleitungen zur Weisheit, allemal wichtiger als Meinungen oder ideologische Positionen, er war nicht nur bibelfest, er war fromm und der Einzige in der Runde, der eine Kippa auf dem Kopf hatte –
Nach dem Mittagessen setzten wir uns abseits, und er erklärte, immer noch euphorisch, warum der Text für ihn und für das Publikum so wichtig sei –
Und mit seiner Hochstimmung beginnt die Geschichte der Jerusalemer Krawatte –
Da drüben, sagte er in seinem gewandten Englisch und streckte den Arm aus, auf dem Berg da drüben, also fast hier, direkt neben uns, wo wir sitzen, hat der Altar gestanden, auf dem Abraham, statt Isaak zu erstechen, den Widder geopfert hat, und über diesem Altar ist später der Tempel gebaut worden –
Der Mythos zum Greifen nah, Vater und Sohn in Sichtweite, das hatte ich nicht gewusst, ja, fuhr Chaim fort, der Tempelberg sei der einstige Opferberg, und die im letzten Moment gestoppte Opferung Isaaks symbolisiere einen neuen Schritt in der Entwicklung der Geschichte, der Übergang vom Menschen-Opfer zum Tier-Opfer sei im Grunde eine Aufwertung des Menschen –
Und wie in einer kurzen Vorlesung erklärte er dem ungebildeten Deutschen, dass bei den Phöniziern wie in Karthago noch lange Zeit die Erstgeborenen regelmäßig oder in schwierigen Situationen geopfert wurden, das Judentum sei wahrscheinlich die erste Religion, die Schluss gemacht habe mit den Kinderopfern, es sei überall ein langer Kampf gewesen, bis die Menschenopfer abgeschafft worden seien –
Ich spürte, wie nah ihm dieses Thema ging und wie nah es mir plötzlich war, von Chaim so ernst genommen, mitten in Jerusalem, meine Neugier war hellwach, ich ließ mich gern belehren, kleinlaut und verschämt wegen meiner bodenlosen Unwissenheit, ich wusste gerade noch, dass auch für die Muslime das Opferfest der höchste Feiertag ist und beim Schlachten der Lämmer, wie mir ein türkischer Freund erzählt hatte, manch strenger Vater dem Sohn gern mit dem entsprechenden Vers aus dem Koran droht, das Lamm werde an seiner Stelle geschlachtet –
Die Theologen, sagte Chaim, hätten sehr viel geschrieben über das Bündnis zwischen Gott und Abraham und den Gehorsam, für die Juden sei die Bindung an Gott zentral, für die Christen die Opferung, für die Muslime die Schlachtung, von deren Söhnen werde sogar die Zustimmung zur eigenen Opferung verlangt sowie der Dank an Allah, dass statt ihrer die Lämmer unters Messer kommen –
Aber die Rolle der Söhne, Isaaks oder Ismaels mögliche Gefühle und Widerstände in dieser Konstellation seien in den traditionellen Theologien vernachlässigt worden, es habe ihn tief bewegt, wie ich das Verlangen Isaaks ausgedrückt hätte, als Mensch mit seinen Empfindungen, Ängsten und seiner Vaterliebe wahrgenommen werden zu wollen, und nicht als Objekt, als williges Opfer, als Geisel im Kampf um den Gottesgehorsam, das habe ihn die alte Geschichte wieder neu verstehen lassen, ich hätte Isaak eine Stimme gegeben, so könne er gehört werden, endlich gehört werden –
Es sei, sagte Chaim, in diesem Text auch der Konflikt vieler junger Israelis mit ihren Vätern, mit ihrem Staat angesprochen, immer wieder fragten sich viele der zum Wehrdienst eingezogenen, zu Kriegen gezwungenen jungen Leute, warum sie geopfert werden oder ihrer Opferung zustimmen sollen, damit ihre Väter ihre Gottesliebe beweisen können, damit die Existenz ihres von Gott und ihnen gewollten Staates gesichert bleibe –
So redete Chaim, strahlend vor Begeisterung, in feinem Englisch, auf mich ein, erklärte bündig die Philosophien des Gehorsams und rückte meine kleine dörfliche Kinderleidensgeschichte in immer weitere, immer größere, in unendlich verzweigte Zusammenhänge –
Und brachte mich in Verlegenheit, die Komplimente waren in ihrer Schwere und Schmeichelkraft gar nicht annehmbar und produzierten eher Distanz als Nähe, während ich, immer sprachloser, mir einfach nur zu merken versuchte, was er redete –
Es sei eine Freude, ein Geschenk für ihn, dass ein deutscher Protestantensohn einen solchen, vielfach deutbaren und mythologisch wie politisch aufregenden Text mitgebracht habe, und er, Chaim, diesen vorstellen dürfe, ausgerechnet er, der sich seit Jahrzehnten immer wieder mit dem Abraham-Isaak-Mythos beschäftigt und viele Bücher darüber gelesen habe, finde hier nun dank des Zufalls, dass er zu dieser Tagung geladen und als mein Textleser eingeteilt worden sei, eine neue, spezielle Variante des alten Stoffes –
Während wir am nächsten Tag im Bus durch das besetzte Westjordanland gefahren wurden auf der Schnellstraße durch die steil abfallende Judäische Wüste, vorbei an Wachttürmen und hohen Drahtzäunen der machtstrotzenden, weitläufigen Festungsstadt Maale Adummim, die fälschlicherweise Siedlung genannt wird, und vorbei an ärmlichen Zelten und Hütten der Beduinen, vorbei an israelischen Posten und Straßensperren, während sich die Augen gewöhnten an Sandfarben und Steinfarben, hielten Abraham und Isaak weiterhin meinen Kopf besetzt –