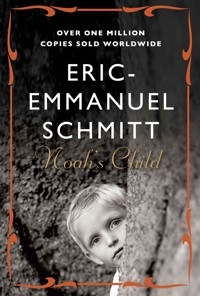8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
8. Oktober 1908: »Adolf Hitler durchgefallen.« Ein einzelner Satz steht am Anfang der Katastrophe, die ein Jahrhundert erschüttert hat. Was aber, wenn der Zwanzigjährige tatsächlich Maler geworden wäre? Ohne Scheuklappen wirft Eric-Emmanuel Schmitt die verstörende Frage nach den Bedingungen auf, die einen Menschen zu dem machen, was er ist. Parallel zu der Geschichte des Diktators Adolf Hitler erzählt er eine Lebensgeschichte im Konjunktiv: die Biographie des Kunstmalers Adolf H.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Ähnliche
Eric-Emmanuel Schmitt
Adolf H. Zwei Leben
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Gewidmet dem Andenken Georg Elsers,
der selbstgebaute Bomben legte.
Die Minute, die den Gang der Welt veränderte
»Adolf Hitler: durchgefallen.«
Das Verdikt fiel herab wie ein Stahllineal auf eine Kinderhand.
»Adolf Hitler: durchgefallen.«
Eiserner Vorhang. Vorbei. Bei uns nicht mehr. Seht woanders weiter. Draußen.
Hitler schaute um sich. Dutzende junge Männer – mit hochroten Ohren, die Zähne zusammengebissen, der Körper gespannt, auf Zehenspitzen stehend, die Achselhöhlen im Gedränge feucht geworden – hörten die Worte des Pedells, der ihr Schicksal herunterleierte. Niemand beachtete ihn. Kein Mensch hatte die enorme Tragweite dessen begriffen, was soeben verkündet worden war, die Katastrophe, die die Halle der Kunstakademie erschütterte, die Explosion, die das Universum zerriß: Adolf Hitler durchgefallen.
Angesichts ihrer Gleichgültigkeit glaubte Hitler fast schon, nicht richtig verstanden zu haben. Ich leide. Eine eiskalte Klinge schlitzt mich auf von der Brust bis zu den Gedärmen, ich verblute, und niemand bemerkt es? Sieht denn niemand das Unglück, das mich zermalmt? Lebe einzig ich auf dieser Erde mit solcher Heftigkeit? Ist es dieselbe Welt, in der ich mit den anderen lebe?
Der Pedell hatte die Verlesung der Resultate beendet. Er faltete sein Blatt zusammen und lächelte ins Leere hinein. Ein gelblicher langer Lulatsch, eiskalt wie ein Taschenmesser, die Beine und Arme hölzern, unendlich lang, schlaksig und fast unabhängig vom Rumpf, an instabilen Gelenken gehalten. Nach getaner Arbeit stieg er vom Podest und gesellte sich wieder seinen Kollegen bei. Dem Äußeren nach keineswegs ein Henker, wohl aber der Denkungsart nach. Überzeugt davon, die Wahrheit verkündet zu haben. Ein Kretin von der Sorte, daß er zwar Angst hatte vor einer Maus, aber nicht eine Sekunde zögerte, als er seelenruhig verkündete: »Adolf Hitler: durchgefallen.«
Schon im Jahr zuvor hatte er dieselben schrecklichen Worte gesagt. Aber damals war es nicht so schlimm gewesen: Hitler hatte nichts für die Prüfung getan und sich zum ersten Mal vorgestellt. Heute dagegen kam der gleiche Satz einem Todesurteil gleich: Man durfte sich nur zweimal bewerben.
Hitlers Blick blieb an den Pedell geheftet, der jetzt mit den Akademieaufsehern lachte, dreißigjährige lange Bohnenstangen in grauen Hemden, alte Herren in den Augen Hitlers, der erst neunzehn war. Für sie war es ein gewöhnlicher Tag, ein Tag wie jeder andere, ein Tag, der ihr Gehalt am Monatsende rechtfertigte. Für Hitler dagegen war es der letzte Tag seiner Kindheit, der letzte, an dem er noch hatte glauben können, daß Traum und Wirklichkeit eins werden könnten.
Die Halle der Akademie leerte sich langsam, wie eine Bronzeglocke, die sich ihrer Klänge entledigt und sie hinausschickt in die weite Stadt. Um das Glück der Zulassung oder die Traurigkeit der Ablehnung zu würdigen, verteilten sich die jungen Leute über die Kaffeehäuser von Wien.
Nur Hitler blieb wie angenagelt stehen, betäubt und aschfahl. Plötzlich nahm er sich von außen wahr, als eine Romanfigur: Seit Jahren schon vaterlos, war ihm im Winter zuvor auch die Mutter gestorben. In der Tasche nur noch hundert Schilling, im Koffer drei Hemden und eine Nietzsche-Gesamtausgabe. Kalt kündigte sich die Armut an, soeben hatte man ihm das Recht abgesprochen, einen Beruf zu erlernen. Was stand auf seiner Habenseite? Nichts. Ein knochiges Äußeres mit großen Füßen und sehr kleinen Händen. Ein Freund, dem er sein Scheitern nicht eingestehen würde, so sehr hatte er zuvor geprahlt, es diesmal zu schaffen. Eine Verlobte, Stephanie, der er oft schrieb, die aber nie antwortete. Hitler sah sich realistisch und hatte Mitleid mit sich. Dabei war dies das letzte Gefühl, von dem er sich leiten lassen wollte.
Die Akademieaufseher traten an den tränenüberströmten Burschen heran. Sie luden ihn ein, in der Pförtnerloge einen Kakao mit ihnen zu trinken. Der junge Mann ließ seinen Gefühlen freien Lauf und weinte weiter still vor sich hin.
Draußen strahlte heiter die Sonne, der Himmel war von blendendem Blau, übersät mit Vögeln. Durch das Fenster sah Hitler dem Schauspiel der Natur zu, und er verstand nicht. Also weder die Menschen noch die Natur? Da ist niemand, der mein Leiden teilt?
Hitler trank seinen Kakao, dankte den Akademieaufsehern höflich und empfahl sich. Diese Fürsorglichkeit tröstete ihn nicht: Wie jedes menschliche Verhalten war sie allgemein, von Prinzipien und Werten geleitet, nicht aber an ihn persönlich gerichtet. Davon hatte er genug.
Er verließ die Kunstakademie und verlor sich alsbald mit kleinen Schritten und hängenden Schultern im Gewusel von Wien. Diese Stadt war wundervoll, sie war lyrisch, barock und herrschaftlich gewesen, der Schauplatz seiner Hoffnungen; nun wurde sie zum engen Rahmen seines Scheiterns. Würde er sie noch lieben? Würde sie ihn noch lieben?
Das war es, was an jenem 8. Oktober 1908 geschah: Eine aus Malern, Radierern, Zeichnern und Architekten bestehende Jury hatte, ohne mit der Wimper zu zucken, den Fall des jungen Mannes entschieden. Ungeschickter Strich. Verworrene Komposition. Unkenntnis der Techniken. Konventionelle Phantasie. Sie hatten nur eine Minute gebraucht und bedenkenlos ihr Urteil gefällt: Dieser Adolf Hitler hatte keine Zukunft.
Was wäre geschehen, hätte die Kunstakademie anders entschieden? Was wäre mit ihm passiert, hätte in ebenjener Minute die Jury Adolf Hitler angenommen? Diese Minute hätte den Lauf eines Lebens verändert, sie hätte aber auch den Lauf der Welt verändert. Was wäre aus dem zwanzigsten Jahrhundert ohne den Nazismus geworden? Hätte es in einer Welt, in der Adolf Hitler Maler gewesen wäre, einen Zweiten Weltkrieg mit mehr als fünfzig Millionen Toten gegeben, darunter sechs Millionen Juden?
»Adolf H.: bestanden.«
Eine Hitzewelle durchlief den jungen Mann. In ihm wogte das Glück, es pulste in seinen Schläfen, rauschte in seinen Ohren, weitete ihm die Lungen und wühlte sein Herz auf. Es war ein langanhaltender Augenblick, erfüllt und angespannt, die Muskeln hart, ein ekstatischer Krampf, eine reine Lust wie der erste unwillkürliche Orgasmus mit dreizehn Jahren.
Als die Welle abebbte und er wieder zu sich kam, entdeckte Adolf H., daß er völlig durchnäßt war. Seine staubige Kleidung roch nach saurem Schweiß. Er besaß keine Wäsche zum Wechseln. Aber was machte das schon: Er war angenommen!
Der Pedell faltete seinen Zettel zusammen und zwinkerte ihm zu. Adolf schenkte ihm ein unbändiges Lächeln. So nahmen ihn selbst die niederen Bediensteten, sogar die Wärter, nicht nur die Professoren, mit Freude in die Akademie auf!
Adolf H. drehte sich um und sah ein paar Burschen, die sich beglückwünschten. Er trat, ohne zu zögern, an sie heran und streckte ihnen die Hand entgegen.
»Guten Tag, ich bin Adolf H. Ich bin auch aufgenommen worden.«
Der Kreis öffnete sich ihm. Der Geräuschpegel stieg an. Es war ein Reigen von Umarmungen, Lächeln und Namen, die man sich zum ersten Mal sagte, aber nicht gleich einprägte. Man hatte ja noch das ganze Jahr vor sich, um einander besser kennenzulernen.
Es war Herbst, doch dieser Tag besaß die Frische wahrer Anfänge, die Sonne war mit von der Partie und lachte an einem Himmel von unwiderruflichem Blau.
Die jungen Männer sprachen alle auf einmal, keiner hörte dem anderen zu. Man verstand kaum das eigene Wort, doch jeder wußte, was der andere sagte, weil sie alle die gemeinsame Freude einte.
Einem aber gelang es, das Tohuwabohu zu übertönen, und er brüllte, sie sollten ins Wirtshaus Kanter gehen, um zu feiern.
»Auf geht’s!«
Adolf schlüpfte mit ihnen hinaus. Er war solidarisch. Er gehörte zur Gruppe.
Er war schon mit einem Fuß aus der Akademie heraus, als er hinter sich einen reglosen Burschen bemerkte, der allein mitten in der riesigen Halle stand und still schwere Tränen weinte.
Mitleid streifte Adolf H., er hatte noch die Zeit, der Arme zu denken, und wurde dann jäh vom Glück ergriffen. Das Glück übermannte ihn in einer zweiten, zerstörerischen Welle, stärker noch als die vorangegangene. War es doch von nun an eine verstärkte, angereicherte Freude, eine doppelte Freude: die Freude, es geschafft zu haben, begleitet von der Freude, nicht gescheitert zu sein. Adolf H. hatte soeben entdeckt, daß sich das Glück stärkt am Unglück der anderen.
Er gesellte sich wieder seinen Kameraden bei. War den Wienern an diesem Nachmittag überhaupt klar, daß an ihnen eine Gruppe junger Genies vorbeiging? Geduld, sagte sich Adolf, eines Tages werden sie es begreifen.
Geschrei und Freude schäumten hoch auf im Gasthaus Kanter, und das Bier strömte überschäumend in die Seidel. Adolf H. trank, wie er noch nie getrunken hatte. An diesem Abend wurde aus ihm endgültig ein Mann. Er und seine neuen Freunde erklärten einander, was für große Künstler sie werden würden und wie sie, daran gab es keinen Zweifel, ihr Jahrhundert prägen würden; sie begannen sogar, über die Alten zu lästern. Dies war ein historischer Abend. Adolf H. trank immer mehr, er trank, wie man Musik machte, um mit den anderen im Einklang zu sein, um mit ihnen zu verschmelzen.
Es war das erste Mal in seinem Leben, daß er sich nicht gegen die anderen, sondern mit ihnen behauptete. Er wußte sich seit Jahren schon als Maler, er hatte nie daran gezweifelt, obwohl er seit seinem Scheitern im Jahr zuvor darauf wartete, daß man ihn als den anerkannte, als der er sich erträumte! Das Leben offenbarte sich als gerecht und schön. Von diesem Abend an konnte er es sich erlauben, Freunde zu haben.
Er trank und trank.
Nachdem sie die Welt umgekrempelt hatten, erklärten sie nun einander, wo sie herkamen, was ihre Familien taten. Als Adolf an der Reihe war, verspürte er einen rasenden Drang zu pinkeln, und er rannte auf die Toilette.
Sein Urin besprengte machtvoll das Steingut, er pinkelte mit dickem Strahl, er fühlte sich unverwundbar.
Im grünlichen, pockennarbigen Spiegel sah er prüfend seinen neuen Kopf an: das Haupt eines Studenten der Kunstakademie. Es schien ihm, als könne man es ihm schon ansehen, als läge ein neuer Glanz in seinen Augen, ein Funkeln ohnegleichen. Er studierte sich mit Genuß, posierte ein bißchen vor sich selbst, betrachtete sich mit den Augen der Nachwelt, Adolf H., der große Maler …
Ein Schmerz lähmte seinen Kiefer, die Lippen bedeckten sich mit Schaum, und Adolf schlug auf dem Waschbecken auf. Seine Schultern wurden von Krämpfen geschüttelt, die Schluchzer verwüsteten sein Gesicht: Er hatte soeben an seine Mutter denken müssen.
Mama … Wie glücklich sie an diesem Abend gewesen wäre! Sie wäre so stolz auf ihn gewesen! Sie hätte ihn an ihre kranke Brust gepreßt.
Mama, ich bin in die Akademie aufgenommen.
In allen Einzelheiten malte er sich das Glück seiner Mutter aus und erfuhr endlich in ganzer Fülle ihre Liebe.
Mama, ich bin in die Akademie aufgenommen.
Er sagte es sanft noch einmal, wie eine Beschwörungsformel in dem Moment, da der Sturm vorüberzieht.
Dann ging er zu seinen Freunden zurück.
»Adolf, wo warst du? Hast du dich übergeben müssen?«
Sie hatten auf ihn gewartet! Sie nannten ihn bei seinem Vornamen! Sie hatten sich Sorgen um ihn gemacht! Der junge Mann war so bewegt, daß er das Wort ergriff:
»Ich glaube, man kann heute nicht mehr so wie vor zwanzig Jahren malen. Es gibt jetzt die Fotografie, und wir müssen uns daher auf die Farbe konzentrieren. Ich glaube nicht, daß die Farbe natürlich sein sollte!«
»Wie? Von wegen! Meyer meint …«
Und eigensinnig wie ein gutes Kaminfeuer loderte das Gespräch wieder auf. Adolf begeisterte sich für Ideen, von denen er vor fünf Minuten noch nie etwas gehört hatte, er stürzte sich in neue Theorien, die er augenblicklich für der Weisheit letztes Wort hielt. Energisch boten ihm die anderen Paroli.
In den kurzen Sekunden, da er schwieg, lauschte Adolf H. nicht etwa seinen Kommilitonen, sondern dachte schwelgerisch an die Briefe, die er am nächsten Tag schreiben würde: einen an seine Verlobte Stephanie, die von nun an keinen Grund mehr hatte, so hochnäsig zu tun, einen an seine Tante, die nie an sein Talent als Maler geglaubt hatte, einen an seinen Vormund Mayrhofer, der sich den unerhörten Rat erlaubt hatte, er solle sich ›einen richtigen Beruf‹ suchen, und einen an seine Schwester Paula, dieser frechen, häßlichen Blage, für die er nur Gleichgültigkeit empfand, die aber trotzdem begreifen sollte, was für ein großer Mann ihr Bruder sei. Außerdem einen an Rauber, diesen Schwachkopf, der ihm schlechte Zensuren in Zeichnen gegeben, und einen an Krontz, der es sich erlaubt hatte, seine Farbzusammenstellungen zu kritisieren. Zu guter Letzt noch einen an seinen Grundschullehrer, der ihn gedemütigt hatte, als er acht Jahre war, indem er der ganzen Klasse seinen schönen roten fünfblättrigen Klee zeigte … In seiner Freude legte er seine Briefe wie eine Flinte an. Seine Kugeln würden all jene treffen, die nicht an ihn geglaubt hatten. Er verspürte einen unbändigen Lebensdrang. An diesem Abend fühlte er sich gut, morgen aber würde er sich noch besser fühlen, weil er den anderen weh tun würde. Leben, das heißt ein bißchen zu töten.
So hatte Adolf H. an diesem 8. Oktober zwar noch nicht das geringste Werk von Bedeutung geschaffen und hatte lediglich das Recht erworben, den Beruf des Kunstmalers zu erlernen, war aber im Alkoholdunst des Gasthauses Kanter an einen wesentlichen Punkt angelangt, ohne den es keinen Künstler gibt: Er hielt sich endgültig für den Mittelpunkt der Welt.
»Guten Abend, Herr Hitler! Nun? Haben Sie bestanden?«
Frau Zakreys, seine Wirtin, diese tschechische Hexe, war, sobald sie den Schlüssel im Schloß gehört hatte, von ihrer Nähmaschine aufgestanden, um ihn im Korridor abzufangen. Zu seinem großen Glück stand Hitler noch im Halbschatten, und er dachte, daß die gelben Äuglein nur wenig von seiner massigen Silhouette wahrnähmen.
»Nein, Frau Zakreys. Sie haben die Ergebnisse noch nicht bekanntgegeben, einer der Prüfer ist erkrankt und konnte keine Zensuren geben.«
Frau Zakreys hüstelte verständnisvoll. Hitler wußte, daß er, wenn er von Krankheit sprach, sofort ihre Sorge und Sympathie weckte.
»Und was hat der Professor?«
»Grippe. Wie es ausschaut, geht in Wien eine Grippeepidemie um.«
Frau Zakreys zog sich instinktiv in die Küche zurück, weil sie befürchtete, auch Hitler sei Träger gefährlicher Keime.
Hitler hatte einen entscheidenden Punkt gemacht. Frau Zakreys, die ein paar Jahre zuvor ihren Mann durch eine verschleppte Grippe verloren hatte, würde sich fernhalten und dem Jungen nicht einmal anbieten, einen Tee mit ihr zu trinken. Zweifellos würde sie ihm mehrere Tage lang aus dem Weg gehen. Volltreffer! Er würde sich nicht mit Lügen abmühen und die Komödie dessen spielen müssen, der auf seine Prüfungsergebnisse wartet.
Als er seinen Mantel aufhängte, hörte er schon, wie sie das Gas anzündete und sich einen Thymiansud bereitete. Da sie wegen ihres übereilten Rückzugs ein schlechtes Gewissen hatte, steckte sie noch einmal den Kopf in den Korridor, um höflich zu fragen:
»Sie sind bestimmt enttäuscht, wie?«
Hitler zuckte zusammen.
»Weshalb?«
»Daß Sie noch warten müssen … auf Ihre Ergebnisse …«
»Ja. Das zehrt an den Nerven.«
Sie musterte ihn von fern, bereit, ihm noch ein bißchen länger zuzuhören, als sie aber feststellte, daß er keine weiteren Erklärungen geben würde, befand sie, liebenswürdig genug gewesen zu sein, und kehrte an ihren Herd zurück.
Hitler schloß sich in seinem Zimmer ein.
Er setzte sich im Anzug auf sein Bett und fing an, methodisch zu rauchen. Er inhalierte den Rauch, ließ ihn in seinen Lungen kreisen und stieß dann dicke Spiralen aus. Er hatte den berauschenden Eindruck, das Zimmer mit seiner eigenen Substanz zu heizen.
Um ihn herum seine Zeichnungen, Opernplakate – Wagner, Wagner, Wagner, Weber, Wagner, Wagner – sowie Bühnenbildentwürfe für das lyrisch-mythologische Drama, das er mit seinem Freund Kubizek schreiben wollte, die Bücher von Kubizek, Kubizeks Partituren.
Er würde Kubizek schreiben müssen, in die Kaserne, wo er seinen Militärdienst ableistete. Schreiben … ihm sagen …
Hitler fühlte sich der Aufgabe nicht gewachsen. Er, der Kubizek überzeugt hatte, ihm nach Wien zu folgen, der ihm versichert hatte, daß ein Musiker in ihm steckte, der ihn eigenhändig bei der Musikakademie eingeschrieben hatte, wo Kubizek auf Anhieb in Musiklehre, Komposition und Klavier aufgenommen worden war, er, der von ihnen beiden der Anführer gewesen war, gegen den Widerstand ihrer Familien, er würde nun seinerseits eingestehen müssen, daß er alles vermasselt hatte.
Frau Zakreys kratzte an der Tür.
»Was ist?« fragte Hitler aggressiv, um seine Privatsphäre zu schützen.
»Denken Sie dran, Sie müssen mir noch die Miete für das Zimmer bezahlen.«
»Ja. Montag.«
»Einverstanden. Aber nicht später.«
Mit schlurfendem Schritt entfernte sie sich. Würde er dieses Zimmer weiter bezahlen können? Hätte man ihn an der Kunstakademie aufgenommen, dann hätte er einen Anspruch auf eine Waisenpension. Aber ohne das …
Ich habe das Erbe von meinem Vater! Achthundertneunzehn Schillinge!
Aber er würde an das Erbe erst herankommen, wenn er volljährig wäre, in fünf Jahren. Das war noch eine Weile.
Sein Herz jagte.
Mit verdrießlichem Blick sah er sich im Zimmer um. Er würde nicht einmal hierbleiben können. Als Student hatte er sich mit wenig bescheiden können. Jetzt aber, da er kein Student mehr war, war er arm.
Dreimal machte er die Tür hinter sich zu und fand sich auf der Straße wieder. Er flüchtete vor seinem Zimmer. Er mußte laufen. Er mußte sich eine Lösung einfallen lassen. Das Gesicht wahren! Vor allem das Gesicht wahren. Kein Wort zu Kubizek. Und Geld auftreiben. Den Anschein von Normalität aufrechterhalten.
Mit weit ausgreifendem, dumpfem Schritt durchmaß er die Straßen von Mariahilf, einem der ärmsten Stadtviertel Wiens, einem Viertel, das eigentlich neu aussehen müßte, wenn man von seinem Alter ausging, dessen übervölkerte Gebäude aber schon jetzt Risse zeigten. Ein schwerer Geruch nach gerösteten Maronen hing über den Fassaden.
Was tun?
Die Lotterie!
Hitler frohlockte. Genau! Das war die Lösung! Das war der Grund, weshalb der Tag so schlecht gelaufen war! Alles hatte seinen Sinn. Das Schicksal hatte ihm die Akademie versagt, weil es für ihn eine schönere Überraschung bereithielt: Millionär zu werden. Dieser Nachmittag war nichts weiter als eine Initiationsprüfung, eine Pechsträhne, nach der zwangsläufig die Sonne wieder für ihn strahlen mußte: ein Lotterielos! Er hatte nur deshalb verloren, um desto mehr zu gewinnen.
Es war ganz offensichtlich! Wie hatte er nur daran zweifeln können? Das erste Los vom ersten Verkäufer, der mir über den Weg läuft! Das war es, was ihm seine innere Stimme sagte. Das erste Los vom ersten Verkäufer, der mir über den Weg läuft!
Gleich hinter einem Röstofen, wo die glühende Holzkohle die Kastanienbäume schwärzte, tauchte ein an Wassersucht leidender Schwerstbehinderter auf, der den Passanten Lose anbot.
Hitler starrte den aufgeschwemmten Losverkäufer wie eine Erscheinung an, oder eher noch wie einen Fingerzeig Gottes. Da waren Glück und Reichtum, zum Greifen nahe, auf dem Stoffsitz eines Klappstuhls sitzend, die Beine unter den Sitz geklemmt, Glück und Reichtum in der Gestalt eines zahnlosen Bettlers mit aufgedunsenen Gliedmaßen. Wie in den Märchen seiner Kindheit, die ihm seine Mutter vorlas.
Nervös durchwühlte Hitler seine Hosentaschen. Besaß er noch das Geld dafür? Auf wunderbare Weise war ihm genau die nötige Summe geblieben. Darin sah er ein weiteres gutes Omen.
Mit klopfendem Herzen näherte er sich der Masse flüssigen Fleisches und bat:
»Ein Los, bitte.«
»Welches, mein Herr?« fragte das Ungetüm und versuchte, seine glasigen Augen auf den jungen Mann zu richten.
»Das erste, das Ihnen in die Finger kommt.«
Hitler sah fasziniert, wie die menschliche Pfote über die Lose fuhr, zögerte und schließlich mit einem Ruck ein Los herauszog.
»Hier, schauen Sie, mein Herr. Und man kann sagen, Sie haben Glück.«
»Ich weiß«, antwortete Hitler kurz und errötete heftig.
Er schnappte sich das Los, drückte es an sein Herz und rannte fort.
Er war gerettet. Seine Zukunft hielt er an sich gepreßt. Und er war überzeugt, daß es seine tote Mutter war, die ihm vom Himmel aus diese rettende Eingebung gesandt hatte.
»Danke, Mama«, sagte der Sohn, noch immer rennend, die Augen zu den Sternen erhoben, die sich hinter düsteren Dächern verbargen.
Ein erster Auftrag …
Adolf H. – das Haar glatt, der Pyjama quergestreift, die Augen noch geschwollen von der Bierhefe – kratzte sich den linken Schenkel und schaute auf das Paar, mit dem kaum zu rechnen gewesen war und das nun den Zugang zum Korridor versperrte: die untersetzte Frau Zakreys und der monumentale Nepomuk, der berühmte Fleischer aus der Barbarossastraße. Sie drückten sich ungelenk vor ihm herum, Bittsteller, die sich genierten, wie ferne Verwandte zu Besuch.
»Nepomuk hat schon immer von einem gemalten Ladenschild geträumt«, maunzte die Portiersfrau.
»Ja, ein schönes Ladenschild, mit meinem Namen und in Farbe«, pflichtete Nepomuk bei.
Ein erster Auftrag … Es handelte sich wahrhaftig um seinen ersten Auftrag … Man wollte das Talent des Malers Adolf H. in Anspruch nehmen. Der Junge zeigte ein solch stummes Erstaunen, daß sich Nepomuk schon fragte, ob er sich überhaupt für seine Bestellung interessierte.
»Natürlich bekommst du Geld dafür«, sagte er etwas leiser.
»Selbstverständlich«, pflichtete Frau Zakreys wärmstens bei.
»Du bist jung, mein Junge, und gerade erst an die Kunstakademie aufgenommen, ich kann dir also nicht soviel geben, als wenn du schon ausgelernt hättest.«
Adolf dachte voll Glück, daß er in einigen Jahren tatsächlich teurer sein würde. Zum ersten Mal verspürte er Interesse daran, älter zu werden.
»Ja, du bist jung. Man kann sogar sagen, daß ich gewissermaßen ein Risiko eingehe, wenn ich dich anstelle.«
»Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor«, unterbrach ihn Adolf. »Wir legen jetzt einen Preis fest. Wenn Ihnen das Schild gefällt, bezahlen Sie es. Wenn nicht, bezahlen Sie es nicht.«
Die Fleischersäuglein legten sich in Falten. Der Künstler sprach eine Sprache, die er verstand.
»Das gefällt mir, mein Junge. Ich kann dir auch einen Vorschlag machen, der dich vielleicht interessiert: Ich bezahle dich entweder in Geld oder in Naturalien. Zehn Silberschillinge, andernfalls zwei Würstchen pro Tag, ein Jahr lang, das ist dann mehr als zehn Schillinge.«
Frau Zakreys wiegte die Hüften.
»Das ist aber großzügig, Nepomuk.«
»Natürlich bekommt Frau Zakreys ihre kleine Kommission, sie hat uns schließlich bekanntgemacht.«
Die Wirtin gluckste vor Freude und ließ etwas auf tschechisch verlauten, das niemand verstand. Für Adolf war klar, daß die Witwe auf den bulligen Fleischer ein Auge geworfen hatte. Der Student war etwas verstimmt wegen des Kuhhandels, der ihm in keiner Weise seines Talentes würdig zu sein schien. Es war bald Essenszeit. Aus seinem Bauch stieß ihm sauer der Hunger auf. Er dachte mit Wonnen an ein Mittagessen.
»Ein Jahr lang Würstchen?«
»Ein Jahr lang Würstchen! Abgemacht, mein Junge!«
Und Adolf ließ es zu, daß Nepomuk mit der Planke, die den Tieren den Hals umdrehte, seine feine Künstlerhand zermalmte.
Gegen drei Uhr begab er sich in die Barbarossastraße, um seinem ersten Auftrag die Ehre zu erweisen. Nepomuk empfing ihn mit lauten Ausrufen und kräftigem Schulterklopfen, als ob er sein Schwager wäre.
»Komm, ich habe schon alles vorbereitet.«
Er zog ihn in den düsteren Hinterraum des Ladens, der nach Pisse roch.
»Hier, schau!« sagte er mit theatralisch ausladender Geste, stolz wie ein Zauberkünstler, der seinen ersten Trick vorgeführt hat und das Zeichen zum Applaus gibt.
Ein fürchterliches Schauspiel bot sich Adolf dar. Nepomuk hatte in der Tat alles vorbereitet. Auf einen Schemel hatte er das gehobelte Holzbrett gelegt, das als Ladenschild dienen sollte, und auf dem Arbeitstisch gegenüber hatte er selbst zusammengestellt, was auf das Bild gehörte: alle Spezialitäten des Hauses, eine neben der anderen aufgereiht – Schweinsköpfe, Rinderzungen, Spitzbein, Lammbregen, Leber, Herzen, Lungen, Nierchen, Würstchen, Blutwürste, Salamis, Mortadella, Schinken, Kuddeln, Kalbsohren, alles Erzeugnisse, die für den Stolz und das Gedeihen des Hauses Nepomuk sorgten.
Adolf schlug das Herz im Hals.
»Und das alles soll ich malen?«
»Warum denn nicht? Du kannst das doch, oder?«
»Ja, aber ich habe mehr an eine mythologische Szene gedacht, an einen Moment aus einer Oper von Wagner, wo …«
»Was redest du da, mein Junge? Ich will, daß du das malst, was ich meinen Kunden anzubieten habe. Nichts anderes. Jawohl! Und obendrüber meinen Namen. Bei dem kannst du dann zeigen, was für ein Künstler in dir steckt. Schließlich bezahle ich dich dafür.«
Adolf dachte daran, was Michelangelo durchlitten hatte, als er von dem grobschlächtigen Papst Julius II. herumkommandiert wurde. Sollte die Erniedrigung zu jeder Zeit das Geschick des Genies auf Erden sein? Er schluckte seinen Speichel herunter und nickte.
»Wieviel Zeit geben Sie mir?«
»Soviel du haben willst. Aber ich sage dir jetzt schon, nach drei Tagen fängt das Fleisch an zu stinken und die Farbe verändert sich.«
Der riesige Nepomuk brach in Gelächter aus, gab Adolf einen Klaps auf den Rücken und ging in den Laden zurück, wo bei dem Getöse, das die Hühner in ihren Käfigen veranstalteten, die Kundschaft auf ihn wartete.
Adolf sah sich seiner Zeichenkreide und seinen Pinseln ausgeliefert und geriet für einen Moment in Panik. Er wußte nicht, womit er beginnen sollte. Sollte er einen Hintergrund malen, bevor er die Gegenstände zeichnete? Oder umgekehrt? Kohle? Bleistift? Öl? Er wußte so verdammt wenig davon.
Also los! Er konnte kein Hochstapler sein, denn man hatte ihn an der Kunstakademie aufgenommen. Neunundsechzig Anwärter waren abgelehnt worden. Hatte er es verdient, daß man ihn aufgenommen hatte? Das mußte er unbedingt wissen.
Er gruppierte die Fleischstücke auf dem Arbeitstisch um, gab sich dabei alle Mühe, sie auf harmonische Weise anzuordnen. Schließlich stürzte er sich in die Arbeit. Er war ein anerkannter Maler, er würde es ihnen beweisen.
Drei Tage und drei Nächte lang verließ er Nepomuks Hinterraum lediglich für die unverzichtbaren Stunden des Schlafes. Seine Gedanken kreisten nur noch um diese Fleischbatzen, ihren Platz auf dem Brett, die Mischung der Farben, die Art, wie er das rosige Fleisch mit Weiß äderte, um das Fett des Schinkens zu assoziieren, wie er auf einem schwarzen Hintergrund Rot auftrug, um das tiefe Herz vor den Lendenstücken hervortreten zu lassen, wie er Beige über Grau zerstäubte, um das Schmalzfleisch schmackhaft zu machen, wie er mit dem Finger die dicken Bockwürste polierte und wie er einen harten Pinsel mit breit abstehenden Borsten fand, um das pockennarbige Fleisch der Salami wiederzugeben. Wie stets in seinen Anspannungsphasen hatte er aufgehört, jedwedes Essen zu sich zu nehmen, und ernährte sich ausschließlich vom Rauch der Pausenzigaretten.
Von Zeit zu Zeit kam der Fleischer und warf ein Auge darauf, welche Fortschritte sein Ladenschild machte. Anfangs skeptisch und kritisch, würdigte er es später eines respektvollen Schweigens.
Dem strengen Ammoniakgeruch mischte sich von nun an das Aroma des sich zersetzenden Fleisches bei. In dieser erdrückenden Hitze oxydierte und verfaulte das Fleisch rascher. Die am schwersten zu malenden Koteletts und Filetstücke stanken ernstlich wie ein Hund aus dem Maul. Ein schwer lastender, reglos stehender Geruch, ein vom Todeskampf niedergelassener Odem fixierte das Stilleben wie meergrüner Meisterfirnis. Adolf scherte sich nicht mehr um Müdigkeit, Ekel und Widerwillen. Fiebrig verfolgte er nur noch ein einziges Ziel: fertigwerden.
Die Gemälde Cranachs und Breughels, auf denen die Hölle als ein Schmorrost zu sehen war, schienen nun eine paradiesische Vision aus dem Jenseits zu sein. Die wahre Hölle, das war die Aufgabe, die ihn an dieses Loch von einem Fleischerladen festnagelte, um auf seinem Schild das wenige an Form zu erfassen, das diese Kadaverstücke noch ausschwitzten. Am fünften Tag hatte er es immer noch nicht geschafft. Ihm blieben nur noch ein paar Nachtstunden, weil ihn am nächsten Vormittag sein Unterricht an der Akademie erwartete: Das Studienjahr begann.
Er arbeitete wie ein Rasender. Seine Finger taten ihm weh, seine Pinsel hatten ihre dünne Haut wundgescheuert. Fast reflexartig fielen ihm die geschwollenen Augen zu. Was machte es schon! Er würde es zu Ende bringen.
Gegen Mitternacht hatte er die Bildkomposition beendet. Es blieben ihm nur noch die Buchstaben.
Am Morgen war das Schild fix und fertig. Der Tag brach an.
Um sechs Uhr kam Nepomuk aus seinem Zimmer und entdeckte das Werk.
Mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund ließ er während langer Minuten seinen prüfenden Blick über das Schild schweifen, baß erstaunt.
Adolf sah ihn an und stellte fest, daß Nepomuk tatsächlich einer dicken Wurst ähnelte, einer langen, hochgehaltenen dicken Wurst, abgeschlossen von einem kleinen, halslosen Kopf, einer Wurst in Wäsche, einer Wurst mit ein paar Brusthaaren, die unter dem Kragen hervorquollen.
»Ist das schön!«
Tränen der Freude und der Rührung rannen über Nepomuks Wangen.
Schau an, eine Wurst, die weint, ging es Adolf unwillkürlich durch den Kopf.
Die Wurst breitete die Arme aus und drückte den Maler mit Macht an sich.
Sodann ließ sich Nepomuk partout nicht davon abbringen, mit ihm gemeinsam zu frühstücken. Adolf sagte sich, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn er wieder etwas in den Bauch bekäme, denn in zwei Stunden würde seine erste Unterrichtsstunde beginnen.
Ohne mit der Wimper zu zucken, verschlang er alles, was ihm Nepomuk in seinen Pfannen briet, doch als Adolf versuchte, seinem Magen noch ein paar Tropfen Kaffee einzuverleiben, mußte er plötzlich nach Luft schnappen.
Ihm blieben nur Sekunden, um nach hinten in den Garten zu rennen, wo er in einem einzigen Schwall Nepomuks ganzen Laden erbrach.
Nie wieder! Nie wieder! Das stand fest. Von diesem Tag an würde er nie wieder Fleisch essen. Er würde Vegetarier werden. Für immer!
Er stürzte zurück zu Frau Zakreys’ Haus, wusch sich eilig am Waschbecken und zog sich um. Trotz der sauberen Wäsche und trotz seiner Waschungen war er überzeugt davon, noch nach Zersetzung zu riechen.
Dann rannte er zur Akademie.
Er hatte nur fünf Minuten für die Wiederbegegnung mit seinen Freunden, da läutete es schon, und sie mußten hinauf in Saal fünf, ins Atelier.
Der Saal, den sie betraten, war überheizt. Nahe einem mit Kissen bedeckten Podest verbreitete ein Ofen eine lähmende Hitze.
Jeder Student nahm hinter einer Staffelei Aufstellung. Der Professor reichte ihnen Zeichenkohle.
Eine Frau trat ein, im Kimono, sie stieg auf das Podest, und unversehens öffnete sie den Gürtel und ließ die Seide auf den Boden gleiten.
Adolf H. traute seinen Augen nicht. Er hatte noch nie zuvor eine nackte Frau gesehen. Es war heiß, zu heiß. Sie war schön und glatt, ohne ein Härchen auf dem goldbraunen Körper.
Wie eine Wurst.
Das war das letzte, was Adolf dachte, bevor er ohnmächtig auf dem Fußboden aufschlug.
In wenigen Minuten wird er reich sein.
Die Woche ist schnell vergangen, wie ein Säuseln im Wind. Zwar hat er warten müssen, aber mit der Gewißheit zu gewinnen sind ihm diese langen, leeren Tage zum grellen Blitz geworden. Mit seinem heißen, feuchten Los in der Hand wartet Hitler auf den Lotterieaushang.
Wer den Glauben im Herzen hat, dem gehört die stärkste Kraft der Welt. Diese den Lippen seiner angebeteten Mutter abgelauschten Worte sind ihm Stütze gewesen, um sich aufrecht zu halten, moralisches Regime wie auch Ernährungsregime. Er hat Hunger gelitten, und er hat die Prüfung seines Scheiterns überstanden: Er glaubt wieder an sich und sein Schicksal.
Der Lotteriebeamte tritt auf die Straße und schließt den Glaskasten auf, in dem er die Zahlen aushängen wird.
Hitler hüpft das Herz. Er tritt heran.
Er versteht nicht.
Wo ist der Fehler? Auf seinem Los? Auf dem Aushang? Aber es gibt einen Fehler, Hitler weiß es mit Bestimmtheit, weil ein Abkommen geschlossen ist zwischen dem Himmel, seiner Mutter und ihm, ein heiliger Pakt, der ihn gewinnen lassen soll. Und nur um dieses Preises, um dieser Entschädigung willen ist Hitler nicht an der Kunstakademie aufgenommen worden. Das jedenfalls ist klar.
Der Fehler bleibt.
Hitler hat zwanzigmal die Zahlen verglichen, Ziffer für Ziffer, vor- und rückwärts. Nichts zu machen. Die Abweichung bleibt. Wird noch größer. Noch bestimmter.
Hitler ergreifen bleierne Schwere, Kälte und Ohnmacht.
Die Wirklichkeit hat ihn eingeholt. Die Magie ist verflogen.
Das Universum hat keines seiner Versprechen gehalten. Hitler ist allein auf der Welt.
Seine Kameraden waren alle tief beeindruckt von dem, was Adolf H. erzählte. Mit neunzehn Jahren einen ersten Bildauftrag ergattert! Und noch dazu Christi Geburt in einer Privatkapelle! Bei einem Grafen! So berühmt, daß Adolf sich weigerte, seinen Namen zu nennen! Die Geschichte machte unter den neu immatrikulierten Studenten schnell die Runde. Ebenso schnell wie die seiner Ohnmacht.
Vor dem nächsten Aktzeichnen fürchtete er sich. Wenn er vor der sich schamlos darbietenden Frau wieder verlegen würde, wüßte man endgültig, daß er eine puritanische Jungfer war.
Daher nutzte er jede freie Stunde, um in seinem Zimmer nackte Frauen abzuzeichnen, die er in einem Sammelband mit Radierungen gefunden hatte. Er wollte seine Erregung bezähmen. Einen Schenkel, die geschwungene Linie einer Brust zu zeichnen schenkte ihm große Gefühle, spannte seine Hose und ließ ihn sogar in einsame Ekstase geraten, aber er wurde nicht ohnmächtig dabei. Würde das genügen? Geschützt durch seine Einsamkeit, die Wände seines Zimmers und den Umstand, daß er mit seinem Stift lediglich Linien wiedergab, würde es ihm womöglich gelingen, sich zu bezähmen. Er konnte aber nicht sicher sein, daß ihm vor dem zuckenden Fleisch der so furchterregend nahen, so gegenwärtigen und nackten Weibsperson nicht wieder schummerig würde.
Es kam die Schicksalsstunde.
Die Studenten strömten in das überheizte Atelier. Hinter allen anderen trat Adolf fast tapsend an seine Staffelei.
Das Modell stieg auf das Podest.
Ein Raunen der Enttäuschung war zu vernehmen.
Es war ein Mann.
Anmaßend, das Kinn vorgestreckt, das Gesicht verschlossen, die Augen fast zugekniffen, entschieden gleichgültig vor der Unzufriedenheit dieser vierzig brünstigen jungen Männer zog er seine Unterhose aus, ließ seine fettlosen Muskeln spielen und nahm ungezwungen eine athletische Pose ein.
Adolf war so erleichtert, wie er es nicht zu hoffen gewagt hatte. Mit einem Lächeln betrachtete er seine Kameraden, die ihm in ihrer Enttäuschung nicht die geringste Aufmerksamkeit schenkten.
Adolf nahm sein Stück Zeichenkohle und machte sich ans Werk.
In einer Ecke des Ateliers breitete sich Unruhe aus. Ein paar Studenten machten mit leisem Gezischel ihrer Empörung Luft.
Nachdem er sich vergewissert hatte, daß es nicht gegen ihn gerichtet war, beachtete Adolf diese Gruppe nicht weiter und konzentrierte sich auf seine Zeichnung.
Doch die Handvoll junger Männer kratzte laut mit ihrer Zeichenkohle, packte ihre Sachen zusammen, marschierte geräuschvoll zur Tür und rief, bevor sie den Saal verließ, dem Professor empört zu:
»Das ist unannehmbar! Absolut unannehmbar!«
Der Professor wandte sich weg, als hätte er nichts gehört, und auf dem Gipfel ihrer Wut warfen die Studenten laut die Tür hinter sich zu.
Adolf H. beugte sich zu seinem Nachbarn, Rudolph.
»Was haben sie denn?«
»Sie weigern sich, dieses Modell zu zeichnen.«
»Wieso? Weil es ein Mann ist?«
Rudolph verzog das Gesicht, um zu bedeuten, daß er das Verhalten dieser Kommilitonen verurteilte.
»Nein. Weil es ein Jude ist.«
Adolf war verblüfft.
»Ein Jude? Ja, aber woher wissen die denn das?«
Er irrte durch die Straßen von Wien. Von allem Verlangen frei, die Augen an die Schuhspitzen geheftet, sah er nichts, hörte nichts und aß kaum einen Bissen. Wenn er merkte, daß ihn die Kräfte verließen, knabberte er eilig ein paar an der nächsten Ecke gekaufte Kastanien, und manchmal trank er ein Bier dazu. Erst spät in der Nacht kehrte er zu Frau Zakreys zurück. Selbst wenn er die Tür ohne einen Laut öffnete und auf Zehenspitzen durch den Korridor ging, stürzte sich sich auf ihn und schimpfte auf ihn ein, sie wolle endlich ihre Miete haben. Er hielt sie mit Versprechungen hin, vorgetragen mit tonloser Stimme, um den Rückzug in sein Zimmer zu decken. Doch Frau Zakreys glaubte ihm nicht mehr und drohte, ihre Vettern zu rufen, rohe Kerle, die auf dem Markt arbeiteten und mit ihm Tacheles reden würden.
Natürlich könnte er einen Bettelbrief an seine Tante Johanna schreiben und sie bitten, ihm aus der Verlegenheit zu helfen. Aber auch damit käme er nicht aus der Sackgasse heraus. Selbst wenn sie noch einen Monat bezahlte, noch zwei, noch drei, noch sechs Monate – was würde aus ihm werden?
Sein größter Schmerz rührt daher, daß er nicht mehr wußte, was er von sich selbst halten sollte. Bisher hatte er nie an sich gezweifelt. Widerstände, Szenen, das kannte er. Beleidigungen, abfällige Bemerkungen, das hatte er einstecken können. Aber nichts hatte je sein Selbstvertrauen erschüttern können. Er hielt sich für einzigartig, für einen Ausnahmemenschen, der über dem Schicksal steht, reicher an einer ruhmvollen Zukunft als irgendwer sonst, und er hatte sich damit begnügt, jene, die das noch nicht begriffen hatten, zu bedauern. Vor seinem Vater, dem kleinen Beamten und beschränkten, jähzornigen Nörgler, dann, nach dessen Tod, vor seinem viel zu nachgiebigen Vormund hatte Hitler sich immer mit den Augen seiner Mutter gesehen, Augen, die voll von Bewunderung und phantastischen Träumen waren. Er liebte sich, er sah sich rein, idealistisch, einmalig, stets geleitet von seinem hell leuchtenden guten Stern. Mit einem Wort: Er war allen anderen überlegen. Doch seine Mutter war im Winter zuvor gestorben, und nach dem, was die Akademie und dann die Lotterie gebracht hatten, war sein Blick erloschen.
An Hitler nagte nun der Selbstzweifel. Und was, wenn er mehr Zeit daran verschwendet hatte, sich zu überzeugen, daß er ein Maler sei, als daran effektiv zu arbeiten? Es ist schon wahr, daß er in den letzten Monaten fast überhaupt nichts gemalt hatte … Und was, wenn er seine Energie mehr darin investiert hatte, sich für etwas Besonderes zu halten, anstatt es wirklich zu beweisen?
Diese Gewissensprüfung wirkte verheerend auf ihn.
Bei manchen Menschen mag die Intelligenz durch den Selbstzweifel aufleben, bei Hitler jedoch ging sie geschwächt daraus hervor. Ohne Begeisterung, ohne Leidenschaft brachte er keine drei Gedanken zusammen. Sein Geist funktionierte nur im Überschwang. Abgewatscht von der Wirklichkeit, seiner Träume und seines Ehrgeizes beraubt, funktionierte sein Hirn nur noch wie das einer Auster.
Am Morgen war Frau Zakreys mit schaukelndem Busen unter ihrem knallroten Nachthemd in Hitlers Zimmer eingedrungen und hatte so alle stillschweigenden Abmachungen gebrochen, die ihr untersagten, dieses Revier zu betreten.
»Mein lieber Herr Hitler, wenn ich nicht in zwei Tagen das Geld habe, lasse ich Sie dreikantig rausschmeißen. Ich will keine Versprechungen mehr, ich will meine Miete.«
Türknallend ging sie zurück, woher sie gekommen war, und ließ ihren Ärger an den laut scheppernden Töpfen aus.
Dieser Überfall hatte für Hitler eine heilsame Wirkung. Anstatt sich von neuem in Grübeleien über sich selbst zu verlieren, konzentrierte er sich auf ein konkretes Problem: wie er seine Untermiete an Frau Zakreys zahlen sollte.
Er trat auf die Straße hinaus und schaute diesmal um sich. Er mußte Arbeit finden.
Wien war erstarrt in schmutzigem Novemberwetter. Eine graue, zähe Kälte ließ die Atmosphäre abbinden wie Zement. Von den Bäumen fielen die letzten Blätter, die seltenen Hecken lichteten sich, Äste und Stämme ächzten. Die Alleen, kaum noch grün oder blütengeschmückt, wurden zu Friedhofswegen, das alte Laubwerk reckte seine trockenen Finger zum Schieferhimmel, und die Steine wurden zur Grabplatte.
Hitler studierte aufmerksam die Stellenanzeigen der Geschäfte. Man suchte Verkäufer, Kassierer und Lieferburschen. Er dachte an die mannigfaltigen menschlichen Beziehungen, die er dann eingehen müßte, an die Liebenswürdigkeit, zu der er gezwungen wäre, und er fühlte sich schon im voraus ausgelaugt.
Er wollte auch nichts mehr vom Schicksal eines Tintenklecksers wissen, selbst wenn es ein geruhsames Leben wäre, denn das hieße, sich dreinschicken zu müssen in das, was er an seinem Vater immer abgelehnt hatte. Niemals! Jedenfalls war er weder auf einen Beruf noch auf eine Karriere aus, sondern nur auf ein bißchen Geld, um Frau Zakreys zu bezahlen.
Er erblickte eine Baustelle, ein inmitten der Fassaden klaffendes Loch, wie ein fehlender Reißzahn im gesunden Gebiß der Stadt.
Auf einem Brett balancierend, sang fröhlich ein brünetter Mann und schichtete Ziegelsteine aufeinander. Die schöne Stimme, matt, weich und mediterran, verbreitete zwischen den Mauern einen Hauch von italienischer Sorglosigkeit. Andere Arbeiter, Tschechen, Slowaken, Polen, Serben, Rumänen und Ruthenen, reichten sich Bretter, Ziegelsteine, Säcke und Nägel, wobei sie sich in einem entstellten, rudimentären Deutsch verständigten.
Angezogen von der Stimme des Maurers, trat Hitler näher.
»Gibt es hier auf der Baustelle Arbeit für mich?«
Der Italiener hörte zu singen auf und lächelte Hitler breit an.
»Was kannst du denn?«
Hitler kam es vor, als heizte das Lächeln des Italieners sogar die kalte Luft auf.
»Vor allem malen.«
Im Gesicht des Italieners zeigte sich eine leichte Enttäuschung. Hitler beeilte sich hinzuzufügen:
»Ich kann auch was anderes machen. Ich muß mir mein Brot verdienen«, fügte er mit gesenktem Kopf hinzu.
Die Arbeiter brachen in Gelächter aus. Sie fragten sich, wie lange es her sein mochte, daß sich dieser magere Schlaks mit wächserner Haut das letzte Mal sattgegessen hatte.
Eine heiße Hand griff ihn bei der Schulter und drückte ihn gegen einen lebendigen Brustkorb. Guido schloß ihn in die Arme.
»Also, mein Jungchen, wir werden schon irgendwas für dich finden.«
Für einen Moment legte Hitler den Kopf an die Brust des Italieners. Zu seiner großen Überraschung roch der Mann gut – eine Lavendelfrische, die ihn an den Wäscheschrank seiner Mutter erinnerte. Er ließ sich bei der Hand nehmen und mit einem Schulterklopfen zum Vorarbeiter führen.
Obwohl ihm körperliche Kontakte ein Graus waren, hatte Hitler es bei dem Italiener geschehenlassen. Es war ohne Bedeutung, es war ja ein Ausländer. Und zudem – welch unverhofftes Glück!– war er auf dieser Baustelle ausschließlich mit Ausländern zusammen. Nicht nur, daß ihn niemand aus Wien wiedererkennen würde, schon allein seine Nationalität machte ihn all diesen Männern überlegen. Hitler wurde eingestellt und arbeitete fortan für Guido als Mörtelmischer.
Selbstverständlich ließ er Frau Zakreys nichts von seiner neuen Situation wissen. Er begnügte sich damit, ihr die Miete zu zahlen, und suchte sie wegen ihres vorangegangenen Benehmens zu beschämen. Mit belegter Stimme murmelte die tschechische Witwe ein paar entschuldigende Worte, vollkommen zufriedengestellt durch die kühle Berührung der Geldstücke.
Hitler waren seine Tage auf der Baustelle keineswegs unlieb. Im Gegenteil, er hatte den Eindruck, es wäre nicht er, der das Wasser in den Zement mischte. Er fühlte sich fast wie in den Ferien, wie von sich selbst befreit.
Ohne recht zu begreifen, warum, schätzte er Guido. Die ewigwährende Fröhlichkeit des Italieners, sein entwaffnendes Lächeln, seine Lachfältchen, seine behaarte Brust, die er ganz ungeniert darbot, die kraftvolle Männlichkeit, die in ihm explodierte und die seine Stimme und seine Gebärden leitete, sein langgezogenes, klangvolles Italienisch, seine zu jeder Kraftanstrengung fähigen Arme und Schenkel, all das wärmte Hitler wie ein strahlender Sonnentag mitten im Winter. Hitler wärmte sich an ihm, er sammelte neue Kraft, er sog seinen Humor in sich auf, manchmal lächelte er sogar.
Guido mochte diesen »kleinen Österreicher« gern, aber einfach so, nicht mehr als die anderen, so wie er alle gern hatte. Hitler schätzte sehr die ununterschiedene Zuneigung, diese Gutmütigkeit, die ihn nicht allzusehr verpflichtete. Es ließ sich gut leben in der Luft, die Guido atmete.
Manchmal gingen sie nach der Arbeit einen Krug Bier trinken. Hitler half Guido, sein Deutsch zu verbessern. Ihm kam dieser Rollenwechsel zupaß: Am Abend, anders als tagsüber, war es Guido, der ihm gehorchte. Er liebte es, daß die Lippen des Italieners die Worte wiederholten, die er ihm diktierte, er liebte es, daß es sich der Italiener zum Ziel machte, ihm nachzusprechen, er liebte das laute Lachen, mit dem er seine Fehler quittierte, er liebte auch am Ende jeder Lektion den verzweifelten Seufzer Guidos, der in seinem fröhlichen, mit den Farben und Gewürzen seines heimatlichen Venetien angereicherten Deutsch murmelte, er würde es wohl nie schaffen, die Sprache Goethes zu sprechen. Hitler genoß dann eine absolute und anerkannte Überlegenheit, und er war Guido so dankbar, daß er die richtigen Worte fand, um ihn zu ermutigen, bis zur nächsten Lektion durchzuhalten.
Im Moment des Auseinandergehens fragte Guido immer wieder, wo Hitler wohnte. Hitler wich der Frage aus, er wollte vor allem nicht, daß Guido mit seiner proletarischen Freimütigkeit in das Zimmer eindränge, wo er sich noch einen Kunststudenten wähnen durfte. Als Guido ihm vorschlug, den Huren einen Besuch abzustatten, mußte Hitler erfinden, er wäre schon verheiratet und würde jeden Abend bei seiner Frau sein müssen.
Guido warf dann einen flüchtigen Blick auf die kleinen Hände, an denen keine Spur von einem Ehering war, schluckte aber die Lüge. Er begnügte sich damit, ihm verschwörerisch zuzuzwinkern und zu murmeln:
»Das macht nichts. Solltest du mal Lust haben, nehme ich dich mit. Ich bin mir sicher, du weißt noch nicht einmal, wo das ist.«
Hitler war ganz verblüfft. Er war gegen die Prostitution, er wünschte nicht, einer dieser käuflichen Frauen zu begegnen, und Guido hatte richtig beobachtet: Er wußte nicht einmal, wo sich das Rotlichtviertel überhaupt befand. Er fühlte sich in flagranti bei seiner mangelnden Männlichkeit erwischt.
Es wurde langsam Winter. Nichts an Guidos Lebensfreude änderte sich. Er und Hitler waren fast nicht mehr auseinanderzubringen.
Eines Freitags brachte Hitler es fertig, Guido etwas Wichtiges zu sagen: daß er einen sehr schönen Verdi-Bariton habe, der es nicht verdiene, auf einer Baustelle zu bleiben, und daß er Opernsänger werden solle.
»Bah, in meiner Familie haben sie alle eine Stimme wie ich«, sagte Guido mit einem Achselzucken, »und der Maurerberuf geht bei uns über vom Vater auf den Sohn!«
»Aber trotzdem, ich gehe viel in die Oper, und ich versichere dir …«
»Laß gut sein! Unsereins wird kein Künstler. Man muß dafür die Begabung haben. Man muß da hineingeboren sein.«
Das bereitete dem Gespräch, zu dem Hitler angesetzt hatte, ein jähes Ende. Nach diesem Kompliment an die Adresse Guidos hatte er zu ihm von seinen eigenen Talenten als Maler sprechen wollen. Guido hatte verstehen sollen, daß sie beide grundverschieden seien, aber Guido hatte die Herzensergießung bereits für beendet erklärt, indem er keinen Widerspruch duldend resümierte: »Unsereins wird kein Künstler.«
Mit jedem Abend zog Guido ihn ein paar Schritte näher zum Prostituiertenviertel. Mit einem breiten Lächeln sagte er zu ihm:
»Nur, weil du verheiratet bist, verbietet dir doch keiner das Recht auf ein paar kleine Freuden.«
Hitler wehrte sich standhaft gegen die Vorschläge seines Kameraden, verlor aber an Terrain und trat zu guter Letzt dann doch über die Schwelle eines Bordells.
In diesem verräucherten Saal, inmitten der Mädchen mit dem verführerischen Lächeln, den liebkosenden Gesten, dem beständigen Hüftenschwingen, den unglaublichen Dekolletés und den allzu leichtfertig gespreizten Beinen, fühlte sich Hitler augenblicklich unwohl.
Guido bedeutete den Mädchen, sie sollten seinen Freund in Ruhe lassen, er sei nur aus Gefälligkeit mitgekommen und sei auf nichts aus.
Das hielt die Mädchen ein bißchen im Zaum, ohne allerdings allzuviel an Hitlers Unwohlsein zu ändern: Wo sollte er hinschauen, ohne sich zu beschmutzen? Worauf die Augen ruhen lassen, ohne zum Komplizen dieses herabwürdigenden Schauspiels zu werden? Ja, wie atmen, ohne die Schande auch einzuatmen?
Guido hatte drei Frauen auf seinen Knien sitzen, und alle machten sie sich glucksend das Recht streitig, mit ihm aufs Zimmer zu gehen.
Hitler erkannte seinen Freund nicht wieder. Was er an Guido geliebt hatte, das war Italien. Das prunkhafte und einfache, lebendige und dekadente Italien, wo in der Stimme eines Proleten immer auch das Gold der Oper mitschwang. An diesem Abend aber liebte er Guido nicht mehr, er liebte Italien nicht mehr, er sah darin nur noch die Vulgarität, die plumpe, fleischliche, dampfende und unverstellte Vulgarität. Er dagegen fühlte sich ganz im Gegenteil rein, sittenstreng, germanisch.
Um seine innerliche Enttäuschung niederzuringen und sich nach außen hin gelassen zu geben, nahm er ein Stück Zeichenkohle, und auf der Papiertischdecke malte er Guido, wie er ihn sah: ein nach dem Geschlechtlichen stinkender Satan.
Er zeichnete wie rasend, kringelte eine Locke, umsäumte den Mund, schwärzte das Auge, umschattete die hervorspringenden Erhabenheiten des venetischen Gesichtes, spie seinen Haß auf diese triviale Schönheit aufs Papier.
Unversehens bemerkte er, daß sich um ihn alles verändert hatte. Jedermann schwieg, alle waren sie herangetreten. Man sah dem jungen Mann zu, wie er in loderndem Trancezustand das Porträt des Italieners malte.
Hitler schrak auf und wandte voll Scham den Blick ab, wütend auf sich, weil er sich dazu hatte hinreißen lassen, seine innersten Gedanken zu verraten. Er fühlte sich entdeckt. Man würde ihm seine Verachtung vorwerfen.
»Das ist großartig!« rief ein Mädchen aus.
»Noch schöner als das Modell«, flüsterte eine andere.
»Das ist unglaublich, Adolfo. Du bist ein echter Maler.«
Guido blickte seinen Kameraden voller Bewunderung an. Er hätte vermutlich kein erstaunteres Gesicht gemacht, wenn er erfahren hätte, daß Hitler Milliardär wäre.
»Du bist ein echter Maler, Adolfo, ein echter Maler!«
Hitler stand abrupt auf. Alle sahen ihn voller Furcht an. Er fühlte sich bestens.
»Natürlich bin ich ein echter Maler!«
Das Stück der Papiertischdecke, auf dem die Skizze war, riß er ab und reichte es Guido.
»Hier! Schenke ich dir.«
Dann machte er auf der Stelle kehrt und ging. Er wußte, er würde Guido nie wiedersehen.
Er war wieder ohnmächtig geworden.
Obwohl es ihm am Anfang noch gelungen war, eine regelmäßige Atmung zu bewahren, als die Seide des Morgenrocks wie ein Fluch zu Boden glitt. Die Frau hatte anmutig ihren Haarknoten zurückgehalten, der sich wie der Morgenrock öffnen wollte, und schelmisch, den Ellbogen in der Luft, zwischen Vorwitzigkeit und Verschüchterung, wandte sie ihren Rücken und die nackten Pobacken den Anwesenden zu.
Adolf H. hatte seine ersten Striche voller Unruhe hingeworfen, mit Umsicht, so wie man sich davor fürchtet, ins kalte Wasser zu tauchen. Er lauerte schon darauf, daß ihm das Ungemach passieren würde. Er zeichnete mit dem breiten Ende der Zeichenkohle, überzeugt, daß eine genauere Skizze ihn wieder das Bewußtsein verlieren lassen würde. Doch nichts Schreckliches geschah in ihm. In Ruhe konnte er sich innerlich abklopfen und abhorchen, er fühlte keine Ohnmacht nahen. Er hatte also wieder Selbstvertrauen gewonnen und malte mit festerer Hand.
Mit dicken, betonten Strichen umriß er die Fleischsilhouette. Sodann skizzierte er die Pobacken und die wohlgerundeten Konturen der Schenkel. Schließlich legte er alle Leidenschaft darein, daß ihm das Haar gut gelänge. In der zehnten Minute hatte er es geschafft. Auf seinem Zeichenkarton war eine Skizze festgehalten, die ihn an Leonardos Stich Leda und der Schwan erinnerte.
Der Professor ließ das Glöckchen erschallen. Die Studenten nahmen ein neues Blatt. Das Modell drehte sich um.
Es war nicht genug Zeit für Adolf, was nun folgte, unter Kontrolle zu bekommen. Auf der Suche nach einer Pose schweifte die Hand der Frau über Brust und Bauch, Adolf sah dem Weg der Hand hinterher, er wurde von einer jähen Kraft geschüttelt, ihm schwanden die Sinne, und er sackte zusammen.
Die nächste Malstunde wurde von allen Teilnehmern mit Spannung erwartet. Professoren, Hospitanten, Schüler aller Studienjahre, jeder kannte die Geschichte von dem jungfräulichen Neuen, der bei einer nackten Frau ohnmächtig wurde.
Adolf stieg die Treppe hinauf, die zur schicksalhaften Malstunde führte, wie ein Verurteilter, der an die Erschießungsmauer tritt. Seine Gedanken brodelten schon, ein Teil von ihm wollte dieses Mal dem Ungemach widerstehen, ein anderer Teil wollte ihm so schnell wie möglich nachgeben.
Wenn es passiert, soll es schnell passieren! Damit es vorbei ist!
Mit gesenktem Kopf nahm er vor seinem Zeichenkarton Aufstellung.
Die Frau erhob sich, und die Stille wurde schwer, vollkommen, kompakt. Man glaubte, einen Trommelwirbel zu hören.
Die Frau trat nach vorn, an den Rand des Podestes. Sie blieb vor Adolf stehen und faßte ihn ins Auge. Langsam nestelte sie am Gürtel ihres Kimonos, wie um mit ihrer Geste zu zielen und im richtigen Moment abzudrücken.
Plötzlich ging der Schuß los. Die Seide glitt herunter, das nackte Fleisch erschien in einem perlmutternen Auflodern, und Adolf wurde hingestreckt. Er fiel so schnell, daß er gar nicht mehr das ohrenbetäubende »Hurra« hörte, das sich den Brüsten all der begeisterten Kunststudenten entrang.
Am Abend dann, in der verräucherten Einsamkeit seiner Kammer, dachte er nach. So konnte es nicht weitergehen. Er konnte nicht drei Jahre lang immer wieder ohnmächtig werden und sich zum Gespött der Leute machen. Er mußte etwas unternehmen, daß er gesund würde.
Gesund? Das Wort war ihm gerade erst in den Kopf gekommen. Er stürzte an den Schreibtisch und schrieb unverzüglich einen Brief an Doktor Bloch.
Adolf hatte echtes Vertrauen zu ihm, nachdem er sich so um seine Mutter bemüht hatte. Es war mehr ein Vertrauen zu dem Menschen als ein Vertrauen zu dem Mediziner. Adolf machte sich keine Illusionen über seine Möglichkeiten, die Krankheit zu besiegen. Aber er hatte mit Anerkennung verfolgt, wie Doktor Bloch seine geliebte Mutter begleitet und ihr Leiden erleichtert hatte.
In der kurzen Mitteilung, die er verfaßte, gab er keinerlei Details preis; er begnügte sich damit, Dr. Bloch hinlänglich seine Furcht und seine Beunruhigung zu verdeutlichen sowie seinen Wunsch, rasch bei ihm vorzusprechen.
In der Woche darauf beschloß Adolf, dem Risiko, das mit dem Aktzeichnen verbunden war, aus dem Wege zu gehen. Er ging schon am Vortag nicht in die Kunstakademie, sondern schickte statt dessen Frau Zakreys mit einem Zettel dorthin und schob eine Magenverstimmung vor.
Am Tag selbst dann, als er sich in seinem Bett wälzte, war die Überraschung groß, als er die fröhliche Stimme Doktor Blochs in seinem Korridor sprudeln hörte.
»Adolf, sofort, als ich deinen Brief bekommen habe, bin ich nach Wien losgefahren.«
Der Arzt, ein großgewachsener Mann mit markanter Nase und schönen Augenbrauen von bläulich schimmerndem Schwarz, die, wie auch das Gestrubbel seines Schnauzers und die Halskrause seines Vollbartes, mit Tusche gezeichnet zu sein schienen, lächelte Adolf über die ganze Breite seines granatfarbenen, zart geränderten Mundes an, der seine weiblichen Patienten in Linz zerschmelzen ließ. Adolf war bewegt: Jemand war zu ihm geeilt, jemand hatte an ihn gedacht, und ihm war, als wäre er einem Familienangehörigen wiederbegegnet.
Doktor Bloch trat in das Zimmer des jungen Mannes und sprach zunächst von belanglosen Kleinigkeiten. Adolf mochte diese ernste, warme, vibrierende Stimme, bei der sich sofort Vertrautheit einstellte.
»Nun gut, Adolf, woran leidest du?«
»An nichts«, antwortete er, weil er sich schlagartig gut fühlte.
»Dein Brief hat da einen ganz anderen Eindruck auf mich gemacht.«
Doktor Bloch setzte sich und sah den Jungen aufmerksam an.
»Sag mir, was los ist.«
Adolf hatte geglaubt, er würde es nie schaffen, jemandem seine peinliche Geschichte darzulegen, aber unter dem wohlwollenden Blick des Vierzigjährigen überschlugen sich die Worte fast, und alles war rasch erzählt. Mit jedem gesagten Wort fiel Adolf eine Last vom Herzen, weil sein Problem nun nicht mehr allein bei ihm lag. Jetzt war Doktor Bloch am Zug.
Dieser kratzte sich, als er alles gehört hatte, lange am Kopf. Mit ein paar Fragen vergewisserte er sich, daß Adolf vor seinen Ohnmachtsanfällen gut getrunken und angemessen gegessen hatte, und nachdem ihm dies bestätigt worden war, wurde er nachdenklich.
Adolf H. fühlte sich von nun an ausgesprochen wohl. Er hatte Vertrauen. Er verspürte sogar etwas wie Ungeduld, die Diagnose und das Heilmittel Doktor Blochs zu erfahren.
Der Arzt machte ein paar zögernde Schritte um das Bett herum.
»Adolf, antworte mir wie einem großen Bruder, der dich liebt: Hast du schon mal mit einer Frau geschlafen?«
»Nein.«
»Und hast du Lust dazu?«
»Nein.«
»Weißt du, weshalb?«
»Ich habe Angst.«
Doktor Bloch lief noch vier oder fünf Mal um das Bett.
Adolf fragte ihn in fröhlichem Ton:
»Nun? Was habe ich?«
Doktor Bloch ließ sich Zeit mit seiner Antwort.
»Du hast etwas, das sich heilen läßt, keine Angst. Ich würde gern mit dir zu einem Spezialisten gehen.«
»Einem Spezialisten?« rief Adolf beunruhigt aus.
»Wenn du dir das Bein brichst, schicke ich dich zu einem Chirurgen. Wenn du zu stark hustest, schicke ich dich zu einem Lungenspezialisten. Ich würde dich daher zu einem Spezialisten für deine Krankheit mitnehmen wollen.«
»Einverstanden!«
Adolf war beruhigt. Die Wissenschaft würde sich um ihn kümmern. Das war alles, was er wissen wollte.
Doktor Bloch verschwand für eine Stunde, dann kam er zurück und kündigte Adolf an, daß er um achtzehn Uhr einen Termin habe.
Adolf verbrachte den Nachmittag mit Lesen und Rauchen, um siebzehn Uhr dreißig dann traf er sich, so wie verabredet, mit Doktor Bloch am Ende der Straße.
Sie liefen noch ein paar Meter weiter, bis zur Nummer 18, dort gingen sie hinauf in den ersten Stock und klingelten.
Die Tür öffnete sich einen Spalt weit, und ein Kopf tauchte auf.
Doktor Bloch, die Hand auf der Schulter des jungen Mannes, sagte zu dem Arzt höflich:
»Doktor Freud, ich stelle Ihnen Adolf Hitler vor.«
Hitler kehrte nie auf die Baustelle zurück.
Der Abend bei den Prostituierten hatte ihn gerettet. So war er daran erinnert worden, daß er nicht wie die anderen war. In nichts. Er scherte sich nicht darum, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, es verlangte ihn nicht danach, mit einer Frau zu schlafen, er wollte sich nicht in die bestehende Ordnung einfügen.
Wie hatte er sich so weit vergessen können? Was für eine seltsame Macht verströmte dieser Guido? Was für ein verfänglicher und verderblicher Charme hatte ihn, einen Künstler, einen Maler, einen Außenseiter, fast dazu gebracht, wieder die gewöhnlichen Pfade des Lebens einzuschlagen, sich bei einer schwachsinnigen Plackerei zu verausgaben, zu essen und zu schlafen, um auf törichte Weise seine Arbeitskraft wiederherzustellen, in überfüllten Kneipen Bier zu trinken und geistlose Gespräche zu führen, Rotlichtviertel aufzusuchen, um sich vielleicht an einem Abend zu beweisen, daß er auf ganz vulgäre Weise ein Mann war? Hitler hätte sich beinahe in einem banalen Dasein aufgelöst wie ein Stück Zucker in Wasser. Er war im letzten Augenblick durch seine Skizze und die bewundernden Reaktionen der Zweifüßler gerettet worden.
»Ich bin Maler! Ich bin Maler! Ich darf das nicht vergessen«, sagte er immer wieder laut vor sich hin.
Er wiederholte es so oft, bis er davon ganz berauscht war.
Nachdem er dieser großen Gefahr – dem gewöhnlichen Leben – um Haaresbreite entronnen war, beeilte er sich zu genesen. Er nahm seine langen Rauchabende wieder auf, im Straßenanzug auf dem Bett, um nachzusinnen oder aber um mit einem aufgeschlagen vor ihm liegenden Buch vor sich hin zu träumen. Um Frau Zakreys hinters Licht zu führen und weiter im Glauben zu lassen, er würde den Unterricht an der Kunstakademie besuchen, unternahm er ausgedehnte Spaziergänge durch Wien oder wärmte sich in der Bibliothek auf.
Es blieb ihm nicht mehr viel Geld, vor allem aber wollte er es nicht sparen. Niemals!, dachte er. Nie wieder wie die anderen! Nie wieder sinnen und denken wie die anderen!
Er leistete sich, Schlag auf Schlag, drei Opernabende hintereinander. Wagner übertraf wie immer seine kühnsten Erwartungen. Hitler hörte diese Musik nicht, sondern er sog sie in sich auf, er trank sie, er badete in ihr. Die harmonischen Fluten der Streicher und Holzbläser überschwemmten ihn in aufeinanderfolgenden Wogen, er wälzte sich, verlor sich darin, doch wachsam, ausdauernd und leuchtend waren die Stimmen der Leuchtturm in der Ferne, der den in Seenot geratenen Schiffen den Kurs wies. Hitler kannte den gesamten Text auswendig, diese Erhabenheit, dieses Heldentum beglückten ihn, bei dieser Tapferkeit fand er zu sich selbst zurück. Er war danach »wie vorher«.
Am dritten Abend stand auf dem Programm der Wiener Oper leider Bizets Carmen, ein Stück, das Hitler noch nie gehört hatte, und er flüchtete nach dem ersten Akt, abgestoßen, ja regelrecht angewidert von dieser lärmenden, bunten und hüftenschwingenden Musik, von dieser aufreizenden Brünetten, die auf ihrem Schenkel Zigarren drehte und mit rauchiger Stimme alberne Arien grölte, ein Schauspiel, das ihn nur zu sehr an die Hurenkneipe erinnerte. Er war verärgert, als er herauskam, und verstand nicht, wie sein teurer Nietzsche diese Pariser Bordellgetöse hatte beweihräuchern können. Aber Nietzsche hatte ja auch einmal schlecht von seinem ihm noch viel teureren Wagner gesprochen, was nur zu beweisen schien, daß der Philosoph hinsichtlich der Musik ein Esel war.
Was machte das schon! Wenn er über seinen Opernabend auch nicht glücklich war, so blieb ihm zumindest die Befriedigung, seine letzten Schillinge auf luxuriöse und nutzlose Weise ausgegeben zu haben.
Kein Wunder, daß die Zakreys wieder anfing, ihm im Korridor hinterherzurennen, weil sie ihr Geld haben wollte.
»Ein bißchen Geduld, Frau Zakreys«, sagte er eines Abends aggressiv. »Nächste Woche bekomme ich mein Akademiestipendium.«
»Sie werden mir alles auf einmal zahlen müssen, Sie sind schon im Rückstand.«
»Selbstverständlich. Und ich kann Ihnen sogar anbieten, den kommenden Monat schon im voraus zu zahlen.«
Diese Worte gingen der Zakreys runter, als hätte sie ein Ei ausgeschlürft, und die Schale gleich mit. Einen Augenblick lang verschlug es ihr die Sprache. Sie hätte sich nicht vorstellen können, daß von diesem Furzsack Hitler je irgend etwas Gutes würde kommen können. Erleichtert scharwenzelte sie um ihn herum und wollte ihn gleich wieder mit Tee und hausgemachten Küchelchen verwöhnen.
Ihm blieb also noch eine Woche. Danach … Was würde er danach tun?
Was macht das schon! Ich bin Künstler. Ich bin Maler. Um derlei Nebensächlichkeiten muß ich mich nicht kümmern.
Er beschloß, sich in dieser letzten Woche seiner eigenen Kunst zu widmen. Er fing an zu zeichnen, war aber sehr schnell gelangweilt. Das genügte ihm nicht, er brauchte etwas Handfesteres als den Bleistift. Er legte seinen Skizzenblock beiseite und fing an, von einem großen Gemälde zu träumen, einem riesigen Gemälde, einem Gemälde, das er in Öl ausführen würde, einem Monumentalgemälde.
Er war zufrieden. Ja, dies war ein Projekt, würdig, seine Gedanken zu beschäftigen.
Er steckte sich eine Zigarette an und begann über die Abmessungen des Rahmens nachzudenken. Er dachte an Zahlen, an Zentimeter und Meter. Er dachte in immer riesigeren Dimensionen.
Am nächsten Morgen hatte er für das Gemälde keinen einzigen Strich getan und noch nicht einmal das Sujet bestimmt, doch er war erfüllt von der tiefen Befriedigung, das größte Ölfresko der Welt entworfen zu haben.