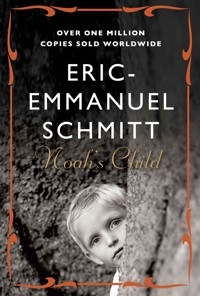8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Ein Mann reist nach Ostende. In der verschlafenen Stadt an der Nordsee möchte er eine abrupt beendete Liebesbeziehung vergessen. Er bezieht ein Zimmer bei der zurückgezogen lebenden Emma Van A. Wer ist diese Frau, die ihm ihre phantastische Lebensgeschichte erzählt, in der sich leidenschaftliche Liebe mit subtiler Erotik verbindet? Was ist erfunden, was Wahrheit? In fünf geheimnisvollen Erzählungen, halb grausam, halb zärtlich, zieht Eric Emmanuel Schmitt alle Register seiner Fabulierkunst und zeigt, es sind unsere Träume, die den Zauber des Lebens ausmachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Ähnliche
Eric-Emmanuel Schmitt
Die Träumerin von Ostende
Aus dem Französischen von Inés Koebel
Fischer e-books
Die Träumerin von Ostende
Ich glaube, ich habe nie jemanden gekannt, der so anders war, als er zunächst wirkte, wie Emma van A. Bei unserer ersten Begegnung vermittelte sie den Eindruck einer fragilen, unauffälligen Frau, so farblos, spröde und durchschnittlich, dass man sie auf der Stelle hätte vergessen können. Doch eines Tages kam ich mit ihrer Wirklichkeit in Berührung, und rätselhaft, herrisch, brillant, widersprüchlich und beharrlich wie sie war, ließ sie mich nicht mehr los, nahm mich für immer im Gespinst ihres verführerischen Charmes gefangen.
Manche Frauen sind wie eine Falle, in die man gerät. Manchmal möchte man sich nicht einmal mehr daraus befreien. Emma van A. hält mich in einer solchen Falle gefangen.
Alles begann im März, einem kühlen, zögerlichen Monat März, in Ostende.
Ich hatte immer von Ostende geträumt.
Wenn ich reise, üben Namen eine stärkere Anziehungskraft auf mich aus als Orte. Höher als Kirchtürme, erklingen sie schon von fern, sind über Tausende von Kilometern zu hören, lösen mit ihrem Klang Bilder aus.
Ostende …
Konsonanten und Vokale zeichnen einen Plan, ziehen Mauern hoch, schaffen eine bestimmte Atmosphäre.
Trägt der kleine Marktflecken den Namen eines Heiligen, siedelt ihn meine Phantasie um eine Kirche herum an, erinnert sein Name an einen Wald – wie Boisfort – oder an Felder – wie Champigny –, überzieht Grün die Gassen; verweist er auf ein Material – wie Pierrefonds –, kratze ich im Geist am Putz, um die Steine hervorzuheben; gemahnt er an ein Wunder – wie Dieulefit –, stelle ich mir einen Ort auf einem steilen, die Landschaft überragenden Fels vor. Nähere ich mich einer Stadt, habe ich zunächst ein Rendezvous mit einem Namen.
Ich hatte schon immer von Ostende geträumt.
Und das Träumen hätte mir vollauf genügt, wenn nicht das jähe Ende einer Beziehung mich hätte das Weite suchen lassen. Nichts wie weg! Fort aus diesem Paris voller Erinnerungen an eine verlorene Liebe. Rasch, ein Tapetenwechsel, andere Luft …
Der Norden schien mir geeignet, dort waren wir nie zusammen gewesen. Und kaum entfaltete ich die Landkarte, zogen mich über dem Blau der Nordsee auch schon sieben Buchstaben unwiderstehlich an: Ostende. Nicht nur der Klang faszinierte mich, ich erinnerte mich zudem, dass eine Freundin eine gute Unterkunft vor Ort kannte. Ein paar Anrufe, und die Sache war geregelt, ein Quartier reserviert, das Gepäck im Wagen verstaut, und ich machte mich auf den Weg nach Ostende, als erwartete mich dort mein Schicksal.
Da der Name mit einem O des Erstaunens begann, besänftigt durch das folgende S, assoziierte ich sogleich begeistert einen glatten, endlosen Sandstrand … Und da die Etymologie des Namens eine »nach Westen hin ausgerichtete« Stadt nahelegte, schloss ich, dass ihre dem Meer zugewandten Häuser allabendlich von der untergehenden Sonne in rotes Licht getaucht wurden.
Als ich eintraf, war es bereits dunkel, und ich wusste nicht recht, was ich von der Sache halten sollte. Zwar stimmte die Wirklichkeit Ostendes in einigen Punkten mit meinem Traum von Ostende überein, widersprach ihr aber zugleich aufs heftigste: Obwohl sich dieser Ort am Ende der Welt, nämlich in Flandern, befand, zwischen einem Wellen- und einem Feldermeer, obwohl er einen weiten Strand zu bieten hatte und einen nostalgisch anmutenden Deich, machte er doch deutlich, wie stark die Belgier ihre Küste, unter dem Vorwand, sie der Allgemeinheit zugänglich machen zu wollen, verschandelt hatten. Gebäudekomplexe höher als Ozeandampfer, geschmacklose, nach Gesichtspunkten der Rentabilität konzipierte nullachtfünfzehn Unterkünfte, kurz, ein urbanes Chaos, das jene unternehmerische Gier verriet, die darauf abzielte, der Mittelklasse während der Urlaubszeit das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Glücklicherweise stammte das Haus, in dem ich eine Etage gemietet hatte, noch aus dem 19. Jahrhundert, es war eine Villa aus der Zeit Leopolds II., des »Baukönigs«. Damals nichts Besonderes, war sie heute etwas Außergewöhnliches. Inmitten neu hochgezogener Bauten, beredten Beispielen geometrischer Einfallslosigkeit – simple, in gleichförmige Würfel unterteilte Stockwerke, die wiederum in Appartements unterteilt waren, Appartements, versehen mit scheußlichen Rauchglasfenstern, allesamt symmetrisch und von einer Nüchternheit, dass einem schlecht werden konnte –, wirkte dieses Haus wie ein Solitär und zeugte von architektonischem Gestaltungswillen; es hatte sich mit Bedacht herausgeputzt, Größe und Form seiner Öffnungen variiert, wagte sich hier in einem Balkon vor, da in einer Terrasse, dort in einem Wintergarten, spielte mit hohen, mittelhohen und niedrigen Fenstern und machte sich, wie eine Frau, die sich ein Schönheitspflästerchen auf die Stirn klebt, einen Spaß daraus, sich unter seinem Schieferdach mit einem Ochsenauge zu schmücken.
Eine Rothaarige um die fünfzig mit einem breiten, blaurot geäderten Gesicht verstellte die geöffnete Tür.
»Was willst du?«
»Wohnt hier Madame Emma van A.?«
»Geeenau«, brummte sie mit einem kräftigen flämischen Akzent, der ihre Vierschrötigkeit noch unterstrich.
»Ich habe bei Ihnen den ersten Stock für vierzehn Tage gemietet. Meine Freundin aus Brüssel müsste Sie benachrichtigt haben.«
»Aber ja, natürlich! Du wirst schon erwartet! Ich sag meiner Tante gleich Bescheid. Aber kommen Sie doch bitte rein, na komm schon.«
Mit ihren rauen Händen entriss sie mir die Koffer, knallte sie in der Eingangshalle auf den Boden und schob mich mit barscher Liebenswürdigkeit Richtung Salon.
Vor dem Fenster zeichnete sich die Silhouette einer zierlichen Frau in einem Rollstuhl ab, dem Meer zugewandt, dessen dunkle Tinte der Himmel trank.
»Tante Emma, dein Mieter.«
Emma van A. wandte sich um und sah mich an.
Andere hätten ihre Gäste mit einem einnehmenden Lächeln willkommen geheißen, sie aber musterte mich nur streng. Emma van A. war von durchscheinender Blässe, ihre Haut eher gealtert als faltig, ihr schwarz-weißmeliertes Haar wirkte weniger grau als vielmehr stark gesträhnt, ihr Gesicht war lang und schmal, ihr Hals zart. War es das Alter? War es eine Angewohnheit? Sie hielt ihren Kopf so zur Seite geneigt, dass er mit einem Ohr fast die linke Schulter berührte und ihr Kinn stark nach rechts oben zeigte. Schief und aufmerksam, wie sie dasaß, schien sie gleichermaßen zu lauschen wie zu beobachten.
Ich musste das Schweigen irgendwie brechen.
»Guten Tag, Madame, ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen unterkommen kann.«
»Sie sind Schriftsteller?«
Jetzt verstand ich, warum sie mich so prüfend angesehen hatte: Sie fragte sich, ob ich aussah wie einer, der Romane schrieb.
»Ja.«
Sie seufzte wie erleichtert. Offensichtlich hatte die Tatsache, dass ich Autor bin, sie dazu veranlasst, mir ihr Haus zu öffnen.
Ihre Nichte, die hinter mir stand, begriff, dass der Eindringling seine Aufnahmeprüfung bestanden hatte, und posaunte lautstark:
»Na, dann werd ich mal gehen und die Zimmer weiter herrichten, in fünf Minuten bin ich so weit.«
Während sie sich entfernte, sah ihr Emma van A. wie einem treuen, aber dummen Hund hinterher.«
»Bitte verzeihen Sie, Monsieur, meine Nichte weiß nicht, wie man sich siezt. Im Niederländischen gebraucht man nur das Du.«
»Schade, dass man sich um das Vergnügen bringt, vom Du zum Sie übergehen zu können.«
»Am schönsten wäre es doch, eine Sprache zu sprechen, die nur das Sie kennt, oder?«
Warum hatte sie das gesagt? Befürchtete sie etwa, ich könnte allzu vertraulich werden? Ich blieb etwas verlegen stehen. Sie bat mich, Platz zu nehmen.
»Seltsam. Ich verbringe mein Leben inmitten von Büchern, bin aber nie einem Schriftsteller begegnet.«
Ich sah mich kurz um und fand ihre Worte bestätigt: Tausende Bücher füllten die Regale des Salons, ja, reichten selbst bis ins Speisezimmer hinein. Damit ich mir ein besseres Bild davon machen konnte, glitt sie leise wie ein Schatten mit ihrem Rollstuhl zwischen den Möbeln hindurch und knipste matt leuchtende Lampen an.
Obgleich ich nichts mehr genieße als die Gegenwart bedruckten Papiers, überkam mich in dieser Bibliothek, ohne dass ich recht wusste weshalb, eine gewisse Befangenheit. Die Bände sahen vornehm aus, waren sorgsam in Leder oder Leinen gebunden, Verfasser und Titel in goldenen Lettern eingeprägt; unterschiedlich groß standen sie dicht beieinander, weder wahllos noch übertrieben symmetrisch angeordnet, einem Gleichmaß folgend, das von einem ausgewogenen Geschmack zeugte, und dennoch … Sind wir so sehr an kartonierte Ausgaben gewöhnt, dass in Leder gebundene Bücher uns verunsichern? Machte es mir etwas aus, dass ich darunter keinen meiner bevorzugten Einbände sah? Es fiel mir schwer, meine Irritation in Worte zu fassen.
»Sie müssen verzeihen, aber ich habe keinen Ihrer Romane gelesen«, sagte sie, meine Befangenheit falsch deutend.
»Ich bitte Sie. Wer kennt schon alles? Zudem erwarte ich das gar nicht von den Leuten, mit denen ich verkehre.«
Beruhigt hörte sie auf, an dem Korallenarmband zu drehen, das ihr schmales Handgelenk umschloss, und lächelte die Wände an.
»Dabei verbringe ich meine gesamte Zeit mit Lesen. Ja, lese oft sogar ein und dasselbe Buch mehrmals. Große Werke erschließen sich einem ja eigentlich erst richtig beim dritten oder vierten Mal, nicht wahr?«
»Wodurch zeichnet sich für Sie ein großes Werk aus?«
»Ich überspringe jedes Mal eine andere Passage.«
Sie griff nach einem in granatrotes Leder gebundenen Band, den sie, sichtlich bewegt, einen Spaltbreit öffnete.
»Die Odyssee zum Beispiel. Welche Seite ich auch immer aufschlage, es ist ein Hochgenuss. Mögen Sie Homer, Monsieur?«
»Aber … ja.«
Ihre Pupillen weiteten sich, und ich begriff, dass sie meine Antwort als leicht dahingesagt, wenn nicht als flapsig empfand. Und so bemühte ich mich, etwas genauer zu werden.
»Ich habe mich oft mit Odysseus identifiziert, er erweist sich eher als listenreich denn als intelligent, er kehrt ohne Eile nach Hause zurück und verehrt Penelope, ohne auch nur eine der hübschen Frauen zu verschmähen, die ihm während seiner Reise begegnen. Er ist eigentlich so wenig tugendhaft, dieser Odysseus, dass ich mich ihm nahe fühle. Für mich ist er modern.«
»Wie kann man nur glauben, Amoralität sei zeitgebunden, das ist geradezu naiv … In jeder Generation bilden sich die jungen Leute ein, sie seien es, die das Laster erfunden hätten. Wie vermessen! Was für eine Art Literatur schreiben Sie eigentlich?«
»Meine. Sie lässt sich nicht einordnen.«
»Ausgezeichnet.« Ihrem schulmeisterlichen Ton entnahm ich, dass sie mich erneut einer Prüfung unterzog.
»Darf ich Ihnen eines meiner Bücher schenken?«
»Ah, Sie haben Ihre Bücher dabei?«
»Nein. Aber ich bin sicher, dass in den Buchhandlungen von Ostende …«
»Ach ja, die Buchhandlungen …«
Sie sprach dieses Wort aus, als hätte man sie soeben an etwas weit Zurückliegendes, bereits Vergessenes erinnert.
»Sie müssen wissen, Monsieur, diese Bibliothek, sie gehörte meinem Vater. Er hat Literatur unterrichtet. Seit meiner Kindheit lebe ich umgeben von diesen Publikationen ohne das Verlangen, seine Sammlung zu erweitern. Sie beinhaltet so viele kleine Schätze, die ich noch nicht gehoben habe. Sehen Sie nur, gleich hinter Ihnen, George Sand, Dickens … einige Bände habe ich noch immer nicht gelesen. Desgleichen Victor Hugo.«
»Ist es nicht bezeichnend für das Genie Victor Hugos, dass sich bei ihm immer eine Seite findet, die man noch nicht gelesen hat?«
»Richtig. Deshalb lebe ich auch so und nicht anders, umgeben und behütet von Giganten! Und deshalb gibt es hier auch keine … Neuerscheinungen.«
Nach kurzem Zögern war ihr das Wort ›Neuerscheinungen‹ so widerwillig über die gespitzten Lippen gekommen, als handele es sich um etwas Vulgäres, wenn nicht Obszönes. Während ich ihr zuhörte, wurde mir bewusst, dass es tatsächlich ein Terminus aus der Geschäftswelt war, geeignet für einen Modeartikel, nicht aber für ein literarisches Werk; und ich begriff, dass ich in ihren Augen lediglich ein Autor von ›Neuerscheinungen‹ war, ein Lieferant gewissermaßen.
»Waren die Romane von Daudet und Maupassant, als sie herauskamen, nicht auch ›Neuerscheinungen‹?«, fragte ich.
»Die Zeit hat ihnen ihren Platz zugewiesen«, entgegnete sie, als hätte ich mir soeben eine Frechheit erlaubt.
Am liebsten hätte ich ihr gesagt, dass jetzt sie die Naive sei, da ich mich aber nicht befugt fühlte, meiner Gastgeberin zu widersprechen, beschränkte ich mich darauf, den Grund für mein Unbehagen festzustellen: Diese Bibliothek atmete nicht, sie war seit vierzig oder fünfzig Jahren zu einem Museum erstarrt und würde sich nicht weiterentwickeln, solange ihre Eigentümerin sich weigerte, ihr auch nur einen Tropfen frischen Blutes zu injizieren.
»Verzeihen Sie meine Indiskretion, Monsieur: Sind Sie alleinstehend?«
»Ich bin hierhergekommen, um mich von einer Trennung zu erholen.«
»Oh, das tut mir leid … aufrichtig leid … ich tue Ihnen weh, indem ich Sie wieder daran erinnere … bitte verzeihen Sie.«
Ihre Wärme, ihr Erschrecken, ihre plötzliche Nervosität bezeugten ihre Aufrichtigkeit, sie machte sich tatsächlich Vorwürfe, dass sie meinen Kopf in einen Eimer voll unangenehmer Erinnerungen getaucht hatte. Sie stammelte verwirrt:
»Ostende ist perfekt bei Liebeskummer …«
»Nicht wahr? Glauben Sie, dass ich mich hier davon erhole?«
Sie sah mich mit gerunzelten Brauen an.
»Davon erholen? Sie hoffen, sich davon zu erholen?«
»Ja, dass ich diese Trennung verschmerze.«
»Und Sie glauben, Sie schaffen es?«
»Ja, das glaube ich.«
»Seltsam«, murmelte sie und musterte mich so eingehend, als nähme sie mich zum ersten Mal wahr.
Ihre Nichte, die mit ihrem Gewicht die letzten Treppenstufen in Schwingung versetzte, platzte atemlos herein, verschränkte ihre kurzen Arme über der unförmigen Brust und schmetterte mir triumphierend entgegen:
»Fertig, du kannst einziehen! Du hast oben alle Zimmer für dich. Such dir eins aus. Kommen Sie bitte mit.«
»Gerda wird Ihnen alles zeigen, cher Monsieur. Seit ich gesundheitliche Probleme habe, bewohne ich nur noch das Erdgeschoss. Daher kann ich Ihnen auch die erste Etage überlassen, fühlen Sie sich dort ganz wie zu Hause. Sie können sich alle Bücher nehmen, die Sie vorfinden, vorausgesetzt, Sie stellen sie wieder zurück an ihren Platz.«
»Danke.«
»Gerda wird Ihnen am Morgen Ihr Frühstück bringen, sofern Sie nicht zu früh aufstehen.«
»Halb zehn wäre mir recht.«
»Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen also einen guten Abend, Monsieur, und einen angenehmen Aufenthalt.«
Woher kam die plötzliche Eingebung? War sie nicht die Art Frau, die einen Handkuss erwartete? Gut gedacht: Kaum ging ich auf sie zu, hielt sie mir auch schon ihren Handrücken entgegen, und ich beugte mich, comme il faut, darüber.
Die Nichte beobachtete uns wie zwei Clowns, zuckte die Schultern, griff nach den Koffern und begann, die lackierte Holztreppe zu erklimmen, die unter ihren Schritten bebte.
Ich war im Begriff, den Salon zu verlassen, als mich die Stimme Emma van A.s zurückhielt:
»Monsieur, Ihre Worte gehen mir nicht aus dem Kopf, Sie sagten eben, Sie glaubten, über diese Trennung hinwegzukommen. Verstehen Sie meine Reaktion nicht falsch: Ich bin ganz auf Ihrer Seite. Ich wünsche es Ihnen. Ja, es würde mich sogar sehr freuen.«
»Danke, Madame van A., auch ich wäre sehr froh.«
»Es ist nämlich so, wenn Sie über eine Trennung hinwegkommen, dann war die ganze Sache es auch nicht wert.«
Ich war perplex.
Sie musterte mich eingehend und erklärte dann in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete:
»Eine Liebe, über die man hinwegkommt, war nicht die Liebe.«
Daraufhin setzte sie mit ihren Händen die Räder ihres Rollstuhls in Bewegung und stand innerhalb von drei Sekunden wieder so am Fenster, wie ich sie anfangs angetroffen hatte.
Die obere Etage war mit sicherem Geschmack eingerichtet, üppig möbliert, mit einer weiblichen Note und von altmodischem Charme.
Nachdem ich mir alles angesehen hatte, wählte ich das »Blaumeisenzimmer« aus, das wegen der Wandbespannung so hieß, ein Stoff im japanischen Stil, dessen verblichene Farben von einem subtilen Raffinement zeugten. Allerdings tat ich mich etwas schwer, zwischen all dem Nippes Platz für meine eigenen Sachen zu finden, aber dieser ganze Zierrat machte, wie eine barocke Muschelskulptur, nur in verschwenderischer Fülle Sinn.
Gerda empfahl mir einige Restaurants, vertraute mir einen Schlüsselbund an und verabschiedete sich, um mit dem Rad die zehn Kilometer zurückzulegen, die sie von ihrem Heim trennten.
Ich entschied mich für den der Villa Circé am nächsten gelegenen Gasthof und hob mir den Gang durch die Stadt für den folgenden Tag auf. Berauscht von der Meeresluft schlief ich, kaum hatte ich mich auf meinem Bett ausgestreckt, unter den schweren Daunendecken ein.
Am Morgen, nach einem üppigen, von Gerda servierten Frühstück – Champignons, Eier, Kartoffelkroketten –, traf ich, wie erwartet, Emma van A. auf ihrem Platz vor dem Fenster an.
Da meine Vermieterin mich nicht hatte kommen hören und das Tageslicht grell ins Zimmer fiel, konnte ich ihre Züge und ihr Verhalten eingehender betrachten.
Auch wenn sie nichts tat, schien sie dennoch etwas zu beschäftigen. Ihre Augen verrieten die unterschiedlichsten Gefühle, Gedanken furchten und entspannten ihre Stirn, ihre Lippen hielten eine Wörterflut zurück, die es nach außen drängte. Ausgestattet mit einem überreichen Innenleben, verbrachte Emma van A. ihre Tage zwischen den aufgeschlagenen Seiten eines Romans auf ihren Knien und einer Fülle von Träumen, die sie überkamen, sobald sie den Kopf hob und hinaus auf die Bucht sah. Es war, als zögen dort zwei einzelne Schiffe vorüber, das Schiff ihrer Gedanken und das Schiff ihres Buches: Von Zeit zu Zeit, wenn sie den Blick senkte, vermischten sich beider Kielwasser für einen Augenblick und verbanden ihre Wellen miteinander, ehe Emma van A.s Schiff alleine weiterfuhr. Sie las, um nicht abzudriften, und nicht, um eine geistige Leere zu füllen, sondern um eine übermächtige schöpferische Kraft zu begleiten. Literatur als Aderlass gegen ein Fieber …
Emma van A. musste sehr schön gewesen sein, selbst noch im Alter. Doch vor kurzem hatte eine Krankheit – eine Gehirnblutung, wie Gerda sagte – sie von einer Antiquität zum Trödel herabgestuft. Seither schwanden ihre Muskeln, und ihr schlanker Leib war mager geworden. Sie wirkte so leicht, als seien ihre Knochen porös, ja, zerbrechlich. Ihre von Arthrose in Mitleidenschaft gezogenen Gelenke erschwerten ihr jede Bewegung, doch loderte ein solches Feuer in ihr, dass sie dem keinerlei Beachtung schenkte. Ihre Augen waren nach wie vor bemerkenswert: groß, hell und blau, ein Blau, durch das die Wolken des Nordens zogen.
Mein Gruß riss sie aus ihren Grübeleien, sie sah mich verstört an. Als hätte sie etwas bis ins Innerste aufgewühlt. Dann aber lächelte sie, ein offenes Lächeln, das nichts Künstliches hatte, ein Lichtstreif über der rauen See.
»Ah, guten Tag. Haben Sie gut geschlafen?«
»So gut, dass ich es gar nicht weiß. Und jetzt sehe ich mir Ostende an.«
»Wie ich Sie beneide … Einen schönen Tag, Monsieur.«
Ich schlenderte mehrere Stunden durch Ostende, wobei ich nie länger als zwanzig Minuten in den Seitenstraßen verweilte, sondern immer wieder, wie eine von der Seeluft angezogene Möwe, zur Promenade oder auf den Deich zurückkehrte.
Die Nordsee zeigte sich austernfarben, grünbraun die Wellen, perlmuttweiß die Schaumkronen, und spielte mit zarten erlesenen Farbnuancen, die mich ausruhen ließen von meinen leuchtend hellen Erinnerungen ans Mittelmeer: ungetrübtes Blau, gelber Sand, beides von so lebhafter und einfacher Farbgebung wie eine Kinderzeichnung. Mit seinen gedämpften Tönen, die an jenen jodhaltigen Genuss erinnerten, wie man ihn beim Verzehr von Meeresfrüchten in einer Brasserie verspürt, wirkte dieses Meer zudem auch salziger.
Obgleich ich nie zuvor in Ostende gewesen war, rief es Erinnerungen in mir wach, und ich gab mich Kindheitsgefühlen hin. Mit bis zu den Knien aufgekrempelter Hose setzte ich meine Füße dem prickelnden Sand aus, ehe ich sie zur Belohnung ins Wasser tauchte. Wie früher ging ich bis zu den Waden in die Wellen, wagte mich dann aber nicht weiter. Und wie früher kam ich mir winzig vor angesichts der unendlichen Weite von Himmel und Meer.
Um mich herum kaum eine Menschenseele. Bis auf ein paar alte Leute. Lieben sie die Küste deshalb so? Weil sie beim Baden alterslos sind? Weil sie die Genügsamkeit wiederentdecken, die einfachen Freuden der Kindheit? Weil, während Häuser und Handel dem Wandel unterworfen sind, Sand und Wellen unberührt davon bleiben, ewig und rein? Der Strand ist ein geheimer Garten, dem die Zeit nichts anhaben kann.
Ich kaufte mir Krabben, die ich in ein Pappschälchen mit Mayonnaise tunkte und im Stehen aß, anschließend setzte ich meinen Spaziergang fort.
Wieder zurück in der Villa Circé, gegen achtzehn Uhr, war ich wie berauscht von Sonne und Wind und hatte den Kopf voller Träume.
Emma van A. wandte sich nach mir um, lächelte, als sie mich im Zustand seliger Trunkenheit sah, und fragte mich mit einem Augenzwinkern:
»Na, wie war’s, haben Sie Ostende erkundet?«
»Ja, es war herrlich.«
»Wie weit sind Sie gegangen?«
»Bis zum Hafen. Denn, um ehrlich zu sein, hätte ich nicht die Möglichkeit, die Segel zu streichen, könnte ich hier nicht bleiben.«
»Ach tatsächlich? Sie bleiben also nur unter der Voraussetzung, dass sie jederzeit wieder fortkönnen? Das ist typisch Mann.«
»Sie haben es erkannt. Die Männer fahren zur See, und die Frauen …«
»… werden Seemannsfrauen! Und dann Seemannswitwen.«
»Worauf wartet man denn so, wenn man ein Leben lang in einer Hafenstadt am Ende der Welt wohnt?«
Sie hatte das Provokante meiner Frage durchaus verstanden, sah mich freundlich an und ermunterte mich stumm fortzufahren. Was ich denn auch tat:
»Wartet man auf eine Abreise?«
Sie zuckte verneinend die Schultern.
»Oder eher auf eine Rückkehr?«
Ihre großen graublauen Augen musterten mich eindringlich. Ich glaubte, darin etwas wie einen Vorwurf zu erkennen, aber ihre feste Stimme belehrte mich eines Besseren:
»Man erinnert sich, Monsieur, man erinnert sich.«
Dann blickte sie hinaus aufs Meer. Und wieder so in Gedanken versunken, als wäre ich nicht mehr vorhanden; sie sah so unverwandt in die Ferne, wie ich auf ein unbeschriebenes Blatt Papier, und erging sich ganz in ihren Träumereien.
Woran erinnerte sie sich? Nichts unter diesem Dach verriet etwas von ihrer Vergangenheit, alles gehörte früheren Generationen an: Bücher, Möbel, Bilder. Ich hatte den Eindruck, dass sie, wie eine Elster, mit einem gestohlenen Schatz hierhergekommen war, ihn abgeladen und sich damit begnügt hatte, Vorhänge und Wandbespannungen zu erneuern.
Wieder auf meiner Etage, fragte ich ihre Nichte:
»Gerda, Ihre Tante hat mir verraten, dass sie ihre Tage damit verbringt, sich die Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Was, glauben Sie, ruft sie sich ins Gedächtnis?«
»Keine Ahnung. Sie hat nie gearbeitet. Sie ist eine alte Jungfer.«
»Sind Sie sich da so sicher?«
»Darauf kannst du Gift nehmen. Tante Emma und ein Mann? Die Ärmste, nie im Leben. Das wissen alle in der Familie. Bei dem Wort Mann oder Ehe macht sie dicht wie eine Muschel.«
»Eine geplatzte Verlobung? Ein Verlobter, der im Krieg gefallen ist? Eine gescheiterte Beziehung, ein persönliches Drama, das sie nicht vergessen kann, Wehmut?«
»Nicht mal das! Früher, als die Familie noch größer war, da haben Onkel und Tanten immer wieder versucht, ihr eine gute Partie anzudienen. Ja, absolut akzeptable Anwärter. Eine Pleite nach der anderen, ob du’s glaubst oder nicht!«
»Seltsam …«
»Allein zu bleiben? Aber ja! Also, ich könnte so was nicht … Ich hab zwar nicht gerade den schönsten Ehemann von der Küste erwischt, aber immerhin ist er da und hat mir meine Kinder geschenkt. Ein Leben wie meine Tante? Da bring ich mich lieber gleich um.«
»Aber sie wirkt nicht gerade unglücklich.«
»Also, das muss man ihr lassen: Sie beklagt sich nie. Selbst jetzt, wo sie immer schwächer wird und ihre Ersparnisse wie Butter dahingeschmolzen sind, sie beklagt sich einfach nie! Nein, sie schaut zum Fenster raus, sie lächelt, sie träumt. Man kann sagen, auch wenn sie nicht gelebt hat, so hat sie doch geträumt …«
Gerda hatte recht. Emma lebte anderswo, nicht unter uns. Lag in der Haltung ihres Kopfes – seitwärts geneigt auf einem grazilen Hals – nicht etwas Nachdenkliches, das den Eindruck vermittelte, ihre Träume könnten vielleicht zu schwer wiegen?
Seit diesem Gespräch nannte ich sie heimlich die Träumerin … die Träumerin von Ostende.
Tags darauf hörte sie mich herunterkommen und lenkte ihren Rollstuhl in meine Richtung.
»Möchten Sie Kaffee mit mir trinken?«
»Gern.«
»Gerda! Bring uns bitte zwei Kaffee.«
Sie flüsterte mir zu:
»Ihr Kaffee ist wie Spülwasser, so schwach, dass er nicht einmal einem Neugeborenen schadet.«
Gerda brachte uns stolz zwei dampfende Schalen, als käme unser Verlangen, bei ihrem Gebräu zu schwatzen, einer Huldigung ihrer Kochkünste gleich.
»Madame van A., was Sie mir da am ersten Abend gesagt haben, hat mir zu denken gegeben.«
»Was?«
»Ich komme schnell über das hinweg, was mich aus Paris vertrieben hat: Demnach ist das Ende dieser Beziehung auch kein großer Verlust. Erinnern Sie sich, Sie sagten mir, man käme nur über etwas hinweg, was keine Bedeutung habe, nicht aber über eine große Liebe.«
»Ich habe einmal gesehen, wie ein Blitz in einen Baum einschlug. Ich fühlte mich dem Baum sehr nah. Es gibt Augenblicke, in denen man brennt, sich verzehrt, ein starkes, wunderbares Gefühl. Doch zurückbleibt nur Asche.«
Sie wandte sich dem Meer zu.
»Ein Baumstumpf, selbst wenn er noch lebt, kann nie wieder ein richtiger Baum werden, das gibt es nicht.«
Mit einem Mal kam es mir vor, als sei sie, hier in ihrem Rollstuhl, dieser Baumstumpf im Boden …
»Ich habe das Gefühl, Sie sprechen von sich«, sagte ich sanft.
Sie fuhr zusammen. Eine plötzliche Unruhe, nahezu panisch, durchzuckte ihre Finger und beschleunigte ihren Atem. Um die Contenance nicht zu verlieren, griff sie nach ihrer Schale, trank, verbrannte sich und schimpfte auf den zu heißen Kaffee.
Ich tat, als hätte ich ihr Ablenkungsmanöver nicht bemerkt, und kühlte ihren Kaffee mit ein wenig Wasser.
Als sie sich wieder erholt hatte, sagte ich jedoch:
»Madame, denken Sie bitte nicht, ich wollte Sie ausfragen, ich respektiere Ihr Geheimnis, ich möchte Ihnen keinesfalls zu nahe treten.«
Sie nahm einen Schluck und sah mich, um sich meiner Aufrichtigkeit zu vergewissern, forschend an; ich hielt ihrer Prüfung stand. Überzeugt neigte sie schließlich den Kopf, und als sie »danke« murmelte, klang ihre Stimme anders.
Es war jetzt an der Zeit, ihr eines meiner Bücher zu schenken, das ich am Vortag in der Stadt gekauft hatte. Ich zog es aus meiner Gesäßtasche.
»Hier bitte, ich habe Ihnen einen Roman mitgebracht, den ich für meinen besten halte. Ich wäre überglücklich, wenn Sie ihn gelegentlich lesen würden und er Ihnen auch noch gefiele.«
Sie unterbrach mich verblüfft.
»Ich? Aber … das ist unmöglich …«
Sie griff sich ans Herz.
»Sie müssen verstehen, ich lese nur Klassiker. Ich lese keine … keine … keine …«
»Neuere Literatur?«
»Ja, keine Neuerscheinungen. Ich warte.«
»Worauf?«
»Dass sich der Ruf des Autors bestätigt, dass sein Werk für wert befunden wird, einer zeitlosen Bibliothek anzugehören, dass …«
»Dass er stirbt, ist es das?«
Es war mir ungewollt herausgerutscht. Dass Emma van A. mein Geschenk ablehnte, empörte mich.
»Nur zu, sagen Sie es schon: Die besten Autoren sind bereits tot! Seien Sie versichert, auch ich werde irgendwann sterben. Irgendwann wird auch mir die Ehre des Hinscheidens zuteil, und am nächsten Tag lesen Sie mich dann vielleicht!«
Weshalb regte ich mich eigentlich so auf? Was machte es schon aus, ob diese alte Jungfer mich bewunderte oder nicht? Weshalb buhlte ich um ihr Interesse?
Sie setzte sich in ihrem Stuhl zurecht, versuchte, sich so gerade wie möglich aufzurichten, und musterte mich, obwohl sie kleiner war als ich, von oben herab:
»Monsieur, mit Rücksicht auf mein Alter und auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, seien Sie nicht anmaßend: Ich werde diese Erde aller Wahrscheinlichkeit nach vor Ihnen verlassen, und zwar bald. Und mein Tod wird mich nicht talentierter machen, als ich bin. Was übrigens auch für Sie zutrifft.«
Sie drehte ihren Rollstuhl energisch um und schlängelte sich zwischen den Möbeln der Bibliothek hindurch.
»Es ist traurig, aber so ist es nun einmal: Wir kommen nicht zusammen.«
Sie stoppte die Räder des Rollstuhls vor dem riesigen Fenster, das aufs Meer hinausging.
»Manchmal leben Menschen, die geschaffen sind, sich zu entflammen, nicht die große, ihnen bestimmte Leidenschaft, weil der eine zu jung und der andere zu alt ist.«
Und mit gebrochener Stimme fügte sie hinzu:
»Schade, ich hätte Sie gern gelesen …«
Sie war aufrichtig bekümmert. Wirklich, diese Frau brachte mich ganz aus dem Konzept. Ich ging zu ihr.
»Madame van A., wie konnte ich mich nur so ereifern, was für eine idiotische Idee, dieses Geschenk, und dann wollte ich es Ihnen auch noch aufdrängen. Entschuldigen Sie.«
Sie wandte sich mir zu, und ich bemerkte Tränen in ihren sonst so trockenen Augen.
»Am liebsten würde ich Ihr Buch verschlingen, aber ich kann nicht.«
»Warum?«
»Stellen Sie sich vor, es gefiele mir nicht …«
Allein der Gedanke ließ sie vor Entsetzen erschaudern. Ihre Heftigkeit rührte mich. Ich lächelte ihr zu. Sie bemerkte es und erwiderte mein Lächeln.
»Es wäre entsetzlich, Sie sind so sympathisch.«
»Wäre ich Ihnen nicht mehr sympathisch, wenn ich ein schlechter Schriftsteller wäre?«
»Nein, Sie würden lächerlich. Ich räume der Literatur einen so hohen Stellenwert ein, dass ich es nicht ertragen könnte, wenn Sie mittelmäßig wären.«
Sie war zutiefst aufrichtig, zitterte geradezu vor Aufrichtigkeit.
Mir war zum Lachen. Warum machten wir es uns wegen ein paar Seiten so schwer? Es war irgendwie rührend.
»Ärgern wir uns nicht mehr, Madame van A. Ich nehme meinen Roman zurück, und wir sprechen über etwas anderes.«
»Selbst das ist nicht möglich.«
»Was ist nicht möglich?«
»Sprechen. Ich kann nicht sprechen, wie ich möchte.«
»Wer hindert Sie daran?«
Sie zögerte, sah sich hilfesuchend um, ließ ihren Blick über die Bücherregale gleiten, als suchte sie dort Halt, war nahe daran zu antworten, hielt inne und stieß schließlich erschöpft hervor:
»Ich.«
Sie seufzte und sagte noch einmal bekümmert:
»Ja, ich …«
Plötzlich sah sie mir fest in die Augen, und dann brach es aus ihr hervor:
»Wissen Sie, ich war einmal jung, ich war verführerisch.«
Warum sagte sie mir das? Was hatte das mit unserem Gespräch zu tun? Ich war perplex.
Und wieder sagte sie mit einem Kopfschütteln:
»Ja, ich war hinreißend. Und man hat mich geliebt!«
»Dessen bin ich sicher.«
Sie warf mir einen abschätzigen Blick zu.
»Nein, Sie glauben mir nicht!«
»Doch …«
»Was soll’s. Es ist mir einerlei, was andere von mir denken oder gedacht haben. Und nicht nur das, ich bin auch verantwortlich für all die Unwahrheiten, die man sich über mich erzählt hat. Ich selbst bin schuld daran.«
»Was hat man denn über Sie gesagt, Madame van A.?«
»Nun ja, eben nichts.«
Und nach einer Weile.
»Nichts. Absolut nichts.«
Sie zuckte die Schultern.
»Hat Gerda nicht mit Ihnen darüber gesprochen?«
»Worüber?«
»Über dieses Nichts. Meine Familie glaubt, mein Leben sei leer gewesen. Geben Sie es zu …«
»Äh …«
»Da haben wir’s, sie hat’s gesagt! Mein Leben ist nichts. Und doch war es reich, mein Leben. Die anderen irren gewaltig mit ihrem Nichts.«
Ich trat näher.
»Wollen Sie mir davon erzählen?«
»Nein. Ich habe es versprochen.«
»Wie bitte?«
»Ich habe es versprochen. Es ist ein Geheimnis.«
»Versprochen? Wem? Wozu?«
»Antworten heißt, Verrat begehen …«
Diese Frau erstaunte mich: Was für ein Temperament in diesem alten Fräulein schlummerte, welche Heftigkeit, wie wach sie war, wie intelligent, sie benutzte Worte wie Faustschläge.
Und wieder wandte sie sich mir zu.
»Wissen Sie, ich bin geliebt worden wie selten jemand. Und ich habe geliebt. Ebenso intensiv. Oh, ja, ebenso intensiv, sofern es denn möglich war …«
Ihr Blick verschleierte sich.
Ich legte meine Hand auf ihre Schulter, um sie zu ermutigen.
»Eine Liebesgeschichte zu erzählen ist nicht verboten.«
»Mir schon. Denn die Personen, die damit zu tun haben, sind zu wichtig.«
Ihre Hände schlugen auf ihre Knie, als befehle sie denen zu schweigen, die sprechen wollten.
»Wozu habe ich denn all die Jahre geschwiegen, wenn ich das Schweigen jetzt plötzlich breche? Hm? Die ganze Mühe, all die Jahre, umsonst?«
Ihre knotigen Finger griffen nach den Rädern ihres Rollstuhls, versetzten ihnen einen kräftigen Schubs, und sie verließ den Raum, um sich in ihrem Schlafzimmer einzuschließen.
Als ich aus der Villa Circé trat, begegnete ich Gerda auf dem Trottoir. Sie war damit beschäftigt, den Abfall zu trennen und in verschiedene Mülltonnen zu verteilen.
»Sind Sie wirklich sicher, dass Ihre Tante nie eine große Leidenschaft hatte?«
»Hundertprozentig. Wir haben sie oft damit aufgezogen. Wär da was gewesen, hätte sie’s längst erzählt, schon allein, um ihre Ruhe zu haben!«
Mit entsetzlichem Getöse presste sie die drei Plastikflaschen auf die Größe von Korken zusammen.
»Ich muss noch einmal darauf zurückkommen, Gerda, denn ich bin davon überzeugt.«
»Da sieht man, dass du dein Brot mit Lügenmärchen verdienst, Junge. Was für eine blühende Phantasie!«
Ihre plumpen Hände zerrissen die Verpackungskartons, als wären sie aus Zigarettenpapier. Plötzlich hielt sie inne und sah zwei Möwen nach, die über uns hinwegflogen.
»Also, da du nun mal nicht lockerlässt; mir fällt da Onkel Jan ein. Ja. Der mochte Tante Emma sehr. Einmal hat er mir was Komisches erzählt: Sämtliche Männer, die versuchten, Tante Emma den Hof zu machen, ergriffen nach kurzer Zeit die Flucht.«
»Und weshalb?«
»Na, weil sie eine böse Zunge hatte.«
»Sie und böse?«
»Das hat er gesagt, der Onkel Jan. Das Resultat siehst du ja! Keiner hat sie gewollt.«
»Wenn man analysiert, was euer Onkel Jan da erzählt hat, dann war eher sie es, die keinen wollte.«
Die Nichte staunte, auf diesen Gedanken war sie nicht gekommen. Ich fuhr fort:
»Wenn sie sich Männern gegenüber so anspruchsvoll gegeben hat wie gegenüber Schriftstellern, dann hat bestimmt keiner Gnade vor ihr gefunden. Da ihr keiner gut genug war, hat sie alles getan, um sie zu entmutigen. In Wirklichkeit wollte Ihre Tante unabhängig bleiben!«
»Möglich«, räumte die Nichte widerwillig ein.
»Und was, wenn sie sich die Männer nur vom Leib gehalten hat, um den Platz des Mannes zu verteidigen, den sie schützte, der einzige, von dem sie nie gesprochen hat?«
»Tante Emma? Ein Doppelleben? Hm … die Ärmste …«
Gerda brummte skeptisch. Ihre Tante interessierte sie einzig als Opfer, ihr Mitgefühl war nicht frei von Geringschätzung; sobald man Gerda Anlass zur Vermutung gab, dass hinter Emmas Verhalten ruhige Überlegung und Einfallsreichtum stecken könnten, verlor sie das Interesse. Rätsel weckten ihre Neugier nicht und Erklärungen nur, sofern sie abwertend waren. Gerda gehörte zu den Menschen, die Verständnis mit Herabsetzung verwechselten, alles Romantische oder Erhabene war für sie nichts als Schall und Rauch.
Am liebsten wäre ich den ganzen Tag umhergestreift, aber das Wetter machte mir einen Strich durch die Rechnung. Nicht nur ein feindseliger Wind störte mich bei meinen Gedanken, nein, die düsteren, tiefhängenden Wolken regneten auch noch dicke, kalte Tropfen ab.
Nach zwei Stunden flüchtete ich mich zurück in die Villa. Als ich durch die Tür trat, überfiel mich eine völlig aufgelöste Gerda:
»Meine Tante ist im Krankenhaus, sie hatte einen Herzanfall!«
Ich fühlte mich schuldig. Sie war so außer sich gewesen, als ich sie verlassen hatte, dass ihr die Erregung aufs Herz geschlagen sein musste.
»Was sagen die Ärzte?«
»Ich hab auf dich gewartet, damit ich ins Krankenhaus kann. Dann mach ich mich jetzt mal auf den Weg.«
»Möchten Sie, dass ich Sie begleite?«
»He, sie ist krank, nicht ich. Und hast du etwa ein Fahrrad? Das Krankenhaus ist nicht gleich nebenan. Warte hier. Ist besser so. Ich bin bald zurück.«
Ich nutzte ihre Abwesenheit und sah mir den Salon näher an. Um mich von meiner Unruhe abzulenken, studierte ich den Inhalt der Regale. Wenn dort Klassiker der Weltliteratur standen, dann sicher auch Gesamtausgaben von Autoren, die ihre Glanzzeit gekannt hatten und nach denen heute kein Hahn mehr krähte. Daher begann ich über die Vergänglichkeit des Erfolgs nachzusinnen, die Unbeständigkeit jeden Ruhms. Keine schönen Aussichten. Wenn ich heute Leser hatte, hätte ich sie dann auch noch morgen? In ihrer Verblendung glauben die Schriftsteller allen Ernstes, sie könnten der Sterblichkeit entkommen, wenn sie etwas hinterließen; aber ist dieses Etwas von Dauer? Wenn ich einen Leser des 21