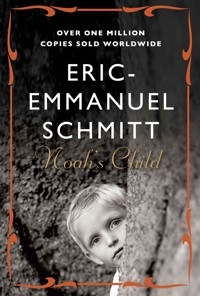8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
»Mein Name ist Saad Saad, das bedeutet auf Arabisch Hoffnung Hoffnung und auf Englisch Traurig Traurig.« Saad möchte Bagdad hinter sich lassen, das Chaos der Stadt, die Armut seiner Familie. Er will nach Europa, frei sein, eine Zukunft haben. Aber wie überwindet man Grenzen, ohne einen Dinar in der Tasche? Wie trotzt ein moderner Odysseus den Stürmen, überlebt Schiffbrüche, entkommt den Drogenhändlern, dem Gesang der Sirenen, dem Gefängniswächter und einäugigen Zyklopen? Eric-Emmanuel Schmitt erzählt eine höchst aktuelle Geschichte als Heldenepos unserer Zeit: gewalttätig, komisch, tragisch. Ein Buch, das unsere Humanität befragt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Ähnliche
Eric-Emmanuel Schmitt
Odysseus aus Bagdad
Roman
Aus dem Französischen von Marlene Frucht
FISCHER E-Books
Inhalt
Odysseus aus Bagdad
»Fremd ist nur, was nicht menschlich ist.«
Jean Giraudoux, Elpenor.
Ich heiße Saad Saad. Mein Name bedeutet auf Arabisch Hoffnung Hoffnung und auf Englisch Traurig Traurig. Innerhalb von Wochen, manchmal auch von einer Stunde zur nächsten oder sogar im Wimpernschlag einer Sekunde, verschiebt sich meine Wahrheit vom Arabischen zum Englischen. Je nachdem, ob ich froh gestimmt bin oder mich elend fühle, werde ich Saad, die Hoffnung, oder Saad, der Traurige.
Bei der Lotterie der Geburt zieht man ein gutes oder ein schlechtes Los. Wenn man in Amerika, in Europa oder in Japan zur Welt kommt, dann nimmt man seinen Platz ein, und fertig: Man wird geboren, und damit hat sich’s, es wird nicht nötig sein, irgendwann noch einmal von vorne anzufangen. Aber wenn man in Afrika oder im Nahen Osten das Licht der Welt erblickt …
Oft träume ich, vor meiner Geburt dagewesen zu sein; ich träume, es sind nur wenige Minuten bis zu meiner Zeugung und ich bin dabei: Und dann nehme ich eine Korrektur vor, ich lege Hand an das sich drehende Glücksrad, das die Zellen, die Moleküle und die Gene miteinander vermischt, ich lenke seinen Lauf, um ein anderes Ergebnis zu erhalten. Nicht, weil ich gerne anders wäre. Nein. Nur woanders aufkeimen will ich. Eine andere Stadt, ein anderes Land. Es soll kein anderer Bauch sein, das nicht, es soll das Innere meiner geliebten Mutter sein, aber ich will, dass der Bauch mich auf einem anderen Boden absetzt, wo ich gedeihen kann, anstatt auf dem Grund eines elenden Lochs, aus dem ich zwanzig Jahre später werde herausklettern müssen.
Ich heiße Saad Saad. Mein Name bedeutet auf Arabisch Hoffnung Hoffnung und auf Englisch Traurig Traurig; ich hätte es vorgezogen, bei meiner arabischen Lesart zu bleiben, bei den blumigen Versprechen, die dieser Name in den Himmel schrieb; ich hätte mir gewünscht, es wäre möglich gewesen, dort, wo ich zur Welt gekommen bin, zu wachsen, groß zu werden und zu sterben, an ein und demselben Ort, wie ein Baum, der, einzig von seinem Stolz genährt, inmitten von seinesgleichen erblüht und anschließend, wenn er seine reglose Reise durch die Zeit vollendet hat, selbst wiederum unzählige Nachkommen hervorbringt; es wäre mir ein Vergnügen gewesen, mich wie alle glücklichen Menschen der Illusion hinzugeben, man würde auf dem schönsten Fleckchen der Erde leben – auch wenn man eigentlich gar keine Vergleiche anstellen kann, weil man nie eine Reise unternommen hat; aber dieses Glücksgefühl ist mir genommen worden, und schuld daran sind der Krieg, die Diktatur, das Chaos, unermessliches Leid und zu viele Tote.
Immer wenn ich George W. Bush, den Präsidenten der Vereinigten Staaten, im Fernsehen betrachte, finde ich es beneidenswert, wie frei von Zweifeln er ist. Bush ist so stolz darauf, Amerikaner zu sein, als hätte er irgendetwas dafür getan … Als sei er nicht in Amerika geboren, sondern als hätte er es erfunden, ja genau, er hat Amerika hervorgebracht, und zwar gleich, nachdem er auf der Geburtsstation seine erste Windel vollgekackt hatte, und in der Krippe – brabbelnd und immer noch in Windeln – hat er dann immer weiter daran herumgefeilt, bis er es schließlich in der Grundschule mit seinen Malstiften vollendet hat. Logisch, dass er es jetzt, wo er erwachsen ist, regiert! Dass ihm nur keiner mit Christopher Columbus kommt, das nervt ihn. Und es soll ihm bitte auch keiner sagen, dass Amerika auch nach seinem Tod weiterexistieren wird, das verletzt ihn. Er ist so hingerissen von seiner Geburt, dass man meinen könnte, er hätte sich selbst auf die Welt gebracht. Als ob er sein eigener Sohn wäre und nicht der Sohn seiner Eltern, hält er das, was ihm gegeben wurde, für sein eigenes Verdienst. Muss Arroganz schön sein! Wunderbar, diese stumpfe Selbstgefälligkeit! Herrlich, diese Eitelkeit, sich für den Urheber dessen zu halten, was einem geschenkt wurde! Ich beneide ihn. Ich beneide jeden Menschen, der das Glück hat, an einem bewohnbaren Ort zu leben.
Ich heiße Saad Saad. Mein Name bedeutet auf Arabisch Hoffnung Hoffnung und auf Englisch Traurig Traurig. Manchmal bin ich Saad, die Hoffnung, manchmal Saad, der Traurige, doch in den Augen der großen Mehrheit bin ich gar nichts.
Ich schreibe diese Seiten am Ende dieser einen und am Beginn einer neuen Reise, um mich zu rechtfertigen. Ich wurde an einem Ort geboren, wo man nicht geboren werden sollte, deshalb wollte ich weg; ich bat darum, als Flüchtling anerkannt zu werden, und purzelte aus einer Identität in die nächste. Auswanderer, Bettler, Mensch ohne Aufenthaltsgenehmigung, Mensch ohne Papiere, ohne Rechte, ohne Arbeit; die einzige Bezeichnung, die jetzt auf mich passt, ist illegaler Einwanderer. Als Schmarotzer wäre ich noch besser dran. Oder als Profiteur. Als Betrüger erst recht. Nein, Illegaler. Ich gehöre keiner Nation an, nicht dem Land, aus dem ich geflohen bin, auch nicht dem Land, in das ich einreisen möchte, und noch weniger dem Land, das ich durchquere. Illegaler. Einfach Illegaler. Nirgendwo willkommen. Überall ein Fremder.
An manchen Tagen habe ich das Gefühl, mich der menschlichen Art zu entfremden …
Mein Name ist Saad Saad, aber vererben werde ich meinen Familiennamen wohl nicht. Zur Zeit habe ich eine vorübergehende Bleibe, in der ich beengt auf zwei Quadratmetern hause, und ich würde mich schämen, mich fortzupflanzen, denn damit würde ich nur eine Katastrophe am Leben erhalten. Pech für meine Mutter und für meinen Vater, die sich so über meine Ankunft auf dieser Erde gefreut haben, aber ich werde der letzte Saad sein. Der Letzte der Traurigen oder der Letzte der Hoffenden, das spielt keine Rolle. Der Letzte.
1
Ich wurde in Bagdad geboren, und zwar an dem Tag, als Saddam Hussein wutentbrannt die ersten weißen Haare an sich entdeckte und daraufhin durch den ganzen Palast brüllte, so dass seine Halsschlagader bedrohlich anschwoll. Er zitierte seinen Friseur zu sich und verlangte von ihm, sie auf der Stelle mit einer fetten rabenschwarzen Tönung zu überdecken, und anschließend ließ er den Mann, dem die Hände zitterten, wissen, dass er ihn von nun an für jedes noch so geringe Zeichen des Alterns verantwortlich machen würde: Er solle in Zukunft also besser die Augen aufsperren! Mit anderen Worten, ich wurde an einem Tag geboren, an dem der Irak nur knapp einer Katastrophe entronnen ist. Ein verhängnisvolles Omen oder ein gutes?
Dieses Detail findet nur deshalb Eingang in meine Erzählung, weil der Friseur zufällig der Ehemann der angeheirateten Tante einer Cousine der Halbschwester meiner Mutter war. Er gehörte also zur Familie … Als der Barbier an dem Abend zu uns kam, um meine Geburt zu feiern, konnte er es sich nicht verkneifen, hinter einem Vorhang versteckt und im Flüsterton meinem Vater die amüsante Anekdote zu erzählen; jedoch verriet er nie, weder an diesem Abend noch später, wo sich die entarteten Haare befunden hatten, ob sie auf dem Kopf oder an einem anderen Körperteil des Präsidenten gesprossen waren, aber diese Auslassung lenkte die Mutmaßungen in eine ganz bestimmte Richtung, denn jeder weiß, dass die Männer in unserem Land sich das Schamhaar schwarz färben, um möglichst lange männlich und potent zu wirken.
Auf jeden Fall hatten meine Eltern zwei Gründe, sich zu freuen: Ein Sohn kam zur Welt, und der Tyrann wurde langsam alt.
Ich wurde von allen begrüßt, als sei ich ein Wunder. Ist ja klar: Nach vier Mädchen war ich der, auf den man nicht mehr zu hoffen gewagt hatte. Die rosafarbene Nudel, die zwischen meinen Beinen baumelte, löste Begeisterungsrufe aus, mein liliputanischer Genitalapparat ließ dynastische Hoffnungen wieder aufkeimen. Ehe ich noch irgendetwas Intelligentes sagen oder tun konnte, wurde ich bereits verehrt; schon im zarten Alter von nur wenigen Stunden war ich der Auslöser für ein unvergessliches Fest, gefolgt von Verdauungsproblemen und schlimmer Katerstimmung am nächsten Morgen. In meinen ersten Lebensjahren wurde ich sehr verwöhnt, und deshalb fiel mir erst später als anderen Kindern in meinem Alter auf, wie meine Landsleute lebten – oder eben nicht lebten.
Wir hatten eine Wohnung in einem niedrigen, beigefarbenen Gebäude, einen Steinwurf von dem Gymnasium entfernt, in dem mein Vater als Bibliothekar arbeitete. Natürlich war die Schule die Baath-Schule, die Bücherei war die Baath-Bücherei, und auch das Radio, das Fernsehen, das Schwimmbad, die Sporthalle, das Kino, die Cafés gehörten der regierenden Baath-Partei … denen gehört ja sogar das Bordell, pflegte mein Vater zu sagen.
Von Anfang an hatte ich den Eindruck, dass es im Leben drei wichtige Instanzen gab: meine Familie, Gott und den Präsidenten. Beim Schreiben dieses Satzes wird mir bewusst, dass meine kühne Anordnung dieser Elemente nur aufgrund des zeitlichen Abstands möglich ist, denn damals hätte diese Aufzählung einen Iraker ins Gefängnis gebracht; es war klüger, die Hierarchie einzuhalten: der Präsident, Gott und meine Familie.
Überall hingen Plakate mit dem Foto des Präsidenten und überwachten unseren Alltag. Auf unseren Schulbüchern prangte sein Porträt, und nicht nur in den Behörden hing sein Bild, sondern auch in privaten Läden, angefangen bei den Bars und Restaurants bis zu den Stoff-, Geschirr- und Lebensmittelgeschäften. Ob aus Überzeugung, aus Vorsicht oder aus Feigheit, jeder stellte ein Abbild des irakischen Führers aus. Ein gerahmter Abzug von Saddam Hussein war wirkungsvoller als jeder Talisman, es war die minimale Maßnahme, um sich vor dem Unglück zu schützen – ein notwendiges, aber nicht immer ausreichendes Minimum: Willkürliche Verhaftungen und grundlose Gefängnisaufenthalte waren an der Tagesordnung. Ich glaubte, dass der Präsident uns durch seine Porträts hindurch beobachtete. Er war nicht bloß auf den Karton gedruckt, sondern er war wirklich da, er war anwesend, unter uns; hinter seinen Augen aus Papier verbarg sich eine Kamera und hinter den Pappohren waren Mikrophone versteckt, Saddam spionierte uns aus, er wusste, was wir in der Nähe seiner Bildnisse taten und sagten, er wusste alles. Wie viele irakische Schulkinder schrieb ich Saddam Hussein alle möglichen Fähigkeiten zu. Kein Wunder: Er war schließlich auch zu allem fähig.
Immer wieder waren Männer plötzlich verschwunden; manche von ihnen hatten eine Familie, eine Frau, Kinder, Nachkommen, und gaben dennoch plötzlich kein Lebenszeichen mehr von sich. Das konnte zwei Gründe haben: Entweder hatten diese Männer sich dem Widerstand gegen Saddam Hussein angeschlossen, oder sie waren eingesperrt, gefoltert und dann getötet worden, weil sie dem Widerstand angehört hatten. Niemand versuchte herauszufinden, welche der beiden Hypothesen zutraf, denn sich für die Wahrheit zu interessieren war zu gefährlich. Also ließ man die Verschwundenen verschwinden, ohne zu wissen, ob sie sich in den Bergen des ehemaligen Kurdistan versteckten oder ob ihre Körper in Säure aufgelöst worden waren.
Als Kind fand ich das abscheulich, erschreckend und normal; mit der Logik des jugendlichen Geistes hielt ich jedes Phänomen, das sich mir offenbarte, für alltäglich und hing an den Monstern, die mir Angst machten. Da ich mit grausamen Märchen aufgewachsen war und von meinem Vater ständig alte Legenden wie die von Gilgamesch erzählt bekam, war das Schicksal für mich etwas Willkürliches, Dunkles, Erschreckendes. Ich konnte mir eine Welt ohne Saddam Hussein nicht vorstellen, ohne seinen Absolutismus, seine Launen, seinen Hass, seinen Groll, seine Stimmungsschwankungen, seine Unduldsamkeit, seine abrupten Meinungsänderungen; er faszinierte mich; ich vergötterte und fürchtete ihn in gleichem Maße. Der einzige Unterschied zwischen der Welt der Märchen und der Wirklichkeit war, dass das Ungeheuer hier, außerhalb der Buchseiten und weit weg von den verzauberten Königreichen, Saddam Hussein hieß.
Meinem Verständnis nach waren Gott und Saddam Hussein Rivalen, unmittelbare Konkurrenten. Es gab so viele Gemeinsamkeiten und kaum Unterschiede: Auch ihm schuldeten wir Ehrfurcht und Respekt, auch an ihn richteten die Erwachsenen zaghafte Beschwerden und laut tönenden Dank, beide durfte man auf keinen Fall verärgern. Manchmal grübelte ich, wem ich wohl folgen würde, wenn ich mich einmal entscheiden müsste: Gott oder Saddam Hussein? In diesem Wettkampf um Einfluss stand Gott mit Saddam jedoch nicht auf einer Stufe: Zunächst, weil er sich kaum jemals in unser Alltagsleben einmischte, jedenfalls nicht in Bagdad … Hinzu kam, dass er viel länger brauchte als Saddam, um sich zu rächen …, er ließ sich, ohne aufzumucken, Beleidigungen gefallen, die von Saddam bereits bestraft worden wären, noch bevor sie ausgesprochen waren. In meinen Augen waren dies die Eigenschaften, die Gott ausmachten: Er war weniger blutrünstig, ein bisschen träge, nicht besonders nachtragend. Zerstreut. Vielleicht ein bisschen vergesslich … Ich versuchte mich an einer Hypothese: Wenn Gott mit seinen Vergeltungsmaßnahmen so lange wartete, lag das vielleicht daran, dass er gut war? Ich war mir nicht sicher, aber ich fand, dass seine ausgesprochene Gelassenheit für ihn sprach. Ich hielt Gott für liebenswürdig, liebenswürdiger als Saddam. Außerdem gab es ihn schon viel länger, unabhängig davon, dass in meinem kurzen Leben Saddam die ganze Zeit dagewesen und das Feld behauptet hatte. Schließlich kam hinzu, dass die Männer Gottes mir lieber waren als Saddams Männer: Die bärtigen Imame mit den violetten Lidern, die uns beibrachten, den Koran erst vorzulesen und dann darin zu lesen, strahlten eine Zugewandheit, eine Sanftheit, eine Menschlichkeit aus, die nicht zu vergleichen war mit dem Auftreten der brutalen Kerle von der Baath-Partei: misstrauische Beamte, unerbittliche Generäle, unbarmherzige Richter, Polizisten, die nicht lange fackelten, Soldaten, deren Finger am Abzug zu nervös war. Ja, kein Zweifel, die Freunde von Gott waren netter als die von Saddam. Außerdem schien selbst Saddam Gott zu respektieren. Vor wem verbeugte er sich?
Im Gegensatz zu Saddam, der mir Angst einjagte, und zu Gott, der mir Rätsel aufgab, bekam ich von meiner Familie Geborgenheit und Abenteuer; einerseits wusste ich, dass ich geliebt wurde, andererseits hielten vier Schwestern, eine überforderte Mutter und ein exzentrischer Vater meine Neugier wach. Unser Haus summte nur so vor Treppengetrappel, Gelächter, Gesang, gespielten Verschwörungen, echten Verbrüderungen, Schreien, die sogleich wieder von Scherzen übertönt wurden; wir hatten so wenig Geld und stellten uns so ungeschickt an, dass alles zu einem Problem wurde, Mittagessen, Ausflüge, Spiele, Einladungen. Aber es machte uns Spaß, mit diesen Schwierigkeiten fertig zu werden, ja wir verstärkten die Ärgernisse sogar noch, weil wir es auf sehr orientalische Weise liebten, alles Einfache kompliziert zu machen, damit uns nicht langweilig wurde. Ein unbeteiligter Beobachter hätte die Abläufe im Hause Saad zu Recht als »turbulent« bezeichnen können, solange er damit auch das intensive Glück gemeint hätte, das unser turbulenter Alltag für uns bereithielt.
Mein Vater trug durch seine Art zu sprechen dazu bei, unsere Ordnung noch weiter durcheinanderzubringen. Er war Bibliothekar, ein anspruchsvoller Leser und ein gebildeter, verträumter Mensch und hatte aus den Büchern die Manie angenommen, sich stets in einer gewählten Sprache auszudrücken; dem Beispiel der arabischen Gelehrten folgend, die ganz verrückt nach Gedichten waren, zog er es vor, sich in höheren Sprachgefilden zu bewegen, dort, wo die Nacht »der Mantel der Dunkelheit« heißt, »der sich auf den Kosmos herabsenkt«, ein Brot »die knusprige Vermählung des Mehles mit dem Wasser«, Milch »Honig der Wiederkäuer« und ein Kuhfladen »Kuchen der Weiden« genannt wird. Folglich sprach er von seinem Vater als dem »Autor seiner Tage«, seine Ehefrau, unsere Mutter, war »meine Quelle der Fruchtbarkeit« und seine Nachkommen »Fleisch von meinem Fleisch, Blut von meinem Blut, Schweiß der Sterne«. Sobald meine Schwestern und ich laufen konnten, benahmen wir uns wie ganz normale kleine Kinder, während mein Vater unser Tun mit ausgefallenen Worten kommentierte: Wir »stärkten« uns, anstatt zu essen, anstatt Pipi zu machen »benetzten wir den Staub der Wege«; wenn wir in Richtung Toilette verschwanden, »gehorchten wir dem Ruf der Natur«. Nur ergaben seine blumigen Umschreibungen keine klaren Mitteilungen, und wenn seine ersten, umständlichen Wendungen bei seinen Gesprächspartnern – vor allem bei uns, seinen Nachkommen – mal wieder nur auf erstaunte Gesichter stießen, dann verlor der Patriarch Saad die Geduld, wurde ärgerlich und kochte vor Wut angesichts von derartigem Banausentum. Dann ging er dazu über, seine Gedanken in die allergröbsten Worte zu kleiden – wenn er es schon mit Eseln zu tun hatte, dann wollte er sie auch so ansprechen. Und so ging er von »Das tangiert mich nicht« zu »Ist mir scheißegal« über, von »Versuch nicht, mich einzuwickeln, spaßiger Schlingel« zu »Verarsch mich nicht, Dumpfbacke!«. Die gebräuchlichen Worte waren meinem Vater schlicht unbekannt; er verwendete nur die beiden Extreme der Sprache, er bewegte sich ausschließlich auf ihren am weitesten auseinanderliegenden Ebenen und sprang zwischen gehobener Sprache und Vulgärsprache hin und her.
Ich kann mich an einen Samstag im Januar erinnern: Wir waren früh aufgestanden, um einen weit entfernt wohnenden Onkel zu besuchen, und er fragte mich beim Rasieren:
»Na, mein Sohn, gleich dem göttlichen Odysseus erzitterst du vor der rosenfingrigen Eos, nicht wahr?«
»Was hast du gesagt, Papa?«
»Frierst du dir nicht auch den Arsch ab um fünf Uhr morgens?«
Ich war gerne mit meinem Vater zusammen, denn seine bildhafte Ausdrucksweise gefiel mir.
Bei meiner Mutter hatte ich nie den Eindruck, ihr zu gehorchen, denn ich liebte sie so sehr, dass ich mit allem, was sie entschied, einverstanden war. Wir waren wie eine Person mit zwei Körpern: Ihre Anliegen wurden zu meinen Wünschen, ihre Seufzer konnten zu Tränen werden, die aus meinen Augen flossen; wenn sie glücklich war, war ich überglücklich.
Meine Schwestern wunderten sich zwar über dieses ungewöhnliche Einvernehmen, doch sie respektierten es. Da ich der einzige Junge war und sie davon ausgingen, dass sie ihr zukünftiges Leben auch in Gegenwart eines einzelnen Mannes verbringen würden, führten sie meine bevorzugte Position auf mein Geschlecht zurück und neideten sie mir nicht; im Gegenteil, sie buhlten um meine Gunst.
Wie man sieht, wuchs ich im Paradies auf. Bis ich zwölf wurde, lebte ich glücklich im Schutz dieser wunderbaren kleinen Welt, umgeben von mir ergebenen Frauen, einem lustigen Vater, einem Gott, der verreist war, und einem Despoten, den die Mauern unseres Hauses in respektvoller Distanz hielten.
In der Kindheit findet man sich mit absoluten Herrschern ab, in der Jugend aber fängt man an, sie zu hassen und will sie stürzen. Zur gleichen Zeit wie meine Körperbehaarung begann auch mein politisches Bewusstsein zu wachsen.
Mein Onkel Naguib, der Bruder meiner Mutter, wurde eines Morgens von den Männern des Präsidenten verhaftet. Er wurde eingesperrt, gefoltert, zurück ins Gefängnis gesteckt, erneut gefoltert und dann wieder auf dem Boden einer Zelle abgelegt; fünf Wochen später ließen sie den halb verhungerten Mann einfach auf der Straße liegen, schwach, verletzt und blutend, ein Haufen Knochen und Fleisch, den ausgehungerten Hunden zum Fraß vorgeworfen. Zum Glück kam eine Nachbarin vorbei und erkannte ihn, verscheuchte die Tiere und sagte uns Bescheid, bevor es zu spät war.
Zu Hause kümmerten meine Mutter und meine Schwestern sich liebevoll um Naguib, um ihn gesundzupflegen, auch wenn er bereits ein Auge und ein Ohr verloren hatte. Mehrere Tage vergingen, in denen Naguib wimmernd im Bett lag, fieberte, phantasierte und immer wieder von Albträumen geschüttelt wurde, dann erst konnte er wieder sprechen. Er erzählte uns, was ihm zugestoßen war. Sein Bericht fiel knapp aus: Die Schläger hatten ihn beschimpft, ihm Wasser und Nahrung verweigert, ihn stundenlang verprügelt, ohne ihm zu sagen, was ihm vorgeworfen wurde. »Verräter!«, »Spion!«, »du Schwein im Dienst der Amerikaner«, »von Israel bezahlter Dreckskerl«, das waren die wenigen Worte, die er zwischen den Schlägen mit einem Gürtel, den Fußtritten, den Hieben mit einem nagelbesetzten Schlagstock vernommen hatte – bei uns die denkbar banalsten Schimpfworte. Naguib verstand, dass sie ihn für schuldig hielten, aber schuldig woran? Er litt so sehr, dass er seine Folterer anflehte, ihn aufzuklären, und ihnen versprach, alles zu gestehen, was sie wollten, ja alles, nur damit der Schmerz aufhörte. Umsonst! Naguib enttäuschte sie, das war der einzige klare Gedanke, den er durch seine Schmerzen hindurch fassen konnte: Ihn zu quälen war für seine Peiniger eine Enttäuschung.
So, wie sie ihn verhaftet hatten, warfen sie ihn auch wieder aus seinem Kerker hinaus, ohne jede Erklärung.
Wir kannten unseren Onkel Naguib, von Beruf Pantoffelsticker, und wussten, dass er keine Eigenschaft besaß, die ihn verdächtig machte, denn er war weder Kurde noch Jude, noch Schiite, er hatte keinerlei Verbindungen zu Israel, schwärmte nicht für Amerika, unterhielt keine Kontakte in den Iran. Er war schuldig an nichts. Seine einzige Schuld bestand darin, dass sie ihn verdächtig fanden.
Von diesem Moment an wurden wir alle ebenfalls verdächtig …
Und kam es einem nicht so vor, als würde hinter Ereignissen wie Onkel Naguibs Misshandlung eine Absicht stecken, ein Plan: der systematische Versuch, eine Herrschaft des Terrors zu etablieren? In den Augen des hochsensiblen Präsidenten waren offenbar alle Iraker verdächtig, ja genau, alle verdächtig! »Wenn ihr eine Verschwörung gegen Saddam plant, dann werden wir, seine Männer, immer dahinterkommen. Manchmal irren wir uns zwar, das macht aber nichts, lieber töten wir einen Unschuldigen, als dass wir einen Schuldigen unbehelligt lassen. Seid also gewarnt. Euch bleibt nichts anderes übrig, als euch still und untergeben zu verhalten und zu kuschen.«
Mit elf Jahren wurde mir das Ausmaß der Ungerechtigkeit bewusst, die mein Land plagte, und in meiner allmählich breiter werdenden Brust nistete sich Empörung ein. Damals fasste ich einen Entschluss: Ich wollte den Männern des Präsidenten, im Gegensatz zu Onkel Naguib, legitime Gründe liefern, mich zu verdächtigen; falls sie mich eines Tages aufspüren, mit elektrischen Kabeln grillen und meinen Kopf bis zum Ertrinken in eine Badewanne stoßen würden, dann sollten sie mich nicht wegen nichts quälen: Also beschloss ich, aktiv gegen sie zu kämpfen.
An einem Donnerstag ging mein Vater an meinem Zimmer vorbei und überraschte mich dabei, wie ich mit den Fäusten gegen die Wand hämmerte. Sicherlich fügte ich meinen Gelenken dabei mehr Schaden zu als der Mauer, und mein Kampf richtete sich gegen den falschen Feind, aber ich konnte trotzdem nicht aufhören, zuzuschlagen.
»Fleisch von meinem Fleisch, Blut von meinem Blut, Schweiß der Sterne, was machst du denn da?«
»Ich bin wütend.«
»Gegen wen richtet sich dein Groll?«
»Saddam Hussein.«
»Halt den Mund. Komm mit.«
Er nahm mich an der Hand und führte mich in einen Kellerverschlag unter unserem Haus. Und dort lernte ich den Schatz kennen, den mein Vater hütete – es waren Bücher, die er ein paar Jahre zuvor aus der Bibliothek hatte entfernen und die er eigentlich dem Ministerium hätte schicken müssen, damit sie vernichtet würden, die er aber stattdessen behalten hatte. Nun standen sie bei uns im Keller, wo sie, hinter alten Kelims versteckt, mehrere Regalbretter füllten.
Unter ihnen gab es alle möglichen Arten von verbotenen Büchern, kurdisch die einen, zu freizügig die anderen, wieder andere waren christlich; es war drollig, zu sehen, wie Werke, die einen irgendwie extremen Inhalt hatten – egal, ob es sich um religiöse Predigten oder eine erotische Erzählung handelte –, in den Augen der Zensoren der Baath-Partei alle dieselbe rote Linie überschritten, die der Provokation. So kam es, dass der Bischof Bossuet und der Marquis de Sade zu Brüdern in der Schändlichkeit wurden, die nebeneinander in der Hölle am Spieß brieten. Ein Gutes hatte die Jagd der Partei auf bestimmte Bücher: Ihr Besitz wurde schon aus so geringem Anlass untersagt, dass mein Vater eine hübsche Sammlung hatte sicherstellen können – da prangte das Beste aus der europäischen Literatur, französische Essayisten, spanische Dichter, russische Romanciers, deutsche Philosophen, neben den Krimis von Agatha Christie, welche zwei Regalbretter füllten, weil man der Ansicht war, dass der Irak, der noch vor kurzem unter britischer Mandatsverwaltung gestanden hatte, sich nun auch von der berühmtesten englischen Schriftstellerin trennen müsse.
Man kann sagen, dass mein Vater, indem er mir Zugang zu seinem Geheimnis verschaffte, meine Erziehung zum Abschluss brachte – oder aber erst damit anfing. Er war stolz auf sein Land und schwärmte für dessen jahrtausendealte Geschichte, sprach von Nebukadnezar, als hätte er ihn erst gestern getroffen, und hasste das aktuelle Regime. Diese Bücher aufzubewahren gab ihm das Gefühl – Saddam zum Trotz, der in seinen Augen ein Usurpator war – , die irakische Tradition aufrechtzuerhalten, die einer hochgebildeten Zivilisation, die die Schrift erfunden und ein enormes Interesse an fremden Kulturen gezeigt hatte. Er nannte seine geheime Bibliothek »mein Babel für die Hosentasche«, weil er fand, dass sie ein winziges Abbild des Turms zu Babel darstellte, der einst die Neugierigen aus aller Welt herbeiströmen ließ, die sich in vielen verschiedenen Sprachen unterhielten.
Das war der Tag, an dem ich das Lesen für mich entdeckte und Geschmack daran fand – am Lesen und an der Freiheit, denn beides ist ein und dasselbe –, und ich verbrachte den Rest meiner Jugend damit, mir der Indoktrination bewusst zu werden, mit der wir in der Schule bedrängt wurden, mich dagegen zu wappnen und zu versuchen, meine eigene Denkweise zu entwickeln.
Als meine Schwestern heirateten, wurde mir bewusst, dass ich kein Mädchen war, auch wenn ich unter lauter Frauen aufgewachsen war. Denn Mädchen haben nichts anderes im Kopf als heiraten, sie sind davon völlig besessen: Erst malen sie sich den idealen Bewerber aus, und haben sie ihn einmal ausfindig gemacht, fangen sie sofort an, die Zeremonie vorzubereiten. Und nach der Hochzeit gehen sie sogar so weit, ihr Elternhaus zu verlassen – ja wirklich, so schlimm ist es –, um sich der Ehe zu widmen; der Ehe wohlgemerkt, nicht dem Ehemann, denn der Mann hat – wie alle Männer – auch noch andere Dinge zu tun, er arbeitet, er diskutiert, er trifft seine Freunde zum Würfeln und Minztee-Trinken oder zum Domino-Spielen oder zum Schach. Ja, so sind sie, die Mädchen, und meine Schwestern bildeten da keine Ausnahme.
»Die Familie vergrößert sich«, verkündete meine Mutter, und Tränen rannen ihr die Wangen herab, und das bedeutete: »Das Haus leert sich«. Sie ahnte aber nicht, wie sehr sie damit recht hatte, denn sie hatte keinen Schimmer davon, dass unsere Bibliothek, das »Babel für die Hosentasche«, sich ebenfalls leerte, weil mein Vater, ein kleiner Beamter, jedes Mal das Risiko einging, ein paar von den verbotenen Büchern zu Geld zu machen, um die Hochzeitsfeier zu finanzieren.
Als Saddam Hussein im August 1990 den Krieg gegen Kuweit begann, hatte ich bereits zwei Schwäger hinzugewonnen – Aziz und Rachid – sowie drei Nichten und Neffen.
Der Feldzug scheiterte, und meine Schwestern legten schwarze Schleier an, denn ihre Ehemänner waren im Kampf gefallen. Als Witwen kehrten sie mit ihren Babys nach Haus zurück. Mein Vater verkaufte ein paar Möbel unter dem Vorwand, es wäre mal wieder an der Zeit, unsere Wohnung umzuräumen.
Dann begann die Handelsblockade. Um Saddam Hussein für seine aggressive Politik zu bestrafen – den Vorwurf teilte ich voll und ganz –, beschlossen die Vereinten Nationen, ein Embargo über den Irak zu verhängen.
Ich weiß nicht, ob die reichen, dicken, entrüsteten Politiker, die diese Strafe beschlossen haben, sich auch nur einen Augenblick gefragt haben, wie wir, die Iraker, damit zurechtkommen würden; ich glaube kaum, und das ist auch das Einzige, was ich zu ihrer Entschuldigung anführen kann. Das Embargo, das Saddam Hussein das Leben schwer machen sollte, traf allein uns, das Volk. Als der Dinar mehr als das Tausendfache seines Wertes verlor, gingen wir mit Bündeln von alten Geldscheinen zum Einkaufen, die wir in Müllsäcken oder Pappkoffern versteckten; im Übrigen, was sollte man überhaupt dafür kaufen? Niemand hatte etwas zu verkaufen. Viele Bürger verließen die Stadt, um wieder auf dem Land zu leben. Ohne die Pakete, die die Regierung jeden Monat verteilen ließ – Mehl, Speiseöl, Tee und Zucker –, wären wir verhungert; davor bewahrte uns die Rationierung, aber Hunger litten wir dennoch. In Bagdad regierte eine wachsende Angst, und zwar nicht mehr nur die Angst vor Saddam Hussein, nein, auch die Angst, nachts bestohlen zu werden, falls man etwas besaß, das man noch nicht eingetauscht hatte: Der Taxifahrer übernachtete mit einer Pistole hinter dem verrammelten Tor seiner Garage in seinem Wagen; Familien hielten abwechselnd Wache, um zu verhindern, dass ihnen ein Sack Reis oder eine Kiste Kartoffeln abhandenkam. Aber die größte Angst, die heimlich an jedem Iraker nagte, war die Angst davor, krank zu werden.
Genau das passierte den Kindern meiner Schwestern. War die Milch der jungen Mütter durch den Schock, den der Tod ihrer Ehemänner bei ihnen ausgelöst hatte, vielleicht verdorben? Ging vielleicht eine Traurigkeit von ihnen aus, eine Ängstlichkeit, die ansteckend war? Erst wurden die Kleinen krank, dann bekamen sie chronischen Durchfall.
Jedes Mal begleitete ich Mutter und Säugling zum Gesundheitsdienst. Beim ersten Mal gab der Arzt uns ein Rezept, das sich als wenig hilfreich herausstellte, da das entsprechende Medikament nicht verfügbar war. Beim zweiten Mal weigerte er sich, das Mädchen zu behandeln, obwohl sie sich vor ihm fast die Lunge aus dem Leib hustete, wenn wir ihm nicht heimlich Geld zusteckten – dank eines Hochzeitsschmuckstücks meiner Mutter, das sie verpfändete, konnten wir sie retten. Beim dritten Mal teilte er uns mit, wir könnten ihm das Gold der Emire in einer Schubkarre bringen: selbst dann wäre er nicht in der Lage, an die nötigen Medikamente heranzukommen, weil es sie im ganzen Land nicht gab – das unschuldige Mädchen starb. Beim vierten Mal stand der Arzt allein in einem leeren Untersuchungszimmer am Fenster, denn seine Kollegen hatten ihren Arbeitsplatz verlassen, um ins Ausland zu gehen, und den Krankenschwestern fehlte das Geld, um mit dem Auto zur Arbeit zu kommen; er wartete darauf, dass ein Patient ihm doch bitte sein Stethoskop abkaufen solle, damit er Essen für seine Familie kaufen könne. Auch dieses Kind starb.
Innerhalb von wenigen Jahren hatte meine älteste Schwester ihren Mann im Krieg und dann nacheinander ihre Tochter und ihren Sohn wegen des Embargos verloren. Danach gab sie mit fünfundzwanzig Jahren das Bild einer alten Frau ab – müde, hohle Wangen, matte Haut, raue Hände, ein erloschener Blick.
Jeder Iraker, der diese Zeit überlebt hat – tatsächlich starben zuerst die Babys –, wird jenen Herren von den Vereinten Nationen versichern, dass ein Embargo in Wirklichkeit das beste Mittel ist, ein bereits unglückliches Volk zusätzlich zu strafen und gleichzeitig seine Führer zu stärken. Zement für den Schmerz! Beton, um Diktaturen zu stärken! Vor dem Embargo wurden die Menschenrechte im Irak nicht respektiert; in den zehn Jahren, die das Embargo dauerte, wurden sie es genauso wenig. Aber es kam noch hinzu, dass man sich nicht mehr ernähren konnte und es immer schwieriger wurde, behandelt zu werden. Kinderlähmung wurde wieder häufiger, die Zahl der Diebstähle stieg sprunghaft an, die Korruption ebenso. Indem das Embargo Saddam in seiner absoluten Macht einschränkte und ihn infolgedessen auch von seiner alleinigen Verantwortung befreite, wurde der Despot entlastet; wenn ein Lebensmittel knapp wurde, dann war das Embargo daran schuld; wenn Reparaturen auf sich warten ließen, war das Embargo schuld; wenn wichtige öffentliche Baumaßnahmen nicht zu Ende gebracht wurden, war das Embargo schuld. Das Embargo schwächte den Aggressor nicht im Geringsten, im Gegenteil, es entfaltete exakt die entgegengesetzte Wirkung: Aus Saddam Hussein wurde wieder der vom Himmel Gesandte, die einzige Rettung der Iraker vor den feindlichen Barbaren. Trotzdem können die gewieften Politiker, die unser Volk zu noch mehr Leid verdammten, dessen bin ich mir sicher, in ihren Ländern unbehelligt alt werden, nachdem sie mit Ehren überschüttet und für ihre humanitären Taten ausgezeichnet wurden, und niemals wird ihr Schlaf von den Erinnerungen an die furchtbaren Folgen ihrer Entscheidungen gestört, von denen sie nichts wissen.
In dieser Zeit spielte ich hin und wieder mit dem Gedanken, nach Europa oder in die USA auszuwandern; aber es war ein faules Nachdenken, dem der Drang zur Tat fehlte, so wie man eine rein rechnerische Lösung ins Auge fasst, weil es bequem ist, denn mir war aufgefallen, dass die Familien, von denen ein Mitglied sich im Ausland aufhielt, besser mit dem Mangel zurechtkamen: Zwei Dollar in einem Umschlag konnten den Kurs eines Schicksals verändern. Ich weihte meinen Vater in meine Überlegungen ein.
»Meinst du nicht, dass ich woanders mehr Erfolg haben könnte?«
»Erfolg wobei, mein Sohn, Fleisch von meinem Fleisch, Blut von meinem Blut, Schweiß der Sterne?«
»Mit meiner Karriere. Anwalt oder Arzt, egal. Wenn ich auswandern würde?«
»Mein Sohn, es gibt zwei Arten von Auswanderern: Die einen nehmen zu viel Gepäck mit, die anderen reisen leicht. Zu welcher Sorte gehörst du?«
»Hm …«
»Diejenigen, die zu viel Gepäck mitnehmen, glauben, dass alles in Ordnung kommt, wenn sie weggehen; in Wirklichkeit kommen die Dinge für sie niemals in Ordnung. Warum? Weil sie selbst das Problem sind! Sie nehmen das Problem immer mit sich, so kommt das Problem herum und sieht etwas von der Welt, aber sie lösen es nicht, gehen es nicht einmal an. Diese Auswanderer bewegen sich zwar, aber sie verändern sich nicht. Es bringt nichts, dass sie in die Ferne ziehen, sie werden sich selbst nicht los; sie werden ihr Leben woanders genauso grandios vermasseln wie hier. Das sind die schlechten Auswanderer, diejenigen, die eine Vergangenheit mit sich herumschleppen, die mehrere Tonnen wiegt, mit ihren ungelösten Schwierigkeiten, ihren uneingestandenen Fehlern, ihren verborgenen Unzulänglichkeiten.«
»Und die anderen?«
»Sie sind mit leichtem Gepäck unterwegs, weil sie aufgeschlossen sind, flexibel, anpassungsfähig, in der Lage, sich zu bessern. Sie werden von einer veränderten Umgebung zu profitieren wissen. Das sind die guten Auswanderer.«
»Und woher weiß man, ob man zu den guten oder zu den schlechten gehört?«
»In deinem Alter, mit fünfzehn, ist es dafür noch viel zu früh.«
Ich redete nicht mehr davon und dachte auch nicht mehr daran. Zwischen den Schulstunden, welche immer seltener wurden – entweder waren unsere Lehrer nach Jordanien geflohen, oder wir lernten ohne Hefte und Stifte, auf dem Boden der Klasse kauernd, indem wir uns mit dreißig Schülern ein einziges Schulbuch teilten –, verkaufte ich vor den Toren der Ministerien Weihrauch, um ein paar Dinar nach Hause zu bringen, und interessierte mich brennend für das Schlamassel, in dem mein Land steckte.
Es kursierten Gerüchte über Saddam Husseins Gesundheit. Eines Tages wurde Krebs bei ihm festgestellt; sechs Monate später hieß es, ein Infarkt habe ihn niedergestreckt; dann war er durch ein sehr seltenes Virus erblindet; schließlich fesselte eine Hirnblutung ihn stumm und gelähmt ans Bett. Anschließend wurden diese Nachrichten von neuen Fotos oder neuen Fernsehauftritten dementiert: Es ging ihm blendend, dem Führer des Volkes, sein Haar glänzte schwarz, ein Korsett hielt seine Bauchmuskeln in Form, er war wohlgenährt, kerngesund, kannte keinen Hunger. Obwohl es offensichtlich war, gab es ein paar Unbeirrbare, die darauf beharrten: »Seid nicht naiv, die Baath-Partei führt uns einen Doppelgänger vor, einen der vielen Doppelgänger des Präsidenten.« Die Tyrannei aber war keine Täuschung, sie war real … Allen Richtigstellungen zum Trotz kehrten die Gerüchte immer wieder und wurden mit der Geschwindigkeit der arabischen Artikulation verbreitet, denn sie waren die Luft, die wir zum Atmen brauchten, flüchtige, aber nicht kleinzukriegende Formen der Hoffnung, der Hoffnung, dass es eines Tages mit ihm vorbei sein würde. Diejenigen, die sie erfanden, traten damit in den Widerstand, nicht in den aktiven Widerstand – das war zu gefährlich –, sondern in den Widerstand der Vorstellungskraft. Der Krebs, den sie ihm andichteten, tauchte nie an zufälligen Körperteilen auf, sondern der Tumor saß immer an einer strategischen Stelle von Saddam Hussein, und zwar an der, die wir am liebsten verschwinden sehen wollten, an seinem Hals, seinem Gehirn, und der Hauptpreis für die häufigste Nennung ging an den Dickdarm.
Und wenn es keiner Krankheit gelänge, zum Diktator durchzudringen, so munkelten manche, dann würde es ja vielleicht den Amerikanern gelingen, die sich bereits zum Kampf gegen ihn rüsteten.
Auch wenn die Amerikaner keine Krankheit waren.
Obwohl …
Aber greifen wir nicht zu weit vor.
2
Während sein Volk verhungerte, baute Saddam Hussein neue Paläste. Außerdem weinte er gern und rauchte Zigarren, und so konnte man nie wissen, ob es der Qualm war, der seine Tränen auslöste, oder ob ihn plötzlich ein menschliches Gefühl überkommen hatte.
»Fleisch von meinem Fleisch, Blut von meinem Blut, Schweiß der Sterne, Saad, mein Sohn, ich stelle fest, dass unser Land seit Nebukadnezar viele größenwahnsinnige Könige hervorgebracht hat, kriegslustige Eroberer, denen die Bedürfnisse der Bürger gleichgültig sind; Saladin und Saddam Hussein sind da nur zwei weitere Beispiele. Nun gut, ich meine, den Grund dafür herausgefunden zu haben …«
»Ja?«
»Die Palmen.«
»Die Palmen?«
»Ja. Alle Probleme des Irak rühren von den Palmen her.«
»Äh …«
»Ich würde sogar noch weitergehen: Die Palmen sind die Ursache für die Probleme der arabischen Welt.«
»Soll das ein Scherz sein?«
»Wir glauben, wir hätten es mit politischen Schwierigkeiten zu tun, dabei handelt es sich um ein gärtnerisches Problem. Die Palmen sind daran schuld, dass es uns nicht gelingt, ein demokratisches Land zu werden.«
Ich wartete darauf, dass mein Vater sich entschloss, es mir zu erklären; jedes Gespräch mit ihm verlief über viele Umwege, gut, wenn man es spannend mochte.
»Es ist wenig verwunderlich, dass eines der ersten Parlamente in Island gebildet wurde, in der Nähe des Nordpols, in einem felsigen Tal voller Schnee und Eis: Es gab dort keine Palmen! Erinnerst du dich? Das war im neunten Jahrhundert.«
»Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, Papa.«
»In unseren Breitengraden war das natürlich unmöglich.«
»Wegen der Palmen!«
»Wegen der Palmen, mein Sohn, Fleisch von meinem Fleisch, wundersamer Zweibeiner, der mich so gut versteht. Bei uns geben die Palmen ein schlechtes Vorbild ab. Wie wächst denn die Palme? Sie hebt sich nur in den Himmel, wenn man den unteren Teil beschneidet; das ist der Preis, damit sie in den blauen Himmel wächst und dort oben herrscht. Jeder arabische Herrscher wähnt sich als Palme: Damit er wächst und sich entwickeln kann, schneidet er sich vom Volk ab, entfernt sich, sagt sich los. Die Palme begünstigt den Despotismus.«
»Einverstanden. Und was sollen wir jetzt machen? Unkrautvernichtungsmittel kaufen?«
Er lachte und schenkte uns Tee nach.
Im Zimmer nebenan waren meine Schwestern und meine Mutter, vollkommen unempfänglich für unsere Männerthemen, geräuschvoll und mit Begeisterung damit beschäftigt, zwei neue Hochzeiten vorzubereiten.
»Nebukadnezar, Saladin, Hussein … es mangelt uns an Durchschnittsmenschen. Seit der Frühzeit des Irak haben unsere Herrscher den Kult der Größe praktiziert.«
»Papa, ich sehe nicht, was an Saddam Hussein groß sein soll!«
»Seine Paranoia. In dem Punkt überflügelt er uns alle.«
Als hätte ihn plötzlich etwas angefallen, wurde mein Vater plötzlich unruhig und senkte die Stimme; er ließ seine Blicke im Halbdunkel des Zimmers umherschweifen, in dem wir unsere Unterhaltung führten, und fuhr dann fort:
»Niemand weiß mehr, wo er wohnt oder wo er schläft, so sehr fürchtet er sich vor Attentaten. Doppelgänger treten in der Öffentlichkeit auf. Früher hat er die Rebellen durch Terror abgeschreckt, jetzt schreckt er sie ab, indem er mit der Landschaft verschmilzt.«
»Ich weiß«, seufzte ich und verschwieg ihm, dass ich in der Universität einer geheimen Widerstandsgruppe beigetreten war und dass wir uns zum Ziel gesetzt hatten, Saddam Hussein zu töten.
»Erst hat er seine Feinde massakriert, dann seine Gegner, dann seine Freunde, dann seine Mitstreiter. Jetzt umgibt er sich nur noch mit seiner Familie; ich warte nur darauf, dass er auch sie auslöscht.«
»Das wird einmal die entscheidende Botschaft sein, die Saddam uns zurücklässt: Man kann immer noch besser darin werden, schlecht zu sein!«
Wir brachen in Gelächter aus, in einer Diktatur wird nämlich viel gelacht, das Lachen gehört zu den überlebenswichtigen Fähigkeiten.
Dann fuhr mein Vater fort, die Stirn in tiefe Falten gelegt:
»Das ist es, was er in diesem Land zerstört hat: das Vertrauen. Weil er niemandem traut, hat er eine Gesellschaft aufgebaut, die ihm gleicht, eine Gesellschaft, in der jeder Angst hat, in der jeder den Verrat fürchtet, in der jeder Bürger auf der Hut ist und gleichzeitig selbst seine Nachbarn überwacht, in der dein Nächster dir niemals nah ist, sondern immer ein Verräter, ein Denunziant, ein potentieller Feind. Dieser Paranoiker hat uns alle infiziert, mittlerweile ist der Irak noch kränker als er. Wenn es damit ein Ende hätte, ob wir dann wohl wieder gesund werden könnten?«
Der Schatten des Krieges legte sich über das Land.
Seit islamistische Terroristen die USA angegriffen hatten, indem sie zwei Türme mitsamt der dreitausend Menschen darin zu Pulver gemacht hatten, blickten wir gen Himmel und zählten die Tage bis zum Angriff der amerikanischen Armee. Zwar bestand keine direkte Verbindung zwischen den Irakern und dem Einsturz der New Yorker Gebäude im September 2001, aber wir ahnten, dass dieser Skandal dem Präsidenten Bush in die Hände gespielt hatte und dass er seine Waffen, wenn er mit Afghanistan fertig wäre, auf uns richten würde.
Im Gegensatz zu meinen Kameraden hoffte ich das.
Im Gegensatz zu meinen Kameraden sah ich in den G.I.s, die bei uns landen würden, mögliche Befreier.
Im Gegensatz zu meinen Kameraden hatte ich die USA nie verabscheut; die väterliche Bibliothek, unser »Babel für die Hosentasche«, hatte mich davon abgehalten, mich diesem Denken anzuschließen.
Bei unseren heimlichen Treffen im Hinterzimmer des Café des Délices schwieg ich; ich wusste, dass keiner der Studenten mich verstehen würde, weil sie nicht die Möglichkeit gehabt hatten, in den Genuss so vieler unterschiedlicher Bücher zu kommen. Sie wollten Saddam Hussein zwar loswerden, das verhinderte jedoch nicht, dass ihr Hass auf die USA einen großen Teil ihrer politischen Kultur ausmachte, er war Teil ihrer Protestbewegung.